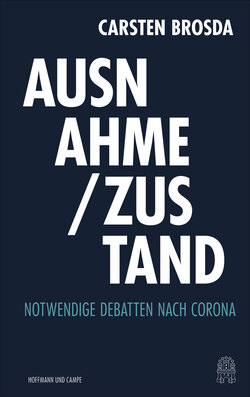Читать книгу Ausnahme / Zustand - Carsten Brosda - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die neue Erfahrung globaler Nähe
ОглавлениеIn der Wahrnehmung der Krise dominierten die Abstandsregeln, die sich zur Bekämpfung der Ausbreitung des Virus in unserer Gesellschaft durchgesetzt haben. Hygiene, Mund-Nasen-Schutz und ein Sicherheitsradius von anderthalb Metern zwischen sich begegnenden Fremden haben sich als die wichtigsten Mechanismen zur Verhinderung von Infektionen erwiesen. In der Folge ist viel nachgedacht worden darüber, was diese neue Distanziertheit im Alltag mit unserem Miteinander macht.
Aber zu Beginn der Virusentwicklung ist eine ganz andere Erfahrung der Nähe von Bedeutung gewesen: die Erfahrung, dass es keine distanzierte Entwicklung auf unserem Globus mehr gibt, dass uns alles sehr schnell sehr nahe kommen kann – auch ein Krankheitsgeschehen am anderen Ende der Welt.
Als im Januar 2020 die ersten Meldungen von einem neuartigen Coronavirus aus China nach Europa gelangten, schauten die hiesigen Medien aus interessierter Distanz auf die Entwicklungen in Wuhan. Das im Verlauf immer rigidere Krisenmanagement der autokratischen chinesischen Staatsführung stand dabei genauso im Blick wie die Spezifika des unbekannten Erregers SARS-CoV-2. Der Bau zweier neuer Krankenhäuser binnen gerade einmal zehn Tagen wurde zum Anlass genommen, über die schleppenden Infrastrukturentwicklungen in Deutschland zu räsonieren. Das Schicksal des ersten Arztes, der Ende Dezember 2019 vor dem neuen Virus warnte und später selber erkrankte und verstarb, bewegte auch die hiesige Öffentlichkeit. Und die Berichte von Isolierstationen, Ausgangssperren und einem zunehmend an seine Grenzen gelangenden Gesundheitssystem beschrieben eine ferne Dystopie. Die Frage, ob und auf welchen Wegen das dortige Infektionsgeschehen auch nach Europa und nach Deutschland gelangen könnte, blieb demgegenüber – abgesehen von wenigen, damals aber noch marginalisierten Expertenstimmen – deutlich im Hintergrund.
Auch die politischen Aussagen zu den Gefahren von SARS-CoV-2 für die hiesige Gesellschaft waren betont undramatisch. Und das nicht, weil die Politik beschwichtigen wollte, sondern weil sie sich auf entsprechende Urteile der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des Robert-Koch-Instituts (RKI) berufen konnte. Ende Januar führte der Bundesgesundheitsminister aus, dass man die Krankheit einordnen müsse, dass auch an der Grippe jedes Jahr bis zu 20000 Menschen in Deutschland stürben und dass im Vergleich dazu das Infektionsgeschehen bei der neuen Lungenkrankheit milder sei. Die Gefahr durch das neue Virus für die Gesundheit, so der Minister auf Grundlage von Einschätzungen des RKI, bleibe weiterhin gering. Und noch Ende Februar hieß es auf der Homepage der Tagesschau: »Man könne nicht ›das gesamte öffentliche Leben in Deutschland, Europa und der Welt beenden‹, so der Minister, zumal die Lage in China und Italien zeige, dass es ›das Infektionsgeschehen nicht beendet‹, wenn man ganze Orte abriegele.« Wenige Wochen später ist genau das in Deutschland, Europa und weiten Teilen der Welt geschehen, um die Welle der Neuinfektionen zu brechen.
Es wäre ein Leichtes, der Politik und den sie beratenden Expertinnen und Experten in diesen frühen Tagen Leichtsinnigkeit oder Inkonsistenz vorzuwerfen. Aber das wäre der Außergewöhnlichkeit der Situation und ihrer anfänglichen Undurchdringlichkeit nicht gerecht geworden. Schließlich handelte es sich um ein Infektionsgeschehen, das zumindest in unserer Zeit in Ausmaß und Geschwindigkeit ohne Beispiel war. Natürlich wissen wir, wie nahe die einzelnen Regionen der Welt einander gerückt sind, wie sehr die Distanzen zwischen den Kontinenten heutzutage keine Rolle mehr spielen. Und doch ist es etwas anderes, über solches Wissen abstrakt zu verfügen oder aber es konkret anhand einer lebensbedrohlichen Krankheit vor Augen geführt zu bekommen.
Gleiches gilt für die exponentielle Entwicklung, die sich einstellt, wenn ein Infizierter das Virus an mehrere Mitmenschen weitergibt. Hier kann mit einem Husten eine Lawine ins Rollen gebracht werden, deren Ausmaß man zwar errechnen, aber keinesfalls intuitiv erfassen kann. Unser Denken ist auf lineare Entwicklungen geeicht. Das ist der Maßstab, den wir zugrunde legen, wenn wir künftige Entwicklungen abschätzen und prognostizieren.
Und auch die vielen Analogieschlüsse zur normalen Grippe, zur SARS-Epidemie von 2003 oder zu den wieder steigenden Maserninfektionen waren eher hilflose Versuche, gesichertes Wissen auf eine ungesicherte Situation zu übertragen. Wenn das Geschehen global vernetzt ist und sich exponentiell entwickelt, dann können solche Spekulationen schnell problematisch werden. Denn schon minimale Veränderungen bei der Beurteilung der Ausgangslage können zu enormen Veränderungen bei den längerfristigen Rückschlüssen führen.
Es wird eine Aufgabe der medizinischen Forschung sein, Analyseraster zu entwickeln, die künftig schnellere und verlässlichere Prognosen ermöglichen. Aber dass wir zu Beginn einer neuen Bedrohung noch nicht genug über ihre Entwicklung und Auswirkung wissen können, ist keine hinreichende Erklärung für die rückblickend merkwürdige Entspanntheit, die zunächst in Deutschland herrschte. Diese ist vielmehr zurückzuführen auf ein nach wie vor mangelndes Bewusstsein dafür, wie eng unser Leben und Arbeiten auf der Erde mittlerweile verflochten ist.
Ganz offensichtlich fehlt uns nicht nur ein Gespür dafür, was in anderen Erdteilen geschieht, sondern wir fühlen uns von den dortigen Entwicklungen auch weitgehend unberührt und damit unverletzlich. Die Sorglosigkeit der Anfangstage war nicht zuletzt das Resultat der Überheblichkeit einer saturierten Gesellschaft, die stolz ist auf ihr gut entwickeltes Gesundheitssystem und die glaubt, immun zu sein gegenüber einer Gesundheitskatastrophe, die irgendwo am anderen Ende der Welt ausbricht.