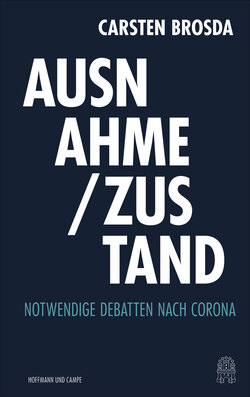Читать книгу Ausnahme / Zustand - Carsten Brosda - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Angst vor dem Kontrollverlust
ОглавлениеWer auf die Zeit zurückblickt, in der das Virus vermeintlich weit weg in Asien oder – schon näher gerückt – in Norditalien wütete, der stößt auf viele Aussagen, die die Leistungsfähigkeit unserer Infrastrukturen und unserer gesundheitlichen Maßnahmen preisen. Dahinter war nicht selten die Annahme zu spüren, dass solche Pandemien zwar anderen passieren können, aber doch nicht einem so modernen und so hochtechnisierten Land wie Deutschland. Offensichtlich war der Glaube an die eigene Unverletzlichkeit bei uns ganz besonders ausgeprägt.
Wer den hiesigen Verlauf der Epidemie mit dem an anderen Orten der Welt vergleicht, stellt fest, dass eine solche Betrachtungsweise nicht ganz unbegründet ist: In Deutschland wurde früh viel getestet, die Sterblichkeitsraten waren durchweg vergleichsweise niedrig und die Belastungskapazitäten des Gesundheitswesens nicht ausgeschöpft. Im Rahmen möglicher Vorsorgebemühungen ist also vieles richtig gemacht worden, selbst wenn man sich zwischenzeitlich wundern musste, dass auf einmal die Verfügbarkeit eines eigentlich preiswerten Artikels wie Schutzmasken zum Problem werden konnte und alle bang auf die nächsten Tage schauten, ob noch ausreichend FPP2- und FPP3-Masken in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen vorhanden waren. Abgesehen von solchen Ausnahmeerscheinungen aber blieb die objektive Stabilität der Versorgungssysteme gewährleistet.
Doch während die Gesundheitsversorgung weitgehend reibungslos weiter funktionierte, haben wir gespürt, dass unsere eigene Lebenssicherheit vielleicht nicht so stabil ist, wie wir bislang geglaubt haben. Sorgen vor einer zunehmend als unsicher empfundenen Zukunft bedrängen schon seit einiger Zeit unsere demokratische Öffentlichkeit. Wir haben uns in der Vergangenheit vielleicht nicht für unverwundbar gehalten, aber wir sind mindestens davon ausgegangen, dass uns so leicht nichts anhaben kann, dass schon einiges passieren muss, um uns aus dem Konzept zu bringen. COVID-19 und die zu seiner Eindämmung notwendigen Schritte fordern nun die Grundlagen unseres Lebensmodells frontal heraus. Wir spüren einen Kontrollverlust gleich in mehreren Dimensionen:
Unsere vielfach in einzelne, je ihren eigenen Logiken gehorchende Bereiche parzellierte Gesellschaft muss erleben, dass ihr bislang beinahe reibungslos wirkendes Funktionieren fundamental infrage gestellt werden kann. Plötzlich spannt sich eine existenzielle Frage von Leben und Tod auf, die alle anderen eher funktionalistischen Erwägungen an den Rand drängt. Plötzlich kann man selbst im wirtschaftlichen Bereich nicht mehr einfach entlang der Logik von Geld und Profit entscheiden, sondern muss feststellen, dass es Fragen gibt, die von solch grundsätzlicher Natur sind, dass sie alle anderen Erwägungen zurückdrängen. In der Folge dieser Erfahrung werden plötzlich Eingriffe möglich, die noch wenige Wochen zuvor undenkbar gewesen wären.
Die Wucht, mit der diese eigentlich sehr alte, aber für unsere Gesellschaft ungewohnte Logik des Überlebens in den Alltag beinahe aller sozialen Systeme hereingebrochen ist, kennt im Lebenszeitraum der meisten Bürgerinnen und Bürger keine Präzedenz. Selbst die vorangegangenen Schocks – der Terroranschlag vom 11. September 2001 oder der Zusammenbruch der internationalen Finanzmärkte in den Jahren 2008/2009 – hatten nicht die gleichen Breiten- und Tiefenwirkungen. Ihre Folgen waren für viele allenfalls mittelbar im Alltag spürbar. Die Konfrontation mit einem leicht übertragbaren und potenziell tödlichen Virus hingegen lässt sich auch im persönlichen Bewusstsein nicht so einfach zur Seite schieben.
Insofern dominierte sehr schnell das Gefühl, einer Gefahr gegenüberzustehen, die nicht zu den gewohnten Routinen passte und die insofern mit Alltagsintuition auch nicht verstehbar war. Auf einmal war sie da, die große, allumfassende Disruption, die wir seit vielen Jahren vor allem von technischen oder ökonomischen Umwälzungen erwartet hatten. Doch es waren weder digitale Technologien noch globale Vernetzung, die unsere Alltagsroutinen auf den Kopf stellten, sondern ein neuartiges Virus und unsere Versuche, mit dieser Bedrohung umzugehen.
Binnen weniger Tage haben die allermeisten Bürgerinnen und Bürger, wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Osteransprache anmerkte, wesentliche Aspekte ihres Lebens verändert. Die dem zugrunde liegende solidarische Kraft in unserer Gesellschaft ist bemerkenswert gewesen. Aber die alles umspannende Herausforderung hat keinesfalls dafür gesorgt, dass sich auch die jeweils spezifischen sozialen oder ökonomischen Umstände anglichen. Persönliche und berufliche Lebenssituationen prägen, wie es sich mit einem partiellen Shutdown umgehen lässt. Und natürlich sind die Auswirkungen der wirtschaftlichen Vollbremsung in einigen Branchen besser zu ertragen als in anderen, wie zum Beispiel den kulturellen und medialen Bereichen, die auf jene Vorstellung gesellschaftlicher Öffentlichkeit gegründet sind, die wir zur Bekämpfung der Virusverbreitung in dieser Zeit nicht zulassen durften.
Es stimmt also nur eingeschränkt, dass das Virus ein großer Gleichmacher ist. Es stellt eine Gesellschaft in ihrer ganzen unübersichtlichen Komplexität vor dieselbe Herausforderung. Aber es verändert damit weder die Verteilung der Ressourcen, die es braucht, um der Herausforderung zu begegnen, noch die jeweiligen, sehr unterschiedlich zu tragenden Lasten.
Deshalb ist die Frage des gesellschaftlichen Umgangs mit dieser Herausforderung so entscheidend. Auch der Bundespräsident hat darauf in seiner Ansprache verwiesen und die Wegscheide beschrieben, an der wir gesellschaftlich schon länger stehen: »Schon in der Krise zeigen sich die beiden Richtungen, die wir nehmen können. Entweder jeder für sich, Ellbogen raus, hamstern und die eigenen Schäfchen ins Trockene bringen? Oder bleibt das neu erwachte Engagement für den anderen, für die Gesellschaft? Bleibt die geradezu explodierende Kreativität und Hilfsbereitschaft? Bleiben wir mit dem älteren Nachbarn, dem wir beim Einkauf geholfen haben, in Kontakt? Schenken wir der Kassiererin und dem Paketboten auch weiterhin die Wertschätzung, die sie verdienen? Mehr noch: Erinnern wir uns auch nach der Krise noch, was unverzichtbare Arbeit – in der Pflege, in der Versorgung, in den sozialen Berufen, in Kitas und Schulen –, was sie uns wirklich wert sein muss? Und helfen die, die es wirtschaftlich gut durch die Krise schaffen, denen wieder auf die Beine, die besonders hart gefallen sind?«
Vielfach ist zu Recht die enorme gesellschaftliche Solidarität herausgestrichen worden, zu der wir als Gesellschaft fähig sein können. Es wird eine der entscheidenden Aufgaben für die Zukunft sein, dieses Bewusstsein dafür, dass wir aufeinander bezogen sind und aufeinander achtgeben müssen, zu bewahren. Solidarität ist nicht nur eine Strategie des Überlebens in der Krise, sondern die Grundlage des Gemeinsinns unserer Gesellschaft.
Die vielfache praktische Solidarität im Kleinen, mit der wir versuchten, wenigstens im nahen Umfeld die Kontrolle nicht zu verlieren, korrespondierte mit einer Einschränkung gesellschaftlicher und individueller Freiheiten, die lange Zeit kaum vorstellbar war. Das Ausmaß, in dem wir im Frühjahr 2020 unser gewohntes Leben beschränken mussten, ist für eine moderne Demokratie eigentlich unvorstellbar. Doch weitgehend problemlos wurden Anordnungen und Verfügungen akzeptiert, die wir noch vor kurzem als gezielte Anschläge auf unsere freiheitliche Gesellschaft verurteilt hätten. Dass diese Akzeptanz möglich war, lag an der tiefgreifenden und alles andere überlagernden Angst vor den dramatischen Folgen des Coronavirus.
In der Öffentlichkeit hat die notwendige Aufklärung über die Situation und das in ihr angemessene Handeln bereits vorhandene Sorgen noch verstärkt. Die Dringlichkeit dieser Kommunikation hat mit dazu beigetragen, dass kritische Stimmen zu Beginn der öffentlichen Einschränkungen kaum zu vernehmen waren. Als Signal der Bedrohung begründeten sich die Einschränkungen quasi wie von selbst. Der Leiter der Abteilung Systemimmunologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig, Michael Meyer-Hermann, hatte am 8. April 2020 in einer Pressemeldung seines Zentrums auf diesen Zusammenhang hingewiesen: »Wir brauchten die offiziell verordneten Einschränkungen, um die Aufmerksamkeit der Menschen auf die Gefahr durch die Epidemie zu lenken.« Das heißt, neben der unmittelbaren epidemiologischen Funktion sollten die Einschränkungen des öffentlichen Lebens offensichtlich auch pädagogisch wirken. Weil sie so drastisch waren, dass ihnen niemand entgehen konnte, haben sie nicht nur eine unmittelbare Wirkung entfaltet, sondern verdeutlichten darüber hinaus auch die nötige Dringlichkeit.
Ob allein durch das Virus oder auch durch die gesellschaftliche Reaktion auf seine Ausbreitung – bei vielen sitzt der Schock, dass die Unangreifbarkeit der eigenen Existenz durch ein neues Virus so leicht zu erschüttern ist, bis heute tief. Die narzisstische Kränkung, eben doch verletzlich zu sein, schmerzt. Das Coronavirus hat uns vor Augen geführt, wie fragil unser Leben ist.
An Bilder von Leid und Schrecken irgendwo auf der Welt haben wir uns gewöhnt, ebenso an die lakonisch-fatalistische Feststellung, dass es in der Regel menschengemachte Kriege oder Katastrophen sind, die dieses Leid verursachen und die nicht nötig wären, wenn nur alle so vernünftig wären, wie wir selbst. Wir sind zu Weltmeistern der Verdrängung unserer eigenen Verantwortung für die globalen Verwerfungen geworden, die diesen humanen Katastrophen oftmals zugrunde liegen. Wir wollen die strukturellen Gründe globaler Ungleichheit nicht erkennen, sondern appellieren lieber moralisch und entlasten unser Gewissen mit kleinen Spenden zur Weihnachtszeit.
Doch die Bilder aus den Epizentren der Pandemie waren anders. Das schreckliche Sterben in Italien, Spanien oder den USA forderte nicht nur unser Mitgefühl, sondern ließ auch in einer ungekannten Unmittelbarkeit die bange Frage aufsteigen, ob auch wir vor einer solchen Entwicklung stehen und ob auch in Deutschland Ärzte auf den Intensivstationen entscheiden müssen, wem sie die lebensrettende maschinelle Unterstützung zukommen lassen können und wem nicht. Die Geschichten ließen uns erkennen, wie wenig wir unser eigenes Überleben in der Hand haben, wenn wir nicht bereits langfristig vorgesorgt und Hilfskapazitäten geschaffen haben.
In solchen Momenten wird Angst zu einem bestimmenden Aspekt der öffentlichen und auch der privaten Meinungsbildung. Die Bilder und Erzählungen aus den am schlimmsten betroffenen Regionen Europas ließen sich nicht einfach beiseitedrängen. Sie waren allgegenwärtig, und sie wurden vor allem in den sozialen Medien noch zugespitzt durch die Mutmaßungen und Spekulationen all jener Hobby-Virologen, die in den Tagen und Wochen zuvor ihren Abschluss im Fernstudium an der weltweiten Google-Universität gemacht hatten und sich nun berufen fühlten, komplexe wissenschaftliche Studien zu lesen und zu interpretieren.
Gerade in Krisen kristallisiert sich der Wunsch nach belastbarem wissenschaftlichem Wissen als eines der zentralen gesellschaftlichen Bedürfnisse heraus. Den Virologen und Epidemiologen wurde besonders in den ersten Monaten der Pandemie zugetraut, das Orientierungswissen zu liefern, das die bleierne Ungewissheit über die Zukunft beseitigen sollte. Mediziner wie Christian Drosten, der Leiter der Virologie an der Berliner Universitätsklinik Charité, avancierten über Nacht zu Medienstars und gefragten Interviewpartnern, weil sie das vermeintlich Unerklärliche in Worte fassen und begreifbar machen konnten.
Allerdings erging es ihnen wie den meisten Wissenschaftlern, die mit ihren fachlichen Positionen ins grelle Licht der Öffentlichkeit geraten. Sie unterschätzten die Eigenlogik medialer Berichterstattung: Vorsichtige Hypothesen verfestigen sich unter ihrem Einfluss zu faktischen Aussagen, methodische Dispute werden zu fundamentalen Wertungsunterschieden, und freies Räsonieren über unterschiedliche Betrachtungsweisen führt zu allgemeiner Verunsicherung. Vor allem aber: Der Glaube an eine wissenschaftlich abgesicherte Eindeutigkeit der Erkenntnis muss enttäuscht werden.
Die Diskussion wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Öffentlichkeit birgt zwei Gefahren: Entweder werden die Aussagen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für bare Münze genommen, obwohl es sich in der Regel zunächst um Hypothesen handelt, die auf schmaler Datenbasis generiert wurden und der breiteren empirischen Überprüfung bedürfen. Oder aber sie werden, angesichts der methodischen Vorsichtshinweise, gleich von vornherein derart relativiert, dass sie als wenig hilfreich beiseitegelegt werden.
Egal welcher Mechanismus greift – der Wunsch nach der einen, Sicherheit verbreitenden, Erkenntnis bleibt unerfüllt. Dabei sind die Widersprüche zwischen den verschiedenen Annahmen der Experten notwendige Zwischenschritte im Prozess der Erkenntnis. Aber sie brechen sich an dem gesellschaftlichen Bedürfnis nach eindeutigen Antworten in einer Zeit voller Fragen. Für den fachlichen Laien ist diese Unsicherheit wissenschaftlichen Wissens schwer auszuhalten.
Auch wenn es bisweilen den Anschein hatte: Wissenschaftliche Beratung kann gesellschaftlichen Diskurs und politische Willensbildung nicht ersetzen. Eigentlich ist seit den großen Auseinandersetzungen zwischen Sozial-, Geistes- und Naturwissenschaften in den sechziger und siebziger Jahren klar: Es gibt kein aus sich selbst heraus wahres oder richtiges Wissen. Es gibt lediglich noch nicht widerlegte Annahmen oder gemeinschaftlich als wahr unterstellte Überlegungen. Doch augenscheinlich ist auch in der Politik der Wunsch nach einem als wahr zu unterstellendem Wissen immer noch so groß, dass die Selbstbeschränkung auf eine Wahrnehmung der Studien als eine mögliche Interpretation der Wirklichkeit nach wie vor schwerfällt. Und manches Medium will dazu anscheinend gleich gar nicht in der Lage sein, wie die Auseinandersetzung der Bild-Zeitung mit der Vorabversion einer noch nicht abgeschlossenen Studie von Christian Drosten im Mai verdeutlicht hat.
Das mangelnde Verständnis für wissenschaftliches Arbeiten führt dazu, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Widersprüchlichkeit oder Zerstrittenheit unterstellt werden, wo es doch bloß um den üblichen und notwendigen Disput zwischen verschiedenen Ansichten ein und desselben Faches geht. Auch diese im Verlauf der Krise wachsende Ernüchterung über die Prognosefähigkeit der medizinischen Wissenschaft hat zum Gefühl eines weitreichenden Kontrollverlustes beigetragen. Wenn selbst die Ärztinnen und Ärzte, denen man die Gestaltung der Geschicke unserer Gesellschaft in dieser Ausnahmesituation noch zugetraut hatte, zugeben müssen, dass sie auch nur Modelle und Annahmen liefern können, dann mindern sie weder Unsicherheiten noch Zukunftsängste.
Ihr Diskurs führt vielmehr vor Augen, dass sich selbst im Angesicht einer Katastrophe, die alle Differenzierungen unseres Wissens einebnet, die eine Perspektive menschlicher Erkenntnis als Antwort darauf nicht herauskristallisieren wird. Vielmehr braucht es die Vielfalt unseres Wissens und unserer jeweiligen Perspektiven, um dieser fundamentalen Herausforderung Herr zu werden.
Leider ist das Bewusstsein für diese Anstrengung bis heute nicht so weitreichend ausgeprägt, wie es sinnvoll wäre. Nicht wenige haben zum Höhepunkt der Infektionswelle darauf beharrt, dass es aufgrund der Unmittelbarkeit der Krise eine dominante Perspektive geben müsse und dass der Diskurs und das ruhige Abwägen unterschiedlicher Interessen und Positionen der Dynamik der Lage nicht gerecht werden könnten.
Als es unmittelbar und direkt ums eigene Überleben ging, schienen nicht wenige bereit zu sein, auf liebgewonnene und notwendige Freiheiten weitgehend umstandslos zu verzichten und sich dem vermeintlich Alternativlosen zu beugen – und zwar unabhängig davon, ob diese alternativlos richtige Antwort überhaupt formuliert werden konnte. Umgekehrt konnten wir diese Eindimensionalität auch erleben, als es um die Konzepte zur Wiederöffnung des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens ging.
Die Aufgeklärtheit unserer Demokratie wird sich daher in Zukunft auch im politischen Umgang mit den Ängsten vor dem Verlust der Kontrolle über das eigene Leben und dem daraus folgenden Streben nach Eindeutigkeit beweisen müssen.