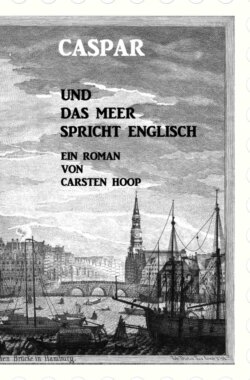Читать книгу Caspar rund das Meer spricht Englisch - Carsten Hoop - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Prolog / Kapriolen der Nacht
ОглавлениеSie verfolgten uns auf dem verblockten Fluss, der schon alleine ohne ihre mörderischen Absichten ein riskantes Unterfangen für mich darstellte. Mit geübten Paddelschlägen kamen ihre Kanus immer näher. Jean Baptist, der Kundschafter, den man sonst nie hörte, schrie nun aus seinem Baumrindenboot: „Genau dort gehen wir an Land!“ Er wies uns unmissverständlich den Weg. Plötzlich zerfetzte die bleihaltige Fracht des Feindes die Schulter von Jean-Claude Aimauld, der durch die enorme Wucht des Geschosses kopfüber in das Kanu fiel und sich fortan nicht mehr rührte. Wen würde es als Nächsten erwischen? Für Hilfe und irgendwelche Regungen blieb keine Zeit. Wir mussten seinen Tod einfach hinnehmen. Als ob die Tat uns nicht bekümmerte, als ob Jean-Claudes Ableben uns überhaupt nicht interessierte, paddelten wir das letzte Stück verbissen weiter, ohne nach links oder rechts zu gucken. Mit großer Mühe und letzter Kraft erreichten wir ein kurzes Stück landungstauglichen Ufers, auf das die Boote rutschten. Es ging ums nackte Überleben. Eilig verließen wir das Vorland. Die Verfolger saßen uns im Nacken. Ich ließ notgedrungen den 1. Offizier unseres Walfängers Konstanze im Kanu liegen, ohne zu wissen, ob er nur verletzt oder bereits tot war. Den Matrosen Peter hatten wir bereits unterwegs auf dem Fluss verloren, nachdem ihn eine Kugel getroffen hatte und sein halber Kopf zerbarst und in alle Richtungen verstreut wurde. Hinter mir brüllte Simon, denn sie waren schon da, bis ihn eine große Kugelkeule zum Schweigen brachte. Ich drehte mich um und zog meine Handfeuerwaffe, die ich mir im geladenen Zustand eigentlich bis zu meinem Ende aufbewahren wollte. Der völlig rot bemalte Indianer, der seine Kriegslust durch die kahl geschorenen Seiten des Kopfes unterstrich, hatte seinen vorsintflutlichen Totschläger – die Kugelkeule – zum letzten Mal geschwungen. Glücklicherweise erwischte ich ihn und er sah bis zuletzt zu dem kleinen Springbrunnen auf seiner Brust, den mein Schuss verursacht hatte. Schließlich brach er mit klagendem Geheul zusammen. Mir lief ein kurzer feuriger Schauer bei seinem Anblick über den Rücken. Dabei war es für die Irokesen ein durchaus ehrenvoller Tod, im Kampf zu sterben. Nicht viel anders als der ehrenvolle Tod auf dem Feld für das Mitglied eines europäischen Offizierskorps. Seine Familie wird stolz auf ihn sein. Aber zum Teufel mit ihm – armer Simon, du hast ein solches Ende nicht verdient!
Unser Expeditionsleiter Capitaine Maurice Martier hatte seinen gleichrangigen Freund der französischen Armee, Jean-Claude Aimauld, ebenfalls am Fluss liegen lassen müssen. Die Pfeile der Irokesen rauschten immer dichter an unseren Köpfen vorbei, nachdem sie ihre veralteten Flinten abgeschossen hatten und nun ihre bewährten Waffen bemühten, die nicht mit Pulver und Blei nachgeladen werden mussten. Sie kamen nun mit allerlei Kriegsgeschrei immer näher. Die schwirrenden Geräusche der kunstvoll gefertigten Geschosse lösten noch nie da gewesene Panikattacken in mir aus. Meine Beine wollten nicht mehr und die Atemluft wurde knapp. Die Angst verwandelte sich plötzlich in schäumende Wut, die meinen Antrieb neuerlich beflügelte. Es wäre geradezu sinnlos, hier in der Wildnis einfach so zu sterben! Derweil schwor ich mir inständig, mein Schweiß sollte die einzige Flüssigkeit bleiben, die an diesem Tage an mir hinabrann.
Wir waren mitten in Amerika auf dem Alleghenyfluss in einen Hinterhalt geraten und sahen uns einer gewaltigen Übermacht der britischen Verbündeten, den Irokesen, ausgesetzt. Die Briten selbst zeigten sich heute nicht mit ihren grellen Rotröcken, quakenden Dudelsäcken, großen bunten Bannern und durchdringenden Trommeln. Meine Wegbegleiter verloren sich in der grünen Hölle des allgegenwärtigen Buschwerks. Lediglich unser Waffenmeister Hannes und Strandläufer, der Micmac-Kundschafter, wusste ich neben den Verfolgern in meiner Nähe. Sie griffen im letzten Moment die zusätzlichen Waffen aus unserem Reisegepäck und kamen zuletzt auf der Kuppe des armseligen Hügels an, der nach dem Willen des Kundschafters unsere Trutzburg werden sollte. Enttäuscht schauten die beiden Maurice und mich an, als sie uns von entschlossenen Indianern umstellt sahen. Sofort verschnürten die Irokesen uns, wie es die Spinne im Netz mit ihrer Beute machte. Noch bevor wir begriffen, dass es besser gewesen wäre, im Kampf zu sterben, als ihnen lebend in die Hände zu fallen. Ein muskulöser stämmiger Krieger schrie mich an, als ob ich wie ein frecher Lausbub etwas ausgefressen hätte. Ein Schweißausbruch jagte den nächsten. Ein kleiner dicklicher Krieger machte uns mit bösem Blick unmissverständlich deutlich, dass er eine Unterhaltung zwischen uns nicht duldete. Sein Gewehrkolben streifte prompt meine Wange. Ein anderer mit grell bemaltem kahlen Schädel und einem letzten Haarbüschel, das mit blau gefärbten Vogelfedern verfeinert war, ritzte mit seinem Messer langsam die Kopfhaut von Maurice vor dem Haaransatz der Stirn auf. Der machte darauf keinen Piep. Der Gelbkahlkopf zeigte uns eindrucksvoll, wie die Irokesen mit ihren Feinden umzugehen pflegten und an welchem Gürtel Maurices Skalp bald hängen sollte. Am Fluss fielen jetzt nochmals Schüsse. Zuerst dachte ich, dass Hilfe naht. Doch wahrscheinlicher war, dass unsere verletzten Weggefährten den Gnadenschuss erhielten. Oder konnten sie vielleicht fliehen? Danach blieb es dort ruhig, während wir auf den Abtransport warteten. Wohin wird es jetzt gehen? Unsere Zukunft schien von kurzer Dauer und fragwürdiger Qualität zu sein.
Die Situation ließ nur einen flüchtigen Gedanken zu. Einen seidenen Hoffnungsschimmer, den ich nun zumindest konkret auszudrücken vermochte. Vielleicht konnte einer unserer Leute fliehen und der übrigen Welt von unserem Schicksal berichten. Das wäre eine Genugtuung. Wenn zumindest Lisa von mir hören würde. Lieber diese Geschichte als gar nichts hören und sein Leben im Ungewissen weiter leben. Wie schrecklich wäre das für die Familie. Was war aus Louis Garant, dem zweiten Kundschafter unserer Expedition geworden? Er kannte sich doch in dieser Wildnis aus und war im Grunde solcher misslichen Lage gewachsen! Es musste einfach irgendjemand entkommen sein. Ich betete insgeheim, wie meine Lisa es tat, wenn etwas schief lief, und dachte eine Zeit lang an nichts anderes mehr. Denn, daran bestand kein Zweifel mehr, Maurice, Strandläufer, Hannes und ich – wir waren so gut wie tot.
Keiner von uns sah noch einmal den Fluss oder erfuhr etwas von den anderen. Strandläufer, der von unseren französischen Kundschaftern als zusätzlicher Fährtenleser angeheuert worden war, versuchte auf die verzierten Halbnackten einzureden, deren Gesäße lediglich mit Hirschhäuten und Wampungürtel bedeckt waren. Ein dumpfer Schlag beendete seinen Vermittlungsversuch. Dabei war er der Einzige, der sich mit den Irokesen verständigen konnte. So wie sich Indianer untereinander immer verstanden, ohne unbedingt gleichen Sprachfamilien anzugehören. Hannes fluchte fürchterlich, wie es seine Art war, wenn ihm die Worte fehlten. Mit verbundenen Augen trieben sie uns wie Vieh in einem Gewaltmarsch durch den tiefen Wald. Wer nicht parierte, spürte die mit Knoten versehenen Lederriemen der Peiniger. Doch keiner gab ohne weiteres auf. Jeder hing an dem bisschen Leben, das ihm noch blieb, und hoffte irgendwie, dass ein womöglich günstiger Verlauf der Geschehnisse unsere Aussichten verbesserte. Bald war das Rauschen des Flusses nicht mehr zu hören und eine unheimliche Stille breitete sich aus, gepaart mit der Dunkelheit der verdeckten Augen, die nur vom Peitschen der Lederriemen unterbrochen wurde. Ich spürte meine Füße nicht mehr und versuchte, den Gehrhythmus im Takt beizubehalten. Immer wieder stolperte einer von uns über Baumwurzeln oder Felsbrocken und riss den Rest der verknoteten Truppe zu Boden, sodass mein Bestreben immer wieder scheitern musste. Dann fuhren wir mit plump gebauten Kanus aus Ulmenrinden über einen See, der zu den Größeren seiner Art zählte. In der Nacht erreichten wir die Langhaussiedlung der Irokesen. Erst in einem der praktischen Häuser aus Baumrinde, die aus wiederverwendbaren Pfahlgerüsten konstruiert waren, gaben sie uns die Orientierung zurück, nachdem wir an kleinen Pfählen im Langhaus angebunden worden waren. Wir hatten einen geheimen Ort erreicht, wie Strandläufer uns – immer noch benommen von seinem Strafhieb – zuflüsterte. Er hatte von dem heftigen Schlag eine große Beule am Kopf davongetragen. Ich erstarrte vor Schreck, als mein Blick auf Maurice Martier fiel. Der französische Capitaine hatte sich eine klaffende Wunde an der Stirn zugezogen. Scheinbar hatte der Indianer den Schnitt vorhin nicht nur angedeutet, sondern bereits angefangen, ihn zu skalpieren. Das Blut floss in seine Augenhöhlen, über seine Nase und die Wangen entlang. Er zeigte keine weitere Regung und war wohl am Rande der Bewusstlosigkeit. Wie schaffte er nur diesen Gewaltmarsch? „Strandläufer, wo sind wir?“, fragte ich den Fährtenleser leise, als die Möglichkeit dazu bestand. „Wir sind mindestens sechs Stunden gelaufen – vom Fluss weg nach Süden und über den See. In der Zeit schafft man in unserem Zustand zwanzig Kilometer zu Fuß und mit dem Kanu vielleicht nochmals zehn Kilometer.“ Ihn strengte selbst das Sprechen an. „Woher weißt du, dass wir nach Süden gelaufen sind?“, fragte Hannes in unbedachter Marktschreier Manier. Schon kam ein wachsamer Krieger vom Eingang des Langhauses mit bösem Blick auf uns zu. Kompromisslos schlug er Hannes mit einem Stock mitten ins Gesicht. Mit vor Schmerz verzerrtem Gesicht fluchte dieser kurz in seinen ergrauten Bart und spukte zwei Zähne aus, während der Schläger mit grinsendem Gesicht das Ergebnis seiner Tat betrachtete. Doch Hannes harrte aus, schaute dem Schläger unverhohlen in die Augen und zeigte – so gut er konnte – keine Reaktion, bis der Wachposten zum Eingang des großen Hauses zurückging. Er hatte sich wie ein tapferer Indianer verhalten. „Das waren meine wichtigsten Zähne!“, grummelte er wohlwissend, dass dieser Verlust vermeidbar gewesen wäre.
„Der Moosbewuchs im Wald ist zum Norden hin am stärksten. Du musst nur Felsen und Bäume abtasten. Selbst im Europa der Weißen müsste das so sein!“, antwortete Strandläufer leise. Drei Squaws kamen in das riesige Haus, das mindestens dreißig Meter Länge aufwies und fünf Familien Platz bot. Die Frauen gaben hier scheinbar den Ton an. Sie begutachteten uns, indem sie uns wie Pferde vor dem Verkauf musterten. Maurice sahen sie sogar in den Mund. Immerhin wuschen sie nebenbei sein Blut verschmiertes Gesicht, sodass er wieder etwas sehen konnte und eine dringend notwendige Wiederbelebung durch das kalte Wasser der Squaws erfuhr. „Was willst du, alte Schachtel!“, pöbelte Hannes, immer noch giftig, nachdem er zusätzlich einen kräftigen Kniff in seinen Allerwertesten hinnehmen musste. Er spukte ihnen das Blut vor die Füße, dass seine frischen Zahnlücken hergaben. Doch sie bemerkten es nicht, sondern redeten ununterbrochen aufeinander ein und schienen nach wie vor uneins zu sein.
„Sie suchen Ersatz für ihre gefallenen Söhne“, flüsterte Strandläufer.
„Du machst in dieser Situation Witze?“, fragte ich empört.
„Nein, nein. Sie verhalten sich völlig normal – wie Indianer eben!“ Ungläubig schaute ich zu Maurice, der es als langjähriger Frontsoldat wissen musste. Er nickte kurz und schien seinen Blutverlust verkraftet zu haben. Einen Spaß machte der Capitaine in seiner Lage sicher nicht. Dafür jedoch der schlitzäugige Fährtenleser, der mich mit seinem breitbackigem Grinsen an die Inuit auf Grönland erinnerte.
„Keine Sorge, Caspar, einen bebrillten Hering nehmen sie nicht. Du bist ihnen zu unheimlich! Hannes ist zu alt und mich, einen feindlichen Micmac, sehen sie lieber morgen garen – auf dem Feuerrost!“ Bei seinem Galgenhumor drehte sich mein Magen endgültig um. Kompromisslos entleerte er sich und besudelte die Frauen mit dem bitteren Nass meiner Innereien, woraufhin sie schreiend zum Eingang des Langhauses liefen. Womöglich hatte ich nun Maurices Leben auf dem Gewissen, der für eine Adoption bei einer der Squaws infrage kam, wenn Strandläufer die Zeichen richtig gedeutet hatte.
„Keine Sorge, Caspar. Ich komm darüber hinweg“, antwortete der französische Capitaine aus Quebec, ohne gefragt worden zu sein. Er funktionierte wieder wie früher. Sein blutendes Gesicht sah schlimmer aus, als es war. Stillschweigend machte sich jeder von uns Gedanken, was unseren Weggefährten widerfahren sein mochte. Die Wahrheit wollte keiner aussprechen, weil wir die Wirklichkeit verdrängten, so gut wir konnten.
Sie gaben uns gut zu essen und bald merkten wir, warum sie dies taten. Die Irokesen berauschten uns mit einem Betäubungsmittel, das der Nahrung beigemischt wurde und uns willenlos machte, aber immerhin die Auffassungsgabe nicht einschränkte. Das kleine Fest der Indianer am folgenden Tag sollte möglichst ohne Störung verlaufen. Maurice hatten sie tatsächlich in der Nacht fortgeschafft. Nun machte keiner von uns mehr kleine Witze. Strandläufer kannte sich gut aus, obwohl seine Heimat an der Mündung des Sankt Lorenz ziemlich weit weg lag, und er mit dem Volk der Irokesen bis zu seinem Dienstantritt bei den Franzosen nichts zu tun gehabt hatte.
Das anfangs beschauliche Dorf nahm im Laufe des Tages gewaltig zu, denn immer mehr indianische Besucher wurden mit Kanus über den See hierher gebracht. Sie ließen sich am Festplatz nieder und widmeten sich den Trommlern und Tänzern, die in der Intensität ihrer Darbietungen immer noch steigerungsfähig schienen. Große Berge von Essbarem wurden herangeschafft und Wild, Geflügel und Fisch an großen Feuerstellen zubereitet. Kürbisse, Bohnen und vor allem Mais ernteten die Irokesen auf naheliegenden, eigenen Feldern, die sie dem Wald abtrotzten. Der Ort glich schließlich einer riesigen Bratküche. Und dann wurden die Logen besetzt …
Ein wenig abseits vom Tanzplatz und den rings umliegenden Häusern begrenzten stämmige Eichen den dahinter liegenden Mischwald, soweit ich dies vor lauter Qualm sehen konnte. Nachdem wir an den besagten Eichenstämmen gefesselt waren, ließen die Indianer uns zunächst in Ruhe. Sogar eine leise Unterhaltung war möglich. Die Indianer hatten sich an diesem abseits gelegenen Ort auf eine längere Zeit des Verweilens eingerichtet. Strandläufer bestätigte meinen Eindruck. Die Roten hatten ihren ganzen Krempel einschließlich einer großen Kinderschar dabei. Es soll sich bei unseren Gastgebern um die Seneca-Nation handeln, die die westlichsten Siedlungsgebiete des mächtigen Irokesenbundes beanspruchten, die wir beim Befahren des Allegheny tangiert hatten. Strandläufer glaubte des Weiteren zu wissen, dass dieser Ort nur von der Seeseite erreichbar war und ansonsten dank eines Gebirgszugs mit steilen Klippen fernab der Handelswege äußerst geschützt lag. Das erklärte, warum die sonst üblichen Palisaden als Schutzwall fehlten. Da fiel es den Irokesen nicht schwer, sich hier sicher zu fühlen – was wir von uns nicht sagen konnten.
Zu unserer Überraschung wurden noch drei weitere Gefangene direkt neben uns angebunden. Es handelte sich um zwei Franzosen in Zivil und einen Indianer, der ein paar Brocken Algonkin sprach, wenn er mit seinem Französisch nicht weiterkam. Sofort versuchten wir, Informationen auszutauschen. Doch sie standen leider zu weit von uns weg.
Alsdann wurde es im Dorf ruhiger und die Trommeln schwiegen für eine Weile. Bald konnten wir die Bewohner und ihre Gäste nicht mehr sehen. Offenbar machten sie sich für das eigentliche Fest in ihren Behausungen zurecht. Selbst die Kinder, die uns mit ihren neugierigen Blicken durchlöchert hatten, waren plötzlich verschwunden. Noch einmal überlegte ich, ob es noch irgendeine Chance gab, unser Leben zu retten. Hilfe von außen war nicht zu erwarten. Wir wussten also, dass wir diese Expedition bis zum Ende auf uns allein gestellt durchstehen mussten.
Ich dachte an Lisa und an meine Familie. Lisa würde ich nun nie wiedersehen dürfen. Ihre schönen grünen Augen, in denen ich so gern pausenlos versank und alles andere dabei vergaß. Das vertraute Lächeln, das mir, Jahr ein - Jahr aus, so selbstverständlich gewesen war. Und ihre hochgesteckten dunkelblonden Haare, die manchmal eine unbändige Locke freigaben, die dann im leichten Wind tanzte und meinem Spott ausgesetzt war, obwohl eigentlich eine Liebeserklärung gemeint war. Meine geliebte Heimatstadt und den Duft der Elbe, der beim Atmen jedes Mal eine Gänsehaut auslöste, wenn ich elbaufwärts zurück nach Hamburg in den Hafen kam. Nun sollten wir eine Martertortur durchstehen, der wir Europäer sicher noch weniger gewachsen waren, als die Einheimischen. Mit Schmerzen und Erniedrigungen über eine lange Zeit brachen die Indianer ihren Gefangenen den Willen. Einen indianischen Willen, der für Weiße außerhalb der kulturellen und physischen Reichweite lag. Die Europäer allerdings, waren ihrerseits nicht minderbegabt, ihre Mitmenschen mit Verfehlungen europäischer Machart zu quälen. Somit müssen wir unser empörtes Entsetzen über ebenjene Praktiken in Grenzen halten, wenn wir mit unseren Fingern auf die Grausamkeiten anderer Kulturkreise zeigen. So zumindest nach meinem Empfinden und meinem Rechtsverständnis. Grausamkeit wird nicht besser, wenn die Gesellschaft sie reguliert. Verzweifelt und resigniert stellte ich fest, keine Fluchtmöglichkeit zu sehen.
Bald darauf erwachte das Dorf zu seiner ursprünglichen quirligen Lebendigkeit. Die Feuer wurden größer, die Menschen geschäftiger. Kinder rannten zwischen den Langhäusern hin und her und spielten mit kleinen Bällen, die sie mit Holzschlägern fortschlugen. Der Strom der voll besetzten Kanus auf dem See, die immer neue Clans zum Festplatz brachten, ebbte ab. Die Trommeln wurden immer intensiver geschlagen. Im Rhythmus gesellten sich bunt geschmückte und bemalte Tänzer dazu, die mit Rasseln, Flöten und mir fremden Instrumenten das Konzert verfeinerten und die Freifläche des Dorfes rasant füllten. Nun setzte auch mehrstimmiger Gesang ein, der in meinen Ohren wie Schmerzlaute klang. Auch in der Nähe der Eichen loderten jetzt große Feuer. Eine Gruppe junger Krieger mit Pfeilen und Bögen baute sich vor uns auf, geführt von Älteren mit vielen Federn im Haar, während eine große Schar neugieriger Unbeteiligter jeden Alters und Geschlechts gaffte. Vergleichbar wohl mit heimischen Hinrichtungen, die auf den Marktplätzen in den Städten stattfanden. Nun begann das große Schauspiel: Der Reihe nach schossen sie auf uns. Zunächst kam es wohl darauf an, die Pfeile möglichst dicht neben den angebundenen Körpern zu platzieren. Strandläufer traf es am Unterarm. Er verzog nach indianischer Sitte nicht einmal die Mundwinkel, musste aber Höllenqualen erlitten haben. Kinder kicherten, Squaws lachten und die Krieger stießen Schreie aus, die alleine schon Angst machten, ohne dass man ihnen als Zielscheibe ausgeliefert sein musste. Mein Herz pochte laut. Nun war ich an der Reihe, während Strandläufer von den hübschesten Squaws mit Wasser und Maiskuchen versorgt wurde. Dann schoss der erste Kandidat auf mich und zog mir einen neuen Scheitel. Der Pfeil streifte die Kopfhaut und der Schütze wurde umjubelt. Mir blieb ein Missgeschick des Schützen erspart, sodass ich unverletzt die nächste Runde erreichte. Auch ich wurde nach Irokesenart verwöhnt, indem die jungen Frauen mit Stärkungen zu mir kamen. Doch diesmal war eine Weiße dabei, deren Umrisse im flackernden Licht der großen Feuer nicht gleich erkennbar waren. Man hatte mir wenigstens die Brille gelassen, was mir anfangs als Nachteil erschien. Ich hatte gehört, dass Irokesen auch Weiße in ihre Stämme integrierten. War diese Frau eine von denen, die vielleicht zuvor ein ganz normales Leben in einer gewöhnlichen Stadt Neufrankreichs geführt und viele Kinder und einen treuen Ehemann ihr Eigen genannt hatte? Sie kam näher und schaute mir nur Bruchteile einer Sekunde in die Augen. Nein, das konnte doch nicht wahr sein. Das konnte ich nicht glauben! Dieses Lächeln und die grünen Augen, die unvergleichlich waren? Nun stand sie allein vor mir. Ich sah nur noch in ihr Gesicht. Ihre funkelnden Augen leuchteten mich im Feuerschein an. Das dunkelblonde Haar wehte ihren Lavendelduft im leichten Wind zu mir herüber. Ihr Lächeln jagte mir einen eiskalten Schauer über den schmerzenden Rücken. Dann sagte sie völlig ruhig, wie bei einem Sonntagspaziergang auf dem Stadtwall: „Ich wusste gar nicht, dass du auch eingeladen bist!“
Es war Lisa! Meine Lisa! – Das konnte doch gar nicht sein!
Ich versuchte, mich von meinen Fesseln zu befreien. Ich zappelte und zappelte, bis … ich schließlich aus dem Bett fiel!
Lisa zündete in aller Ruhe eine Kerze an, die immer griffbereit auf ihrem Nachttisch stand, eine von den Mehrfarbigen, die sie regelmäßig zum Geburtstag von Konstanze und Hinrich bekam.
„Komm zurück ins Bett. Du hast wieder einmal geträumt!“
Es war eine der traumatisierten Nächte, die mich seit meiner Amerikareise heimsuchten und quälten. Ich konnte den grausam erlebten Krieg, der zwischen den französischen und britischen Kolonien während meiner Amerikaquerung 1755 getobt hatte, nicht vergessen. Immer wieder sah ich die bestialisch zugerichteten Leichen, so als wäre ich gestern noch in Amerika gewesen. Ganz anders war es hier zu leben, zu lieben und zu arbeiten – in einer relativ friedlichen Welt mit einigermaßen geordneten Verhältnissen. So ganz ohne Einschränkungen ging es zwar auch nicht! Aber es war ein anderes Milieu, das in einem höhere Bedürfnisse weckte, die mit den nackten Existenzkämpfen im Indianerland, die den Menschenseelen auf Dauer nur schaden konnten, nicht das Mindeste zu tun hatten. Doch ich bereute fast nie, damals mit einer Handvoll Männer diesen Weg entlang des Grenzlandes gegangen zu sein, anstatt einer langwierigen Überwinterung in Quebec entgegenzusehen, die die Mehrheit der Mannschaft des Walfängers Konstanze bevorzugt hatte. Nach dem Löschen der Ladung war die Mannschaft ungebunden gewesen und hatte über ihren Verbleib selbst bestimmen können. Doch die Konstanze war in den Kolonialkrieg hineingerutscht. Der Kapitän und ich, wir wollten nicht über das Schicksal der Mannschaft bestimmen, weil unsere Reise einen anderen Verlauf nahm, als bei der Schließung der Heuerverträge vorhersehbar wurde.
Lisa wartete damals auf mich, denn unsere Verlobungsfeier war fest verabredet, und ich wusste, wie sehr sie den Tag meiner Rückkehr herbeisehnte. Doch zu diesem Zeitpunkt befand ich mich Hunderte Seemeilen von Lisa und meiner Heimat entfernt.