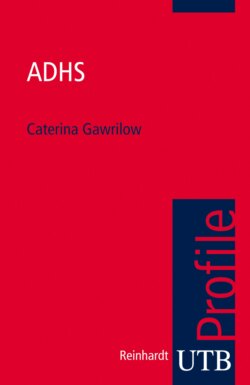Читать книгу ADHS - Caterina Gawrilow - Страница 7
ОглавлениеEinführung
„Ob der Philipp heute still wohl bei Tische sitzen will?“, heißt es in der berühmten Geschichte „Der Zappelphilipp“ (Hoffmann 1845 / 46).
Schon immer und in allen Kulturen stellen sich Eltern hyperaktiver Kinder Fragen dieser Art, und bereits seit über hundert Jahren beschreiben europäische Kinderärzte Kinder mit ADHS-ähnlichen Symptomen (Still 1920). In den 1970er bzw. 1980er Jahren hat die ADHS unter dem Namen Hyperkinetisches Syndrom der Kindheit bzw. Aufmerksamkeitsdefizitstörung Eingang in die gängigen Diagnosemanuale → ICD (Internationales Klassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation ICD-8 1974) und → DSM (Diagnostisches und Statistisches Handbuch Psychischer Störungen DSM-III 1980) gefunden. Seit den 1990er Jahren wird die Störung als Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bezeichnet und gilt als eine der häufigsten Störungen des Kindes- und Jugendalters (DSM-IV 1994; ICD-10 1990). Die drei Kernsymptome der ADHS sind:
• Unaufmerksamkeit,
• Hyperaktivität,
• Impulsivität.
Kinder mit ADHS haben demzufolge Probleme sich eine längere Zeit auf nur eine Aufgabe zu konzentrieren, sind leicht durch Reize aus der Umgebung ablenkbar und träumen häufig (Unaufmerksamkeit). Zudem sind sie motorisch überaktiv, zappeln viel, rennen und hüpfen mehr als Kinder ohne ADHS (Hyperaktivität). Kinder mit ADHS können auch häufig nicht abwarten und entscheiden oftmals, ohne über die Konsequenzen nachzudenken (Impulsivität).
Weiterhin zeigen die Betroffenen Schwierigkeiten bei Aufgaben, die → exekutive Funktionen verlangen. Zu exekutiven Funktionen gehören Kontrollmechanismen wie beispielsweise: Planen, Organisation von Arbeitsabläufen, flexibler Aufgabenwechsel oder auch Selbstregulation (d.h. die Fähigkeit, sein eigenes Handeln, Denken und Fühlen zu kontrollieren und zu beeinflussen).
Diese Probleme (Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität, Impulsivität und Defizite in den exekutiven Funktionen) führen oft zu weitgreifenden Schwierigkeiten im Umgang mit Familienmitgliedern oder Gleichaltrigen 8und im Unterricht. Kinder mit ADHS haben demzufolge häufiger Interaktionsprobleme mit ihren Bezugspersonen. Außerdem haben Kinder mit ADHS des Öfteren Probleme, Freundschaften zu Gleichaltrigen zu knüpfen und aufrechtzuerhalten.
Trotz all der beschriebenen Probleme haben Kinder mit ADHS auffallende Stärken: Sie sind kontaktfreudig, neugierig, helfen gern, können witzig und einfallsreich sein, sind begeisterungsfähig, belastbar, selten zimperlich und auch nicht nachtragend (Krowatschek 2004).
Das vorliegende Buch soll helfen, die ADHS und ADHS-Betroffene zu verstehen. Es gibt einen Überblick über die ADHS als Störungsbild und die Ursachen der ADHS. Darüber hinaus wird aktuelle Forschung zu Selbstregulationsfähigkeiten von ADHS-Betroffenen rezipiert und die Entwicklung der ADHS über die Lebensspanne dargestellt. Nach einem Einblick in aktuelle Methoden der Diagnostik wird zum Abschluss vertiefend auf Therapiemöglichkeiten, die Effektivität verschiedener Therapieansätze, die Unterschiede der ADHS bei Frauen und Männern und die Auswirkungen der ADHS in Ausbildung / Studium und Beruf eingegangen.
Die Thematik ist für Studierende der Psychologie, Erziehungswissenschaften, des Lehramtes und angrenzender Bereiche äußerst relevant, da alle Tätigen dieser Berufsgruppen mit ADHS-Kindern, -Jugendlichen oder -Erwachsenen konfrontiert werden. Weiterhin ist der professionelle Umgang mit ADHS-Betroffenen zumeist emotional sehr aufreibend. Darum ist es von Bedeutung, dieses Thema bereits im Studium zu bearbeiten.