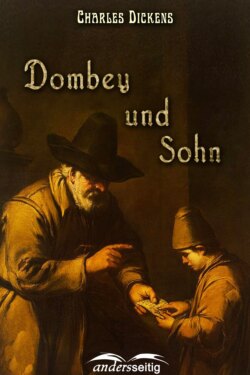Читать книгу Dombey und Sohn - Charles Dickens, Чарльз Диккенс, Geoffrey Palmer - Страница 8
Drittes Kapitel. In welchem sich Mr. Dombey als Mann und Vater an der Spitze seines Hauswesens zeigt.
ОглавлениеDas Begräbnis der verstorbenen Frau war vorüber – zur völligen Zufriedenheit des Bestatters sowohl, als auch der Nachbarschaft im allgemeinen, die in derartigen Punkten sehr eigen ist und gar gerne an jedem Unterlassungs- oder Verkürzungsfall der Feierlichkeiten Anstoß nimmt; die verschiedenen Glieder von Mr. Dombeys Hauswesen konnten also ihre Plätze wieder einnehmen. Eine solche kleine Welt ist, ebenso wie die große draußen, geeignet, ihre Toten gar bald zu vergessen, und nachdem die Köchin die Selige für eine gute Dame erklärt, die Haushälterin ihre Meinung dahin abgegeben, daß Sterben das gemeinsame Los sei, der Kellermeister sich gewundert und gefragt, wer das auch gedacht hätte, die Hausmagd erklärt, daß sie es kaum glauben könne, und der Diener gesagt hatte, der Vorfall komme ihm wie ein Traum vor, war der Gegenstand für sie einstweilen erledigt, und sie dachten daran, daß die Trauer zuletzt langweilig werden würde.
Für Richards, die wie eine ehrenwerte Gefangene eine Treppe hoch einquartiert worden war, begann der nächste Morgen kalt und grau. Mr. Dombeys großes Haus stand auf der Schattenseite einer langen, düsteren, traurig vornehmen Straße in der Gegend zwischen Portland-Place und Bryanstone-Square. Es war ein Eckhaus, hatte große weite Höfe, Keller mit vergitterten Fenstern und schielte einen durch schiefäugige Türen an, die zu Staubbehältern führten. Es war ein unheimliches, mit einer halbkreisförmigen Hinterseite versehenes Haus, und die Besuchzimmer gingen auf einen Kieshof hinaus, wo zwei hagere Bäume mit geschwärzten Stämmen und Zweigen standen, deren vom Rauch ausgetrocknete Blätter eher rasselten als rauschten. Die Mittagssonne sandte ihre Strahlen nie in diese Straße, sondern kam nur morgens um die Frühstückszeit mit den Wasserkarren, den Kleidertrödlern, den Blumenverkäufern, den Schirmflickern und dem Mann, der während seiner Wanderung die Schwarzwälderuhr schlagen ließ, war aber bald wieder verschwunden, um sich an diesem Tage nicht mehr blicken zu lassen. Die Musikbanden und die Puppenspieler zogen ihr nach, um den Platz den unheimlichen Drehorgeln und den weißen Mäusen, hin und wieder auch zur Abwechslung einem Stachelschweine als Beute zu überlassen, bis die Diener, deren Familien auswärts speisten, im Zwielicht unter die Haustüren traten und der Laternenanzünder jeden Abend einen vergeblichen Versuch machte, die Straßen durch Gaslicht zu erhellen.
Innen war das Haus ebenso öde wie außen. Nachdem das Begräbnis vorüber war, erteilte Mr. Dombey Befehl, alle Möbel zu verhüllen – vielleicht, um sie für den Sohn, an den sich alle seine Pläne knüpften, aufzubewahren – und aus den Zimmern, mit Ausnahme derjenigen, die er im Erdgeschoß selbst bewohnen wollte, alle Ziergegenstände zu entfernen. Tische und Stühle, die mitten im Zimmer einfach zusammengehäuft und mit großen Tüchern bedeckt wurden, nahmen geheimnisvolle Formen an. Die Klingelhandgriffe, die Jalousien und die Spiegel erhielten eine Umhüllung aus Zeitungspapier, in denen sich fragmentarische Berichte über Todesfälle und schreckliche Mordtaten unwillkürlich dem Beschauer aufdrängten. Sämtliche Kronleuchter sahen, in Leinwand gehüllt, wie ungeheure Tränen aus, die von der Decke herabhingen. Aus den Kaminen drangen Gerüche wie aus Gewölben und feuchten Plätzen hervor. Die tote und begrabene Dame blickte unheimlich aus einem Bilderrahmen, der eine geisterhafte Umhüllung erhalten hatte, nieder. Jeder Windstoß wirbelte aus den benachbarten Pferdeställen um die Ecke herum etwas von dem Stroh, das man vor das Haus gestreut hatte, als sie noch krank war, und das noch immer in verwitterten Überresten an den Pflastersteinen der Nachbarschaft klebte. Diese Überbleibsel wurden nun stets vermöge einer unsichtbaren Anziehung nach der Schwelle des Hauses, das unmittelbar gegenüber zu vermieten war, geweht, und richteten ihre unheimliche Beredsamkeit gegen Mr. Dombeys Fenster.
Die Gemächer, die Mr. Dombey sich für den eigenen Gebrauch vorbehalten hatte, waren alle von der Halle aus zu betreten und bestanden aus einem Wohnzimmer, aus einer sogenannten Bibliothek, die aber in Wirklichkeit ein Ankleidezimmer war, so daß sich der Geruch von heißgepreßtem Papier, Pergament, Maroquin und Juchten mit dem Geruch mehrerer Stiefelpaare stritt, und einer Art Speisekammer oder einem kleinen verglasten Frühstückszimmer jenseits, das eine Aussicht auf die vorerwähnten Bäume und in der Regel auch auf etliche herumschleichende Katzen bot. Diese drei Zimmer gingen ineinander. Morgens, wenn Mr. Dombey in einem der beiden zuerst genannten Gemächer beim Frühstück saß, oder nachmittags, wenn er zum Diner nach Hause kam, wurde eine Klingel gezogen, die Richards nach dem verglasten Gemach rief, wo sie mit ihrem jungen Pflegling auf und ab gehen mußte. Aus den Blicken, die sie zu solchen Zeiten nach Mr. Dombey hingleiten ließ, der hinten im Zimmer saß und hinter einem der dunkeln, schwerfälligen Möbel hervor nach dem Kinde sah – das Haus war vor Jahren von seinem Vater bewohnt worden, und manche Gegenstände machten einen geradezu finsteren und altmodischen Eindruck –, begann sie sich Vorstellungen über seinen einsamen Zustand zu machen, und es kam ihr vor, als sei er ein einsamer Gefangener in einer Zelle, oder eine seltsame Erscheinung, die nicht angeredet oder näher betrachtet werden durfte.
Die Amme des kleinen Paul Dombey hatte schon mehrere Wochen ihr einsames Leben geführt und ihren Paul umhergetragen. Eines Tages war sie nach einem melancholischen Spaziergang durch die traurigen Prunkgemächer (sie ging nämlich nie ohne Mrs. Chick aus, die, gewöhnlich vom Miß Tox begleitet, an schönen Vormittagen vorzusprechen pflegte, um sie und ihren Säugling an die Luft zu führen, oder mit andern Worten, sie wie eine wandelnde Trauer gravitätisch auf dem Pflaster hin und her traben zu lassen) nach ihrem obern Stübchen zurückgekehrt und hatte gerade Platz genommen, als die Tür sich langsam öffnete und ein schwarzäugiges kleines Mädchen hereinsah.
»Ohne Zweifel ist es Miß Florence, die von ihrer Tante nach Haus zurückgekommen ist«, dachte Richards, die das Kind nie zuvor gesehen hatte. »Freut mich, Euch wohl zu sehen, Miß.«
»Ist das mein Bruder?« fragte das Kind und zeigte auf den Säugling.
»Ja, mein Töchterchen«, antwortete Richards. »Kommt her und küßt ihn.«
Statt aber näher heranzutreten, sah ihr das Kind ernst ins Gesicht und sagte:
»Was habt Ihr mit meiner Mama gemacht?«
»Gott segne das kleine Geschöpf!« rief Richards, »welch betrübte Frage! Was ich mit Eurer Mama gemacht habe? Nichts, Miß.«
»Was hat man mit meiner Mama angefangen?« fragte das Kind.
»In meinem Leben hat mich noch nichts so ergriffen«, sagte Richards, die sich natürlich an Stelle dieses Kindes eines ihrer eigenen dachte, das unter ähnlichen Umständen nach ihr fragte. »Kommt nur näher heran, meine teure Miß! Ihr braucht Euch nicht vor mir zu fürchten.«
»Ich fürchte mich nicht vor Euch«, sagte das Kind, näher tretend. »Aber ich möchte wissen, was man mit meiner Mama angefangen hat.«
»Mein Herzchen«, entgegnete Richards, »Ihr tragt dieses hübsche schwarze Kleidchen zur Erinnerung an Eure Mama.«
»Ich kann mich in jedem Kleide an meine Mama erinnern«, erwiderte das Kind und Tränen traten ihm in die Augen.
»Aber die Leute kleiden sich schwarz zum Gedächtnis der Personen, die dahingegangen sind.«
»Wohin gegangen?« fragte das Kind.
»Kommt und setzt Euch zu mir«, sagte Richards, »ich will Euch dann ein Geschichtchen erzählen.«
In der Hoffnung, sie werde Auskunft erhalten, über das, wonach sie gefragt hatte, legte die kleine Florence ihr Hütchen, das sie bisher in der Hand gehalten hatte, bei Seite und setzte sich hurtig auf einen Schemel zu den Füßen der Amme, und sah ihr ins Gesicht.
»Es war einmal eine Frau«, begann Richards – »eine sehr gute Frau, und ihr Töchterlein liebte sie sehr.«
»Eine sehr gute Frau und ihr Töchterlein liebte sie sehr«, wiederholte das Kind.
»Da dachte Gott, es sei recht, daß es so sein sollte; und sie wurde krank und starb.«
Das Kind schauderte.
»Starb, um nie wieder von jemand auf Erden gesehen zu werden, und wurde begraben in der Erde, wo die Bäume wachsen.«
»In der kalten Erde«, versetzte das Kind, abermals schaudernd.
»Nein, der warmen Erde«, erwiderte Polly, ihren Vorteil erfassend, »wo die kleinen Samenkörner sich in schöne Blumen verwandeln, und in Gras, und in Korn und was weiß ich alles. Wo gute Menschen zu schönen Engeln werden und nach dem Himmel hinauf fliegen!«
Das Kind, welches das Köpfchen gesenkt hatte, erhob es jetzt wieder und blickte die Erzählerin aufmerksam an.
»So – laßt mich sehen«, fuhr Polly fort, die durch diese ernste Musterung, ihren Wunsch, das Kind zu trösten, ihren plötzlichen Erfolg und das geringe Vertrauen in ihre eigenen Kräfte ein wenig in Verwirrung geriet. »Ja, so ist es – als diese Dame starb, ging sie zu Gott, wohin immer man sie auch genommen haben mag; und sie betete zu ihm. – Ja, das tat sie«, sagte sie in großer Erregung, da es ihr Ernst war, »er möge ihr Töchterlein lehren, daß es diese Überzeugung immer fest in seinem Herzen trage, und ihm kund tun, daß sie im Himmel glücklich sei, und ihr Kind noch immer liebe. Es solle daher hoffen und alle seine Kräfte aufbieten – ja, das ganze Leben lang –, daß es eines Tages dort wieder mit ihr zusammentreffe, um nie, nie, nie wieder von ihr getrennt zu werden.«
»Das war meine Mutter!« rief das Kind aufspringend und schlang seine Arme um den Nacken der Amme.
»Und das Herz des Kindes«, sagte Polly, sie an ihre Brust ziehend, »das Herz der kleinen Tochter war so voll von dieser Wahrheit, daß sie, selbst als sie sie von einer fremden Amme erzählen hörte, die es nicht mal recht erzählen konnte, sondern selbst weiter nichts als eine arme Mutter war, einen Trost darin fand. Sie fühlte sich nicht mehr so einsam – sie schluchzte und weinte an ihrem Busen – und sie liebte das kleine Kindlein, das in ihrem Schoß lag und – da, da, da!« fügte Polly bei, indem sie die Locken des Kindes zurückstrich, auf welche ihre Tränen niederfielen, »das arme Herzchen!«
»So, das ist ja schön, Miß Floy! Und wird Euer Pa nicht wieder zornig werden?« rief von der Tür her eine schrille Stimme, die aus dem Munde eines kleinen, braunen, altklugen Mädchens von vierzehn Jahren mit einer Mopsnase und pechschwarzen Augen kam. »Hat er doch ausdrücklich befohlen, Ihr sollt nicht zu der Amme gehen und sie belästigen?«
»Aber sie belästigt mich durchaus nicht«, erwiderte Polly überrascht. »Ich habe die Kinder gerne.«
»O, ich bitte um Verzeihung, Mrs. Richards; doch Ihr müßt wissen, daß es darauf nicht ankommt«, versetzte das schwarzäugige Mädchen, das so verzweifelt scharf und beißend war, daß es wie eine Zwiebel einem das Wasser in die Augen bringen konnte. »Ich esse auch gerne Penny-Semmeln, Mrs. Richards, aber daraus folgt noch nicht, daß ich sie statt des Tees erhalte.«
»Na, das macht nichts«, sagte Polly.
»O, danke schön, Mrs. Richards – meint Ihr?«, entgegnete das schnippische Mädchen. »Vergeßt übrigens nicht, wenn Ihr so gut sein wollt, daß Miß Floy unter meiner Obhut steht und Master Paul unter der Eurigen.«
»Deswegen brauchen wir uns ja nicht zu zanken«, sagte Polly.
»O nein, Mrs. Richards«, erwiderte der kleine Sprühteufel. »Durchaus nicht, ich wünsche das auch nicht, denn wir stehen nicht auf solchem Fuße miteinander. Miß Floy ist ein dauernder Pflegling, Master Paul nur ein vorübergehender.« Sprühteufel bediente sich keiner andern als Kommapausen, und alles, was sie zu sagen hatte, strömte womöglich in einem einzigen Satze, in einem Atem heraus.
»Miß Florence ist eben erst nach Hause gekommen, nicht wahr?« fragte Polly.
»Ja, Mrs. Richards, eben erst nach Hause gekommen, und kaum daß Ihr eine Viertelstunde hier seid, Miß Floy, geht Ihr schon hin und beschmiert mit Eurem feuchten Gesicht das teure Trauerkleid, das Mrs. Richards für Eure Ma trägt.«
Nach dieser Vorhaltung riß der junge Sprühteufel, deren eigentlicher Name Susanna Nipper war, mit einem Ruck die Kleine von ihrer neuen Freundin los, als ob sie ein fauler Zahn wäre. Doch schien sie es mehr aus übergroßem Diensteifer, als aus überlegter Lieblosigkeit zu tun.
»Sie freut sich so, daß sie wieder zu Hause ist«, sagte Polly, indem sie Florence mit einem ermutigenden Lächeln zunickte, »und wird sich noch mehr freuen, wenn sie heute abend ihren lieben Papa zu sehen bekommt.«
»Du meine Güte, Mrs. Richards!« rief Miß Nipper, ihr rasch ins Wort fallend, »sprecht nicht so. Ihr meint doch ihren lieben Papa sehen! So etwas möchte ich wohl auch mal erleben!«
»Wird sie es denn nicht?« fragte Polly.
»Du meine Güte, Mrs. Richards, nein, ihr Papa ist viel zu sehr auf jemand anders versessen, und schon ehe dieser jemand anders da war, war sie nie sonderlich beliebt. Mädchen gelten in diesem Hause nichts, Mrs. Richards, kann ich Euch versichern.«
Die Kleine sah hastig von der einen Pflegerin auf die andere, als ob sie fühlte und verstünde, was gesprochen wurde.
»Ihr setzt mich in Erstaunen!« rief Polly. »Hat Mr. Dombey nie nach ihr gefragt, seit –«
»Nein«, unterbrach sie Susanna Nipper. »Nicht ein einziges Mal, und seit Jahr und Tag hat er sie kaum mit einem Auge angesehen, und ich glaube, er würde in ihr sein eigenes Kind nicht erkennen, wenn er sie auf der Straße getroffen hätte, oder er würde sie nicht als eigenes Kind erkennen, wenn er ihr morgen auf der Straße begegnete, Mrs. Richards. Was mich betrifft«, fügte Sprühteufel mit einem Kichern hinzu, »so zweifle ich, ob er überhaupt von meinem Dasein etwas weiß.«
»Liebes Herz«, sagte Richards, meinte aber damit nicht Miß Nipper, sondern die kleine Florence.
»O, nicht weit von hier, wo wir jetzt sprechen, ist ein Tatar, kann ich Euch sagen, Mrs. Richards, Anwesende natürlich immer ausgenommen«, bemerkte Susanna Nipper; »wünsche Euch guten Morgen, Mrs. Richards, nun, Miß Floy, kommt jetzt mit mir und bleibt nicht zurück wie ein garstiges unartiges Kind, das nicht verständig sein will.«
Trotz dieser Beschwörung und ungeachtet eines Rucks von seiten der Susanna Nipper, der recht wohl eine Verrenkung der Schulter hätte zur Folge haben können, riß die kleine Florence sich los und küßte ihre neue Freundin mit Innigkeit.
»Lebt wohl!« sagte das Kind. »Gott behüte Euch! Ich komme bald wieder zu Euch, und Ihr werdet mich doch auch besuchen? Susanna wird es schon zugeben. Nicht wahr, Susanna?«
Sprühteufel schien von Natur aus ein gutmütiges Geschöpf zu sein, obschon sie in jener Schule gebildet worden war, in der man sich mit der neuen Idee trägt, die Jugend müsse wie das Geld tüchtig geschüttelt und gerüttelt werden, um blank zu bleiben. Bei dieser durch liebkosende Gebärden unterstützten Berufung faltete sie ihre kleinen Arme, schüttelte den Kopf und legte einen mildernden Ausdruck in ihre weit offenen schwarzen Augen.
»Es ist nicht recht von Euch, das zu verlangen, Miß Floy, denn Ihr wißt, ich kann Euch nichts abschlagen. Aber Mrs. Richards und ich, wir wollen sehen, was sich tun läßt, wenn Mrs. Richards gerne eine Fahrt nach Chaney macht, aber ich weiß vielleicht nicht, wie ich aus den London Docks kommen soll.«
Richards ging auf diesen Vorschlag ein.
»In diesem Hause geht es gerade nicht so lustig her«, fuhr Miß Nipper fort, »daß man gerne noch einsamer sein möchte, als man ohnehin schon ist. Die Toxes und Chickes können mir zwar meine beiden Vorderzähne ausziehen, Mrs. Richards, aber das ist noch kein Grund für mich, ihnen die ganze Reihe anzubieten.«
Diese Ansicht fand als sehr vernünftig bei Richards gleichermaßen Beifall.
»Es ist mir wahrhaftig ganz angenehm«, sagte Susanna Nipper, »mit Euch in Freundschaft zu leben, Mrs. Richards, solang Master Paul unter Euren Händen bleibt, und wenn es sich so einrichten läßt, daß nicht offen gegen die Befehle gehandelt wird, – aber du meine Güte, Miß Floy, Ihr habt Eure Sachen noch nicht gehabt, Ihr garstiges Kind, nein, Ihr habt nicht, so kommt mit!«
Mit diesen Worten unternahm Susanne Nipper einen gewaltigen Angriff auf ihren jungen Schützling und fegte mit Florence zur Tür hinaus.
In ihrem Kummer und in ihrer Vernachlässigung war die Kleine so sanft, so ruhig und klaglos; sie besaß so viel Anhänglichkeit, um die sich niemand zu kümmern schien, und aus ihrer wehmütigen Stimmung machte man sich so gar nichts, daß Polly das Herz sehr schwer wurde, als sie sich wieder allein befand. Durch den einfachen Vorgang, der zwischen ihr und dem mutterlosen kleinen Mädchen stattgefunden hatte, war ihr Gemüt nicht weniger ergriffen worden, als das des Kindes, und sie fühlte gleich dem Kinde, daß in diesem Augenblicke eine Grundlage des Vertrauens und der Teilnahme zwischen ihnen gelegt worden war.
So großes Vertrauen Mr. Toodle auch zu Polly hatte, stand sie vielleicht im Punkte erworbener Vorzüge nur sehr wenig über ihm; sie war indes ein gutes einfaches Pröbchen jener Natur, die man bei Frauen in untergeordneter Stellung stets besser, treuer, edler, zartfühlender und aufopferungsvoller findet, als bei den Männern. So wenig Schulbildung sie auch genossen, hätte sie doch vielleicht jetzt schon eine Art dämmernder Erkenntnis in Mr. Dombeys Haus bringen können und es würde den Gebieter desselben jetzt noch nicht so wie es zuletzt doch geschah, gleich einem Blitze getroffen haben.
Doch das führt uns von der Hauptsache ab. Polly dachte damals nur daran, wie sie die Geneigtheit der Miß Nipper benützen und ein oder das andere Mittel ersinnen könne, um auf gesetzlichem Wege und ohne Rebellion die kleine Florence auf ihre Seite zu bringen. Eine Einleitung dazu bot sich schon am selben Abend.
Die Klingel hatte sie wie gewöhnlich nach dem verglasten Gemache hinunter berufen, und sie ging lange mit ihrem Säugling in dem Arme auf und ab, als plötzlich zu ihrem großen Erstaunen und Entsetzen Mr. Dombey herauskam und vor sie hintrat.
»Guten Abend, Richards.«
Ganz der nämliche strenge, steife Gentleman, wie er ihr am ersten Tage erschienen war. Ein Herr mit einem so scharfen Blicke, daß sie unwillkürlich die Augen senkte und einen Knix machte.
»Wie geht es Master Paul, Richards?«
»Er ist wohl und gedeiht vortrefflich, Sir.«
»Er sieht so aus«, versetzte Mr. Dombey mit großem Interesse das Gesichtchen betrachtend, das sie mit scheinbarer Sorglosigkeit zur Beschauung enthüllte. »Hoffentlich gibt man Euch doch alles, was Ihr braucht.«
»O ja, ich danke Euch, Sir.«
Dieser Antwort folgte aber plötzlich ein so augenfälliges Stocken, daß Mr. Dombey, der sich bereits abgewendet hatte, stehen blieb und sich fragend umwandte.
»Ich glaube, nichts ist so geeignet, Kinder lebhaft und heiter zu machen, Sir, als wenn sie andere Kinder um sich spielen sehen«, bemerkte Polly, allen ihren Mut zusammennehmend.
»Ich denke, Richards«, versetzte Mr. Dombey mit einem Stirnrunzeln, »ich habe Euch schon bei Eurem Hierherkommen gesagt, daß ich von Eurer Familie so wenig als möglich zu sehen wünsche. Ihr könnt jetzt Euren Spaziergang wieder fortsetzen.«
Mit diesen Worten zog er sich wieder in das Innere seines Zimmers zurück. Für Polly war es eine gewisse Genugtuung, zu wissen, daß er sie durchaus mißverstanden hatte, doch fühlte sie zugleich, daß sie in Ungnade gefallen war, ohne ihren Zweck auch nur im mindesten gefördert zu haben.
Als sie am nächsten Abend wieder herunter kam, ging Mr. Dombey in dem Konservatorium hin und her. Durch diesen ungewohnten Anblick eingeschüchtert, blieb sie an der Tür stehen; ihrer Ungewißheit aber, ob sie vortreten oder sich zurückziehen sollte, machte der Hausherr selbst ein Ende, indem er sie hereinrief.
»Wenn Ihr wirklich glaubt, daß diese Art von Gesellschaft gut für das Kind sei«, sagte er in herbem Tone und als ob zwischen dem Vorschlage und seiner jetzigen Erwiderung gar kein Zwischenraum liege, »wo ist Miß Florence?«
»Gerade an Miß Florence dachte ich, Sir«, versetzte Polly hastig; »aber ich habe von ihrer kleinen Jungfer gehört, daß sie nicht dürften –«
Mr. Dombey zog die Klingel und ging im Zimmer auf und ab, bis jemand erschien.
»Ich befehle hiermit ein- für allemal, daß Miß Florence zu Richards darf, so oft sie will; auch kann sie mit ihr ausgehen und dergleichen. Ich will, daß man die Kinder zusammen lasse, so oft Richards es wünscht.«
Das Eisen war jetzt heiß und Richards schmiedete tapfer darauf los – handelte es sich doch um eine gute Sache, und das gab ihr Mut, obschon sie sich instinktiv vor Mr. Dombey fürchtete. So stellte sie nun das Gesuch, man möchte Miß Florence hin und wieder herunterschicken, damit sie sich mit ihrem kleinen Bruder befreunden könne. Als der Diener sich mit dieser Weisung entfernte, stellte sie sich, als spiele sie mit dem Kinde; indes glaubte sie zu bemerken, daß Mr. Dombeys Farbe sich veränderte, daß der Ausdruck seines Gesichtes ganz anders wurde, und daß er sich hastig abwendete, als möchte er gerne seine, ihre oder beider Worte widerrufen, wenn ihn nicht die Scham davon abhielte.
Und sie hatte recht. Er hatte sein vernachlässigtes Kind zum letztenmal gesehen, wie es in der schmerzlichen Umarmung seiner sterbenden Mutter lag, und dieser Rückblick war für ihn mit einem Male eine Enthüllung sowohl als ein Vorwurf. Mochte er, so sehr er wollte, von dem Sohn in Anspruch genommen sein, auf den er so hohe Hoffnungen baute, diese Schlußszene konnte er nicht vergessen, und stets mußte sich ihm die Erinnerung aufdrängen, daß er keinen Teil daran gehabt hatte. Sie war so voll tiefer, klarer Innigkeit und Wahrheit gewesen; die beiden Gestalten hatten sich mit ihren Armen umschlungen, während er, ganz ausgeschlossen davon, von einer kleinen Erhöhung aus als bloßer Zuschauer, fremd und kalt auf sie herabsah.
Er konnte diese Dinge nicht aus seinem Gedächtnis verdrängen und seinen Geist nicht frei halten von den unvollkommenen Gestalten, die sich zur Läuterung der Wahrheit ihm aufdrangen, als wollten sie gewaltsam durch den Nebel seines Stolzes brechen. Seine frühere Gleichgültigkeit gegen die kleine Florence ging in ein ganz außergewöhnliches Unbehagen über, und es kam ihm fast vor, als ob das Kind ihn bewache und Mißtrauen in ihn setze – als habe es den Schlüssel zu einem Geheimnis in seiner Brust, dessen Wesenheit er selbst kaum kannte, – als erschaue es instinktartig eine schrille mißtönende Saite in seiner Seele, die es schon durch seinen Atem zum Vibrieren bringen könne.
Seine Gefühle gegen die Kleine waren schon von ihrer Geburt an bloß negativ gewesen. An eine Abneigung dachte er nie, denn diese hätte der Zeit und Mühe nicht verlohnt. Sie war ihm nie ein entschieden unangenehmer Gegenstand gewesen, aber jetzt fühlte er sich um ihretwillen beunruhigt. Sie störte seinen Frieden. Wie gerne hätte er die Gedanken an sie ganz und gar beseitigt, wenn er nur gewußt hätte, wie er es angreifen sollte. Vielleicht fürchtete er sich – wer vermag in solche Mysterien einzudringen? – daß er zuletzt so weit kommen könnte, sie zu hassen.
Als die kleine Florence schüchtern eintrat, unterbrach Mr. Dombey sein Hin- und Hergehen, um sie ins Auge zu fassen. Würde er sie mit größerer Teilnahme und mit dem Auge eines Vaters betrachtet haben, so hätte er in ihrem scharfen Blicke die Gründe und die Besorgnisse, unter denen sie erbebte, erfassen können – den leidenschaftlichen Wunsch, auf ihn zuzueilen, ihr Antlitz an seiner Brust zu verbergen und ihm zuzurufen: »O Vater, versuche es, mich zu lieben! Es ist ja kein fremdes, es ist dein eigenes Kind!« – die Furcht vor einer Zurückweisung, die Scheu, als zu dreist zu erscheinen und ihm Anstoß zu geben, die Hoffnung auf irgendeine Ermutigung oder Beruhigung. Ach, das arme, schwer bedrückte junge Herz sehnte sich nach einem natürlichen Ruheplatz für sein Leid, für seine Innigkeit.
Aber er sah nichts von alledem – nur daß sie unschlüssig an der Tür stand und ihn ansah, weiter nichts.
»Nur herein«, sagte er; »komm herein. Wovor fürchtet sich denn das Kind?«
Sie trat ein, und nachdem sie sich einen Augenblick mit unsicherer Miene umgesehen hatte, blieb sie in der Nähe der Tür stehen und preßte ihre Händchen fest zusammen.
»Komm her, Florence«, sagte der Vater kalt. »Weißt du, wer ich bin?«
»Ja, Papa.«
Die Tränen, die an ihren Wimpern hingen, als sie ihre Augen rasch zu seinem Antlitz erhob, erstarrten ob dem Ausdruck, den sie daselbst wahrnahm. Sie sah wieder zur Erde und streckte die zitternde Hand aus.
Mr. Dombey nahm sie leicht zwischen seine Hände und blickte einen Moment auf das Kind nieder, als wisse er ebensowenig als Florence, was er sagen oder tun sollte.
»So! Sei ein gutes Mädchen«, sagte er, ihr den Kopf streichelnd und gewissermaßen mit einem verstohlenen, unruhigen und zweifelhaften Blick auf sie niederschauend. »Geh zu Richards! Geh!«
Die Kleine zögerte noch einen Augenblick, als möchte sie noch immer sich an ihm festhalten oder als habe sie doch wenigstens die Hoffnung, er könne sie auf seine Arme nehmen und sie küssen. Abermals blickte sie zu seinem Gesicht auf. Da kam ihm der Gedanke, wie sehr der Ausdruck ihres Antlitzes dem gleiche, den er bemerkt hatte, als sie sich in jener Nacht nach dem Doktor umsah. Instinktiv ließ er ihre Hand fallen und wandte sich ab.
Man konnte leicht bemerken, daß sich Florence in Gegenwart ihres Vaters sehr unfrei benahm. Nicht nur auf dem Geiste des Kindes, sondern auch auf der natürlichen Anmut und Freiheit ihrer Bewegungen lag ein unnatürlicher Zwang. Gleichwohl freute sich Polly über diese Szene und setzte, da sie Mr. Dombey nach sich selbst beurteilte, ein großes Vertrauen in die stumme Berufung, die sich in dem Trauerkleide der armen kleinen Florence aussprach. »'s ist in der Tat hart«, dachte Polly, »daß er nur an das eine mutterlose Kindlein denkt, während er doch ein anderes und dazu noch ein Mädchen vor seinen Augen hat.«
Und so hielt sie denn Florence so lang als sie nur konnte vor seinen Augen und wußte es mit dem kleinen Paul so einzurichten, daß auch der Vater sehen mußte, das Brüderchen sei nur um so lebhafter und munterer, wenn ihm die Schwester Gesellschaft leiste. Als es Zeit war, wieder hinaufzugehen, hätte sie gar gerne die Kleine in das innere Zimmer geschickt, damit sie ihrem Vater gute Nacht sage; aber das Kind war zu schüchtern und wollte nicht. Als sie aufs neue in Florence drang, verhüllte diese die Augen mit ihren Händchen, als wollte sie sich ihre eigene Unwürdigkeit verbergen, und rief:
»O nein, nein! Er will nichts von mir. Er will nichts von mir!«
Der kleine Wortstreit hatte Mr. Dombeys Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Er fragte vom Tische her, wo er bei seinem Weine saß, was es gebe.
»Miß Florence ist besorgt, Euch zu stören, Sir, wenn sie hineinkäme, um Euch gute Nacht zu sagen«, versetzte Richards.
»Tut nichts«, entgegnete Mr. Dombey. »Ihr könnt sie kommen und gehen lassen, ohne daß sie auf mich zu achten braucht.«
Als das Kind das hörte, erbebte es und war fort, ehe ihre bescheidene Freundin wieder sich nach ihr umsehen konnte.
Gleichwohl triumphierte Polly nicht wenig über den Erfolg ihres wohlangelegten Planes und über die Gewandtheit, die sie dabei zutage gefördert hatte. Als sie wieder wohlbehalten in ihrem oberen Stübchen angelangt war, machte sie dem Sprühteufel eine ausführliche Mitteilung davon. Miß Nipper nahm diesen Beweis ihres Vertrauens und die Aussicht auf einen freieren Verkehr für die Zukunft etwas kalt auf und zeigte sich durchaus nicht enthusiastisch in ihren Freudenbezeugungen.
»Ich hätte geglaubt, Ihr würdet Euch darüber freuen«, sagte Polly.
»O ja, Mrs. Richards, ich freue mich recht sehr darüber, danke Euch«, entgegnete Susanne, die plötzlich so kerzengerade geworden war, daß es den Anschein hatte, als habe sie ihrem Schnürleib ein neues Fischbein einverleibt.
»Ihr zeigt es aber nicht«, sagte Polly.
»O, da ich ja nur eine permanente Person bin, so kann von mir nicht erwartet werden, daß ich mich dabei wie eine temporäre benehme«, versetzte Susanna Nipper. »Temporäre greifen hier rasch durch, finde ich, aber obgleich eine treffliche Scheidewand zwischen diesem Haus und dem nächsten ist, möchte ich mich doch nicht gerade dort einquartieren, Mrs. Richards.«