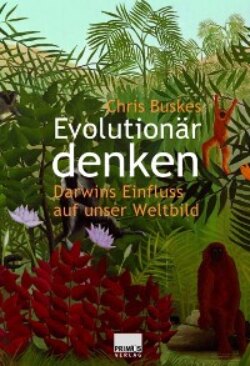Читать книгу Evolutionär denken - Chris Buskes - Страница 45
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Trends in der menschlichen Evolution
ОглавлениеTrotz aller Wissenslücken lassen sich doch einige Trends in der Evolution des Menschen ausmachen. Zwei Dinge fallen besonders auf. Zum einen die Tatsache, dass unsere Vorfahren irgendwann aufrecht zu gehen begannen (Bipedie), zum anderen, dass Masse und Volumen des Gehirns explosiv zunahmen (von knapp 500 Kubikzentimetern bei den Australopithecinen auf über 1500 Kubikzentimeter bei H. neanderthalensis und H. sapiens). Das ist mehr als eine Verdreifachung. Und obwohl der aufrechte Gang dem Wachstum des Gehirns vorausging, sind beide Veränderungen wahrscheinlich ohne einander nicht denkbar.
Betrachten wir zuerst das Phänomen der Bipedie. Vor ungefähr fünfzehn Millionen Jahren, lange bevor die Hominiden die Bühne betraten, war Afrika von dichtem Regenwald bedeckt. Durch eine Klimaänderung, die mit kühleren Temperaturen und größerer Trockenheit einherging, begann sich der Urwald zu lichten. Der Prozess setzte sich fort, bis vor ungefähr zehn Millionen Jahren, im späten Miozän, die Savannenlandschaft entstand. Selektionsdruck durch die veränderte Umwelt habe die Australopithecinen dazu gezwungen, die Bäume zu verlassen und die Grasebene zu erkunden, lautet die sogenannte Savannentheorie. Es wurde auch an die Möglichkeit gedacht, dass übriggebliebene, isolierte Waldstücke als Evolutionsinseln fungierten. Vergleichbar mit den Galapagos-Finken hätten sich Hominidenpopulationen so getrennt voneinander in verschiedene Richtungen entwickelt.
Der aufrechte Gang kann nützlich sein, wenn man als kleiner Primat durch hohes Gras läuft (Lucy war kaum einen Meter groß). Man hat einen besseren Überblick und kann Raubtiere rechtzeitig erkennen. Zudem ist nur ein kleiner Teil des Körpers der Sonne ausgesetzt – in Äquatorialafrika sicher von Vorteil. Und die Temperatur der Luft ist anderthalb Meter über dem Boden schon viel niedriger. In Kombination mit der nackten Haut mit ihren vielen Schweißdrüsen bildet Bipedie so ein probates Mittel gegen Überhitzung. Ein Team amerikanischer Anthropologen und Genetiker kam vor einiger Zeit aufgrund einer DNA-Analyse zu dem Schluss, dass die Hominiden schon mindestens 1,2 Millionen Jahre ohne dichte Körperbehaarung sind. Das Fell verschwand also nicht, weil wir Kleider zu tragen begannen, was erst viel später geschah.
Die Savannentheorie wurde durch den Fund von Toumaï (Sahelanthropus tschadensis) wieder infrage gestellt, da dieser den Ursprung der Hominiden zeitlich viel weiter zurückverlegt. Demnach müssen die Hominiden schon im Regenwald auf zwei Beinen gegangen sein. Eine Lösung dieses Problems bietet möglicherweise die Hypothese, die Hominiden hätten irgendwann vor zehn bis fünf Millionen Jahren ein Zwischenstadium durchgemacht: das Zeitalter des Wasseraffen. Die Evolution des Menschen spielte sich zu einem Großteil am Ufer oder in der Nähe der großen Seen Ostafrikas ab. Hier hätten die Hominiden ein (semi)aquatisches Dasein geführt, wobei Bipedie sich zuerst beim Durchwaten des Wassers als praktisch erwiesen haben dürfte. In einem späteren Stadium habe sich der Wasseraffe dann zu einem perfekten Schwimmer und Taucher entwickelt. Seine Nahrung habe nicht aus Fleisch, sondern aus Fisch und Schalentieren bestanden. Schon in den Sechzigerjahren des vorigen Jahrhunderts meinte die britische Biologin Alister Hardy, der Mensch müsse eine aquatische Vergangenheit gehabt haben. Er besitze nämlich eine Reihe von Merkmalen, die sich sonst nur bei Meeressäugetieren fänden, wie die unbehaarte Haut, die subkutane Speckschicht und der auffällige Tauchreflex, der den Herzschlag verlangsamt und den Sauerstoffverbrauch verringert (was anderen Primaten weniger gut gelingt). Auffällig sei auch, dass unsere Nasenlöcher nach unten gerichtet sind – auch dies eine Ausnahme bei Primaten –, wodurch uns beim Schwimmen weniger schnell Wasser in die Nase eindringt. Die Ideen der etwas exzentrischen Hardy wurden damals allerdings nur belächelt. In den Siebzigerjahren unternahm die Wissenschaftsjournalistin Elaine Morgan den Versuch, die Theorie des Wasseraffen zu rehabilitieren. Ihr Buch The aquatic ape / Kinder des Ozeans fand zwar bei einem breiten Publikum Anklang, jedoch nicht bei der Zunft der Paläanthropologen. Der Mensch als Schnorcheltier war keine sonderlich berauschende Vorstellung. Da war die Savannentheorie, die Vorstellung vom strammen Vorfahren, der jagend durch die Savanne zieht, viel überzeugender. Neuerlich regt sich jedoch wieder Interesse für die Wasseraffentheorie.
Wie dem auch sei, der aufrechte Gang ist natürlich nicht plötzlich, sondern allmählich (schrittweise sozusagen) entstanden. Er erfordert nicht unbeträchtliche anatomische Anpassungen. Es muss am Anfang recht anstrengend gewesen sein, eine so merkwürdige Haltung einzunehmen. Warum beharrten die Primaten nur darauf? Weil neben den schon erwähnten Gründen noch ein großer Vorteil damit verbunden war: Die Hände wurden zum Tragen von Gegenständen frei. Wenn man Dinge (Nahrung) tragen kann, kann man auch einen Überschuss mit „nach Hause“ nehmen, den man gegen anderes eintauschen kann, etwa gegen Sex oder gegen Nahrung, die man sich nicht selbst beschaffen kann. So begannen die Individuen allmählich zu kooperieren, es entstand ein komplexeres Sozialleben, das immer mehr Intelligenz erforderte.
Und an diesem Punkt greifen der aufrechte Gang und die Zunahme des Hirnvolumens, besonders der Großhirnrinde, ineinander. Der britische Evolutionspsychologe Robin Dunbar hat nachgewiesen, dass bei Primaten die Gruppengröße mit der Gehirngröße korreliert. Je komplexer das soziale Zusammenleben, desto größer das Gehirn. So gut wie alle Affen und Menschenaffen leben in sozialen Gruppen, in denen es von lebenswichtiger Bedeutung ist, den eigenen Status und den anderer sorgfältig im Auge zu behalten (der solitäre Orang-Utan bildet die einzige Ausnahme). Dagegen ließe sich einwenden, die aufrecht gehenden Australopithecinen seien Millionen Jahre mit einem kleinen, affenartigen Gehirn von knapp 500 Kubikzentimetern ausgekommen. Sollte es sich bei der Zunahme des Hirnvolumens um eine Anomalie handeln? Dass die Australopithecinen wie die Orang-Utans solitär lebten, ist ziemlich unwahrscheinlich. Möglicherweise hat sexuelle Selektion in der Evolution des Menschen eine Rolle gespielt. Geoffrey Miller vertrat wie gesagt die Ansicht, sexuelle Selektion sei der Grund für diese sprunghafte Entwicklung gewesen. Während der Evolution seien die zur Schau getragenen Kenntnisse und Fertigkeiten belohnt worden, und das habe die rasante Vergrößerung des Hirnvolumens zur Folge gehabt.
Besonders auffällig wird dies bei der Entstehung der Gattung Homo vor zweieinhalb Millionen Jahren. Die ersten Steinwerkzeuge markieren den Anfang der Kultur. Kultur erfordert Gehirnaktivität. Um Wissen und Fertigkeiten weitergeben zu können, muss man sie erst selbst erworben haben. Zudem deutet das Gebiss des H. habilis und des H. erectus auf veränderte Ernährung hin. Sie waren keine Vegetarier mehr, sondern aßen reichlich Aas und Wild. Im Vergleich zu pflanzlicher Nahrung enthält Fleisch hochwertigere Nährstoffe wie tierische Fette und Proteine. Die meisten Paläanthropologen meinen, diese veränderte Ernährung habe die Voraussetzung für die Zunahme der Gehirngröße geschaffen. Die britischen Anthropologen Leslie Aiello und Peter Wheeler nehmen an, der Übergang zu fleischlicher Nahrung habe zu einem gut-brain swap geführt: Die zusätzliche Energie für ein größeres Gehirn konnte der Körper nur auf Kosten eines anderen Organs bereitstellen, nämlich des Darmtraktes. Darmgewebe wurde durch Hirngewebe ersetzt. In dem Maße, wie mehr Fleisch gegessen wurde, wurde weniger Darmgewebe benötigt, da Karnivoren im Gegensatz zu Herbivoren keinen langen, komplizierten Verdauungskanal benötigen. Die Energie, die dadurch anderweitig verfügbar war, wurde in ein immer größer werdendes Gehirn investiert. So trug die veränderte Ernährung zum weltweiten Erfolg der Gattung Homo bei. Karnivoren sind auch weniger von der örtlichen Vegetation und den Jahreszeiten abhängig. Ein geübter Jäger findet immer Fleisch, wenn es sein muss, sogar das seiner eigenen Artgenossen.
Die Entstehung sozialen Lebens in Gruppen wurde noch von anderen Faktoren gefördert. So weist der relativ kleine Unterschied zwischen den Geschlechtern bei Homo auf zunehmende Monogamie hin. Menschenbabys brauchen in den ersten Jahren sehr viel Pflege und Zuwendung. Daher profitierten Frauen von hingebungsvollen Partnern, die sie regelmäßig mit kalorienreicher Nahrung (Fleisch) versorgten. Immer öfter mag der biologische Vater diese Aufgabe übernommen haben, gemeinsam mit anderen Verwandten oder dem ganzen Clan. Sie investierten schließlich in ihre eigenen Gene. Eine wachsende Gemeinschaft ist außerdem von effizienter Kommunikation abhängig, die durch rudimentäre Sprache oder Symbole ermöglicht wird. Die Übertragung von kulturellen Kompetenzen wird so immer größer, und somit der Besitz eines großen Gehirns immer wichtiger. Die Hirnrinde wuchs dermaßen schnell, dass Menschenkinder immer früher zur Welt kommen mussten. Andernfalls hätte der Schädel nicht mehr durch den Geburtskanal gepasst. Der Biologe Midas Dekkers vergleicht das Menschenbaby gar mit einer Raupe, die noch die Metamorphose zum Schmetterling vor sich hat. Das ist natürlich eine Übertreibung, trifft aber den Kern der Sache. Im Vergleich zu einen Schimpansenkind ist das Menschenbaby extrem hilfsbedürftig.
Wir sehen also, dass Bipedie, Fleischgenuss, Monogamie, das Entstehen von Kultur und die Zunahme des Gehirnvolumens eng miteinander verflochten sind. Diese Trends haben sich gegenseitig beeinflusst und verstärkt, wodurch der moderne Mensch der „aus der Art geschlagene“ Außenseiter unter den Primaten geworden ist.
Wie die Evolution der Hominiden im Einzelnen auch verlaufen sein mag, sicher ist, dass in Afrika lange Zeit verschiedene Menschenartige nebeneinander existierten. Vor etwa zweieinhalb- bis anderthalb Millionen Jahren gab es drei Arten Australopithecinen (A. africanus, A. robustus und A. boisei) und mindestens zwei bis möglicherweise sogar vier echte Menschenarten (H. habilis, H. rudolfensis, H. ergaster und H. erectus). Afrika kannte demnach mindestens eine Million Jahre lang eine große Vielfalt nebeneinander existierender Hominidenarten. Diese Auffassung wird auch – mit einem Augenzwinkern – als Theorie der Star Wars-Bar bezeichnet. Kein Star Wars-Film ohne eine Szene, in der die Helden eine intergalaktische Bar besuchen, in der allerlei sonderbare Außerirdische fröhlich zusammen an der Theke sitzen. Ob die afrikanischen Hominiden ebenso brüderlich mit einander umgingen, ist zweifelhaft. Gewiss ist, dass seitdem eine große Verarmung stattgefunden hat. Heute ist H. sapiens der letzte noch lebende Vertreter einer einst vielgestaltigen Hominidenfamilie.