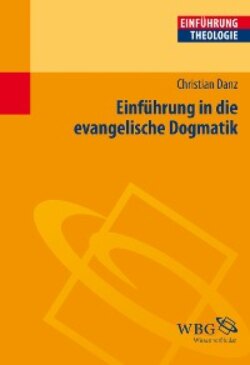Читать книгу Einführung in die evangelische Dogmatik - Christian Danz - Страница 10
b) Die Dogmatik des Altprotestantismus
ОглавлениеBeginn der protestantischen Theologenausbildung
Die Entwicklung der Dogmatik in der Theologie des alten Protestantismus ist vor allem dadurch bedingt, dass dem theologischen Nachwuchs an den sich im späten 16. Jahrhundert konsolidierenden protestantischen Universitäten ein Leitfaden für die eigene theologische Ausbildung in die Hand gegeben werden musste. Dies geschah zunächst noch nicht unter dem Titel ‚Dogmatik‘, sondern unter anderen Leitbegriffen wie ‚Loci communes‘, ‚Loci theologici‘, ‚Theologia didactico-polemica‘ u.a. Titeln. Die Dogmatik ist also zunächst ein Handbuch der theologischen Lehre, welches in methodischer Form die protestantische Sicht der christlichen Lehre als ein in sich geschlossenes Ganzes darstellt. Die Entstehung und Etablierung der Dogmatik als einer eigenständigen theologischen Disziplin hängt eng mit der Wahrnehmung dieses praktischen Erfordernisses zusammen.
Melanchthons erste Dogmatik
Die erste protestantische Dogmatik wurde von Philipp Melanchthon (1497–1560) 1521 vorgelegt und sie trägt den Titel Loci communes rerum theologicarum seu hypotyposes theologicae. Das Anliegen Luthers nimmt diese erste zusammenhängende dogmatische Darstellung der Theologie des Protestantismus darin auf, dass sie zum Studium der Heiligen Schrift anleiten will. Melanchthons Loci communes wollen eine Zusammenfassung des Gehalts der Bibel bieten. Im Vordergrund dieser Dogmatik steht das soteriologische Interesse: „Denn das heißt Christus erkennen: seine Wohltaten erkennen“ ([30], S. 23). Mit dieser soteriologischen Zuspitzung des dogmatischen Stoffs kommt es bei Melanchthon zu einer folgenreichen Reduktion. Die dogmatische Theologie wird auf das Heilsbewusstsein und die Heilsgewissheit des einzelnen Menschen konzentriert. Spekulative Themen wie die Trinität oder die Inkarnation treten zurück. Im Zentrum der Loci communes stehen in der Konsequenz der Organisation des dogmatischen Stoffs unter dem Leitbegriff der individuellen Heilsgewissheit Themen wie Gesetz, Sünde und Gnade. Melanchthon erörtert in seiner Darstellung der Lehre ohne großes systematisches Interesse zentrale Themenkomplexe (Loci) des Römerbriefs des Apostels Paulus. Einleitungsfragen, die in den späteren protestantischen Dogmatiken zunehmend breiteren Raum einnehmen, werden von Melanchthon nur knapp in der den Loci communes vorangestellten Introductio erörtert.
Die Entwicklung der Dogmatik im Bereich des Luthertums knüpfte zunächst an die Loci communes von Melanchthon an, die bis 1559 in mehreren, stark umgearbeiteten Auflagen erschien. Dadurch etablierte sich die von Melanchthon in seinem Lehrkompendium gehandhabte Loci-Methode im akademischen Lehrbetrieb. Die grundlegende Lehrdarstellung des reformierten Protestantismus bildet Johannes Calvins (1509–1564) 1536 erstmals und 1559 in fünfter und letzter Fassung erschienene Institutio religionis christianae.
Für die Entstehung und Herausbildung der altprotestantischen Dogmatik sind drei Aspekte konstitutiv: zunächst die Loci communes von Melanchthon. Zweitens das Konkordienbuch von 1580. Mit der Konkordienformel von 1577 und dem Konkordienbuch kommt der Prozess der Bekenntnisbildung innerhalb der lutherischen Kirche zum Abschluss. Und schließlich ist drittens die Rezeption der aristotelischen Metaphysik durch die lutherischen und reformierten Dogmatiker seit dem Ende des 16. Jahrhunderts zu nennen. Luther und auch Melanchthon hatten die aristotelische Philosophie mehr oder weniger aus der Theologie verbannt. Melanchthon hatte allein der Logik und der Dialektik ein Bleiberecht in der Theologie zuerkannt. In dieser methodischen Beschränkung des Einflusses der Philosophie innerhalb der Theologie folgten die Theologen des alten Protestantismus zunächst dem Vorbild Melanchthons. Dies änderte sich zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Jetzt wurde die aristotelische Schulphilosophie auf breiter Front rezipiert und dies führt zur Ausgestaltung von umfassenden dogmatischen Lehrentwürfen.
Altprotestantische Dogmatik
Die umfassenden theologischen Lehrentwürfe, die seit dem Ende des 16. Jahrhunderts sowohl von lutherischen als auch von reformierten Theologen ausgearbeitet wurden, tragen aufs Ganze gesehen ein recht einheitliches Gepräge. Die Grundlage des dogmatischen Lehrsystems ist die Heilige Schrift, deren unbedingte Geltung in den Prolegomena der Lehrentwürfe unter Rückgriff auf die aristotelische Schulphilosophie ausgearbeitet wurde. Die aus der als unfehlbar eingestuften Heiligen Schrift gewonnene Wahrheitserkenntnis verband sich mit dem für die eigene Konfession erhobenen Absolutheitsanspruch. Den Bekenntnissen der jeweiligen Konfessionen, denen in den protestantischen Territorien gleichsam reichsrechtliche Geltung zukam, wurde ein hoher Stellenwert sowohl in der Theologie als auch in der Kirche beigemessen. Durch die Bekenntnisgebundenheit der Theologie wurden umfassende normative Leitbilder des Gemeinwesens etabliert. Theologische Dogmatik und Frömmigkeit waren im 17. Jahrhundert eng verzahnt.
Ungeachtet des von den altprotestantischen Theologen betonten praktischen Charakters der theologischen Dogmatik und ihrer Ausrichtung auf das relativ homogene politisch-soziale Gemeinwesen, tragen diese Lehrentwürfe ein durchweg intellektualistisches Gepräge. Theologie ist Wissen oder Lehre von Gott. Die von der Theologie aus der Bibel geschöpften Lehren stellen das notwendige Heilswissen dar, ohne dessen Kenntnis der Mensch nicht zum Heil gelangen kann. In diesem Sinne wird der Theologiebegriff von dem Jenaer Lutheraner Johann Gerhard zu Beginn des 17. Jahrhunderts bestimmt. Theologie sei eine „aus dem Wort Gottes aufgebaute Lehre, durch die die Menschen unterrichtet werden im wahren Glauben und frommen Leben zum ewigen Leben“ ([14], Proem. 31). Und noch der spätorthodoxe lutherische Theologe David Hollaz versteht gut einhundert Jahre später die Theologie als eine „sapientia eminens practica“ („eine praktische Wissenschaft“), die „aus dem offenbarten Worte Gottes alles lehrt, was zum wahren Glauben an Christus zu erkennen und zur Heiligkeit des Lebens zu tun vonnöten ist dem sündigen Menschen, der die ewige Seligkeit erlangen will“ ([17], Proleg. I, q. 1).
Synthetische und analytische Methode
Melanchthon hatte in seiner Dogmatik den dogmatischen Lehrstoff durch die von ihm gehandhabte Local-Methode oder synthetische Methode nur in einen losen inneren Zusammenhang gebracht. Eine nachhaltige Veränderung bedeutete erst die Einführung der analytischen Methode in die lutherische Theologie in den 20er Jahren des 17. Jahrhunderts. Diese Methode geht auf den reformierten Theologen und Philosophen Bartholomäus Keckermann (1571–1609) (Systema SS. Theologiae, Hanoviae 1602) zurück. Die analytische Methode, welche in der reformierten Theologie selbst wenig Zustimmung fand, wurde der lutherischen Theologie durch Georg Calixt vermittelt. Bei der analytischen Methode handelt es sich um die Schulmethode der damaligen praktischen Wissenschaften. Die Übernahme dieser Methode in die Theologie wurde dadurch erleichtert, dass man die Theologie in Analogie zur Medizin verstand.
| Methode | Beschreibung |
| synthetische Methode (Local-Methode) | die Zusammenstellung der dogmatischen Lehrpunkte (Loci) geschieht durch Nebeneinanderstellung |
| analytische Methode | der dogmatische Lehrstoff wird unter dem Leitgesichtspunkt des Ziels der Theologie aufgegliedert |
Erst durch die Aufnahme der analytischen Methode war es möglich, den dogmatischen Lehrstoff in einen inneren geschlossenen systematischen Zusammenhang zu bringen. Den übergeordneten Gliederungsgesichtspunkt des theologischen Stoffs bildet das Ziel der Theologie (fines theologiae), den von Gott abgefallenen Menschen zum Heil zu führen. Durch die analytische Methode wird der Prozess des Heils bis hin zu seinem Ziel in seine inneren Bestandteile aufgegliedert und strukturiert. Das Ziel der Dogmatik ist der Heilsempfang und das zu heilende Subjekt ist der Mensch. Im Mittelpunkt der Dogmatik steht folglich der Weg der Heilung, so dass die Dogmatik die Grundlagen sowie die Mittel (media) der Heilung des Menschen thematisiert.
Theologische Dogmatik als praktische Wissenschaft
In der Hochorthodoxie dient die Methode der Konstruktion des inneren Zusammenhangs des dogmatischen Lehrstoffs, der nun unter der Leitperspektive der Heilung des Menschen als in sich gestufter Restitutionsprozess entfaltet wird (heilsgeschichtliches Schema der Dogmatik). Die theologische Dogmatik wird als eine praktische Wissenschaft verstanden. Zugleich gewinnen im Verlauf des 17. Jahrhunderts Einleitungs- und Vorfragen (Prolegomena) der Theologie besonderes Gewicht. Sie sollen darlegen, wie verbindliche theologische Aussagen begründet und gewonnen werden können.
Die ersten nachreformatorischen Dogmatiken kommen fast ohne Prolegomena aus. Sie begnügen sich mit einer knappen Vorrede. Melanchthon stellt seinen Loci communes lediglich eine kurze Einleitung voran und geht dann sofort zur Erörterung des dogmatischen Lehrstoffs über. Erst die lutherische und reformierte Hochorthodoxie des 17. Jahrhunderts baut die Prolegomena des theologischen Lehrsystems aus und stellt die Lehre vom Wort Gottes oder der Heiligen Schrift in das Zentrum der Grundlagenreflexion der Theologie. Die Schriftlehre bildet denn auch das Herzstück der Prolegomena der altprotestantischen Dogmatiken des 17. Jahrhunderts.
Die Prolegomena der altprotestantischen Dogmatiken umfassen in der Regel 5 Themenkomplexe:
1. von der Theologie
2. von der Religion als dem Objekt der Theologie
3. von der Offenbarung als dem Prinzip der Theologie
4. von der Heiligen Schrift
5. von den Glaubensartikeln.
An die Prolegomena schloss sich die materiale oder spezielle Dogmatik an. Sie entfaltet auf der Grundlage der in den Prolegomena erörterten Erkenntnisprinzipien den dogmatischen Lehrstoff. Auf der Grundlage der Bibel wird ein mit hohen normativen Ansprüchen versehenes Lehrsystem entfaltet. Das von der theologischen Dogmatik entfaltete Wissen soll allerdings einen praktischen Bezug haben. Luther folgend geht es in der Dogmatik nicht um ein Wissen von Gott an sich, sondern um Gott, wie er sich dem Menschen zu seinem Heil offenbart hat. Der Zweck der objektiven dogmatischen Lehre liegt also nicht in dieser, sondern in deren individueller Aneignung und Gewissheit. Aus diesem überlehrmäßigen Charakter der Dogmatik resultiert deren Verständnis als einer praktischen Wissenschaft. Allerdings ist das Verhältnis von Dogmatik und gelebter Religion so verstanden, dass Dogmatik und Religion nahezu identisch sind. Die individuelle Gewissheit enthält nichts anderes als das, was die Dogmatik beschreibt.
Auffindung der Wahrheit in der Bibel
Der theologischen Dogmatik des alten Protestantismus geht es nicht um religiöse Sonderlehren, sondern um die Wahrheit des Christentums. Diese wird in der Bibel gefunden und in Form eines theologischen Systems ausgestaltet. Die Wahrheit, welche von der Theologie dargestellt wird, ist Gott als das principium essendi (= Seinsprinzip) der Theologie. Die menschliche Theologie ist jedoch nicht mit Gott und der Theologie, die er von sich selbst hat, identisch. Als menschliche Theologie unterliegt sie der Bedingtheit und Fraglichkeit allen menschlichen Wissens. Die altprotestantischen Dogmatiker reflektieren die Endlichkeit ihrer eigenen theologischen Konstruktionen in ihrem Theologiebegriff dadurch, dass sie verschiedene Formen von Theologie unterscheiden. So hat nicht nur Gott selbst eine Theologie von sich selbst (= theologia archetypa), sondern auch die Engel und der Mensch vor und nach dem Fall haben Theologien. Ihre eigenen theologischen Systemkonstruktionen ordnen die altprotestantischen Theologen der Theologie der vernünftigen Geschöpfe zu, die im Unterschied zur urbildlichen Theologie Gottes als abbildliche Theologie (= theologia ektypa) verstanden wird. Als menschliche Theologie ist diese wandelbar und gehört zur theologia viatorum (= Theologie der Pilger).
Die altprotestantischen Theologen unterschieden jedoch nicht nur zwischen der Theologie, die Gott von sich selbst hat, und einer gestuften Folge von abbildlichen Theologien. Auch die Theologie der menschlichen Pilger wird unterschieden in eine aus der Bibel gewonnene übernatürliche Theologie (= theologia supernaturalis) und eine natürliche Theologie (= theologia naturalis). Diese Unterscheidung im Theologiebegriff des Altprotestantismus ergibt sich aus den unterschiedlichen Quellen, aus denen das Wissen von Gott zustande kommt. Die Theologie Adams vor dem Fall kann nämlich nicht auf einer göttlichen Offenbarung beruhen. Folglich muss sie in einem natürlichen Wissen des Menschen von Gott ihren Grund haben. Dieses natürliche Wissen des Menschen von Gott ist zwar durch den Abfall des Menschen von Gott verdunkelt, aber es wird von der Theologie als allgemeiner Explikationsrahmen in Anspruch genommen, in den die biblische Offenbarungstheologie eingezeichnet wird.