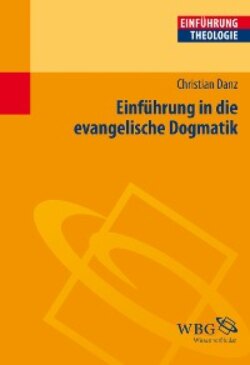Читать книгу Einführung in die evangelische Dogmatik - Christian Danz - Страница 14
1. Das Dogma in seiner geschichtlichen Entwicklung
ОглавлениеDer Begriff des Dogmas als einer lehramtlichen Entscheidung, wie er in der römisch-katholischen Kirche begegnet, ist erst in der Neuzeit entstanden und steht nicht am Anfang der Begriffsgeschichte. Geprägt wurde der Begriff nicht durch das Christentum, sondern wurde von diesem aus der antiken Kultur übernommen. In der antiken Literatur wird der Begriff auf unterschiedliche Weise gebraucht. Es kann wie das griechische Verb dokein im Sinne von ‚was jemand meint‘ oder ‚was jemanden gut dünkt‘ gebraucht werden ([68]; [69]). Bei Platon und in der Stoa steht der Ausdruck Dogma für eine feststehende Aussage im Sinne von decretum und bildet die Voraussetzung und die Grundlage des ethischen Verhaltens. Die stoische Grundüberzeugung der göttlichen Vorsehung, welche das Universum durchwaltet, wird als Dogma verstanden. In diesem Sinne spricht noch Johannes Calvin vom dogma stoicum. Der Ausdruck meint hier also so viel wie feststehende Lehrmeinung ([76]). Und solche dogmata gab es auch in anderen antiken Philosophenschulen.
Historische Entwicklung des Dogmabegriffs
Dieser Sprachgebrauch von Dogma findet sich auch in den biblischen Schriften. In der Septuaginta und im Neuen Testament bezeichnet der Ausdruck dogma fixierte gesetzliche Bestimmungen. So können die Einzelgebote der Thora dogma genannt werden (Kol 2,14; Eph 2,15) oder obrigkeitliche Verordnungen (Lk 2,1). In allen diesen Fällen meint das Wort Dogma keine Lehraussage oder Offenbarungswahrheit, sondern rechtlich-gesetzliche Bestimmungen. Erst im 2. Jahrhundert wird der stoische Begriff des Dogmas als einer feststehenden Lehraussage von den christlichen Apologeten aufgenommen. Justin bezeichnet die Dogmen der Philosophenschulen als partikular. Sie seien weder göttlichen Ursprungs noch alt. Damit fehlen den Dogmen der Philosophen für Justin die Merkmale der Wahrheit. Der Ausdruck Dogma steht hier für die Kennzeichnung der falschen und damit häretischen Lehre. In diesem Sinne verwendet auch Augustin das Wort, und als Bezeichnung für häretische Lehren wird es bis in die Neuzeit verwendet.
Auf die christliche Lehre wird der Begriff Dogma von Origenes angewandt. Er versteht die kirchliche Lehre als die wahre Philosophie und bezeichnet sie als dogmata theou. Durch die Verschränkung von hellenistischer Philosophie und überlieferter christlicher Religion bildet sich die Vorstellung von Lehrsätzen heraus, welche den Inhalt der christlichen Wahrheit in verbindlichen Sätzen formulieren. Solche identitätsstiftenden Fixierungen werden in Krisenzeiten notwendig, wenn die kulturelle oder religiöse Identität einer Gruppe durch äußere oder innere Pluralität gefährdet ist. Angesichts steigender gesellschaftlicher Komplexität in der hochgradig pluralistischen religionskulturellen Lage in der Antike, und zwar sowohl innerhalb als auch außerhalb des äußerst heterogenen frühen Christentums, antworten dogmatische Lehrfixierungen ebenso wie die Kanonisierung von heiligen Texten auf die Frage „Wonach sollen wir uns richten?“ (Jan Assmann). Durch derartige Fixierungen, die immer das Resultat von kulturellen und religiösen Selektionsprozessen darstellen, wird die Grenze zwischen dem Eigenen und dem Fremden gezogen. Die Unterscheidung von Orthodoxie und Häresie entsteht folglich erst durch solche normativen Grenzziehungen. Auch die Identität des Christentums resultiert aus dem Prozess von Exklusion und Inklusion und liegt nicht als positive Gegebenheit vor. Die Herausbildung des Dogmas als verbindlicher kirchlicher Lehre im antiken Christentum lässt sich religionstheoretisch als eine normative Konstruktion der eigenen religiösen Identität durch Grenzziehung und Unterscheidung zum Fremden und Anderen verstehen, welches dann als falsche Religion oder als Häresie gilt ([73], Sp. 895). Diese Funktion hat auch die berühmte Formel des Vinzenz von Lerinum in seinem Commonitorium pro catholicae fidei antiquitate et universitate aus dem Jahre 434. Katholisch und damit verbindlich zu glauben sei, „quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est“ („was überall, immer und von allen geglaubt worden ist“). Das Dogma sei, so Vinzenz von Lerinum, von Gott offenbart und der Kirche anvertraut, so dass es als Auslegungsnorm der Bibel fungiere. Erst in der Neuzeit, in Folge von Reformation und Aufklärung, kommt diese Formel des Vinzenz von Lerinum wieder zu Ehren. Die mittelalterliche Theologie hatte allerdings nicht an diesen Begriff des Dogmas als Bezeichnung der kirchlichen Lehre angeknüpft. Sie sprach von articuli fidei.
Zentralfunktion der Bibel
Auch die Reformatoren bezeichneten die kirchliche Lehre nicht als Dogma oder Dogmen, sondern als articulus fidei. Infolge seiner Auseinandersetzung mit der römischen Kirche rückte bei Luther zunehmend die Bibel in den Rang einer sowohl der Kirche als auch dem kirchlichen Lehramt übergeordneten Norm. In seiner Assertio omnium articulorum von 1520 erklärt Luther, dass man „mit der Schrift als Richter ein Urteil fällen“ müsse, was aber nur möglich sei, wenn man der „Schrift in allen Dingen“ „den ersten Rang“ einräumt. Nur die Bibel sei, wie Luther fortfährt, „durch sich selbst ganz gewiss“, „ganz leicht zugänglich, ganz verständlich, ihr eigener Ausleger, alles von allen prüfend, richtend und erleuchtend“ ([22], Bd. 7, S. 97 = [25], Bd. 1, S. 79–80). Mit der in eine theologische Prinzipienfunktion einrückenden Heiligen Schrift verbindet sich nicht nur eine Reduktion der lehramtlichen Fixierung der Glaubensartikel, sondern Luther bestreitet der Kirche geradezu, dass sie die Vollmacht hätte, Glaubensartikel zu schaffen ([22], Bd. 6, S. 508 = [25] Bd. 3, S. 23). Vielmehr sind alle Glaubensartikel in der Heiligen Schrift niedergelegt. Dass die aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen in ihre Bekenntnisschriften, denen freilich nicht der Rang von kirchlichen Dogmen zukommt, die altkirchlichen Symbole und damit die überlieferte Trinitätslehre und Zwei-Naturen-Christologie aufgenommen haben, ist vor allem dem Umstand geschuldet, dass Luther die altkirchlichen Symbole als schriftgemäß einstufte.
Glaubensartikel
Die lutherischen und reformierten Theologen des alten Protestantismus thematisieren die Glaubensartikel, die articulos fidei, am Ende der Prolegomena der Dogmatik. Darin folgen sie der von Luther vorgenommenen Überordnung der Bibel als der grundlegenden Norm (norma normans) von Theologie und Kirche und verstehen die Glaubensartikel als Zusammenfassung und Auslegungsregel der Bibel. Mit articulus fidei bezeichnete man den gesamten Inhalt der geoffenbarten Bibel. Dieser Inhalt der Offenbarung besteht jedoch nach der Auffassung der alten Dogmatiker des Protestantismus aus einzelnen Lehrsätzen und diese bezeichnen sie als die articulos fidei. In diesem Sinne definiert der spätorthodoxe Theologe David Hollaz die Glaubensartikel als den Inbegriff dessen, was der Christ zu glauben hat ([17] Proleg. II. q. 12). Insofern bilden die Glaubensartikel als Lehrsätze den Inhalt, der in der materialen Dogmatik behandelt wird. Zwar stammen die Glaubensartikel aus der Bibel, aber deren systematische Zusammenstellung ist das Werk des Theologen. Deshalb haben die Glaubensartikel den Status von Konklusionen, die aus dem in der Bibel niedergelegten Wort Gottes gefolgert werden. Diesen Inhalt der Dogmatik, verstanden als Schlussfolgerungen aus dem Wort Gottes, nennen die alten Theologen Dogma.
Von den Glaubensartikeln, welche in der Dogmatik in ihrem inneren Zusammenhang dargestellt werden, unterscheiden die altprotestantischen Theologen die kirchlichen Symbole. Darunter verstehen sie die Gesamtheit der Glaubensartikel, wie sie von der Kirche aufgestellt wurden. Die Symbole, denen in der lutherischen Orthodoxie eine hohe Bedeutung zukam, haben also die Funktion von öffentlichen Glaubenszeugnissen. Sie wollen darüber Auskunft geben, wie die Offenbarung zu einer bestimmten Zeit in der Kirche verstanden worden ist. In diesem Sinne heißt es in der Formula Concordia: „Die andere Symbola aber und angezogene Schriften sind nicht Richter wie die Heilige Schrift, sondern allein Zeugnis und Erklärung des Glaubens.“ Im Unterschied zur Bibel als norma normans sind die Symbole lediglich norma normata. Ihnen kommt eine abgeleitete Autorität zu und sie enthalten den rechten Sinn der Bibel. Die lutherischen Theologen unterscheiden Symbole der älteren und der neueren Zeit, nämlich die altkirchlichen und die spezifisch lutherischen Symbole.
Die Symbole der älteren Zeit sind:
1. Symbolum Apostolicum – Inbegriff der apostolischen Lehre, allmählich erwachsen aus der Taufformel als Bekenntnis der Katechumenen, festgestellt im 4. Jahrhundert
2. Symbolum Nicaenum – nach den Beschlüssen von Nicäa 325 und von Konstantinopel 381
3. Symbolum Athanasianum – als Darstellung der durch Athanasius verteidigten Kirchenlehre; seit dem 7. Jahrhundert in der abendländischen Kirche geltend.
Ältere und neuere Symbole
Diese drei altkirchlichen Symbole behielten auch im Protestantismus ihre Geltung, um die Übereinstimmung mit der alten Kirche zu unterstreichen.
Die Symbole der neueren Zeit sind:
1. Confessio Augustana – deutsch und lateinisch verfasst von Melanchthon, unterzeichnet und übergeben von den evangelischen Ständen auf dem Reichstag zu Augsburg am 25. Juni 1530
2. Apologia Confessionis – lateinisch verfasst von Melanchthon gegen die katholische Confutatio auf demselben Reichstag
3. Articuli Smalcaldici – deutsch verfasst von Luther, unterzeichnet zu Schmalkalden 1537
4. Catechismus maior et minor Lutheri – 1529, deutsch aus Veranlassung der sächsischen Kirchenvisitation
5. Formula Concordiae – um innerprotestantische Kontroversen zu entscheiden und zur Ausscheidung des Calvinismus; verfasst von Jakob Andreä (1528–1590), Martin Chemnitz, Nikolaus Selnecker (1530–1592), David Chyträus (1531–1600) und Andreas Musculus (1514–1581) zu Klosterbergen 1579.
Diese Symbole sind zusammengefasst in der Concordia (Liber Concordiae), welche mit Vorrede und Unterzeichnung der evangelischen Stände der Kurfürst 1580 zu Dresden herausgab. Allerdings wurde lediglich die Confessio Augustana von allen lutherischen Kirchen anerkannt, während die Formula Concordiae von mehreren lutherischen Landeskirchen verworfen wurde.
In der weiteren Entwicklung des Protestantismus wurde der Begriff ‚Dogma‘ immer mehr als unzulänglich zur Beschreibung der normativen Gehalte der christlichen Religion verstanden, und im Zuge der Auseinandersetzung mit der Reformation und der Aufklärung gewinnt er in der römisch-katholischen Kirche einen immer höheren Stellenwert. Bestimmend wird in der römisch-katholischen Kirche die Fassung, die dem Dogma Vinzenz von Lerinum gegeben hat, dessen Commonitorium pro catholicae fidei antiquitate et universitate 1528 neu ediert wird. Aber erst im 19. Jahrhundert setzt sich im Sprachgebrauch der römisch-katholischen Kirche der von Vinzenz geprägte Begriff des Dogmas gegenüber der älteren Bezeichnung articulus fidei durch. Im Gefolge des I. Vatikanischen Konzils wird unter dem Dogma ein Lehrsatz verstanden, der Kraft kirchlicher Sanktion oder direkter göttlicher Offenbarung Unfehlbarkeit beansprucht. Dem von dem kirchlichen Lehramt formulierten Dogma, und nur diesem, kommt für den Glauben des Einzelnen bindende und verpflichtende Autorität zu.
Abgrenzung gegen den Katholizismus
Ein solches Verständnis des Dogmas ist im Protestantismus schon aus dem Grund nicht denkbar, weil er keine kirchliche Instanz kennt, die in der Lage wäre, ein solches Dogma verbindlich zu definieren. Auch dort, wo man innerhalb der protestantischen Theologie auf den Begriff des Dogmas zurückgreift, kann er nicht im Sinne eines von der Kirche mit quasi göttlicher Autorität formulierten Lehrsatzes verstanden werden. Protestantische Theologen wie Adolf von Harnack, Wilhelm Herrmann oder Ernst Troeltsch haben deshalb auf dem Hintergrund seiner neuzeitlichen Entstehungsgeschichte den Begriff Dogma als spezifisch katholischen Begriff für die protestantische Glaubenslehre abgelehnt ([84]). Der Ablehnung und berechtigten Kritik am Begriff des Dogmas auf dem Hintergrund seiner historiographisch rekonstruierten Problemgeschichte einerseits und seiner römisch-katholischen Fassung andererseits geht es freilich auch dem Protestantismus um eine normative Selbstreflexion der eigenen Religionskultur.