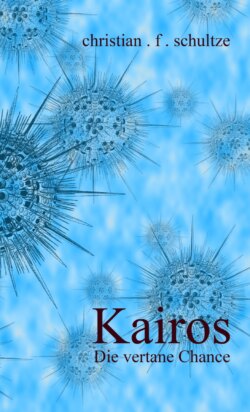Читать книгу Kairos - Christian Friedrich Schultze - Страница 4
2. Die Flucht
ОглавлениеAm ersten Bankomaten bekam sie problemlos das übliche Limit von fünfhundert Dollars ausgeworfen. Ihr Konto hatten sie also noch nicht gesperrt! Dennoch war ihre Visacard für sie nun wertlos geworden. Ab sofort musste sie im Land des Plastikgeldes versuchen, allein mit Bargeld weiterzukommen. Höchst besorgt eilte sie weiter.
Zwei Straßenecken abwärts befand sich, wie sie sich vage erinnerte, ebenfalls ein Automat. Im milchigen Morgenlicht der smogerfüllten Chinatown trabte sie im Laufschritt die fast noch menschenleere Stocktonstreet hinunter. Mit nur tausend Dollar in der Tasche würde sie es allerdings nicht weit schaffen, das war ihr klar. Leider hatte sie Redcliffs Rat nicht befolgt, einen größeren Bargeldvorrat für einen derartigen Notfall anzulegen. Er hatte es von Anfang an kommen sehen. Sie bereute es jetzt zutiefst, nicht auf ihn gehört zu haben. Barzahlung war suspekt in diesem Land. Wer seine Cashcard nicht benutzte, signalisierte Probleme. Nur große, illegale Geschäfte wurden bar abgewickelt. Sonst zahlte man mit Plastik. Das würde für die nächste Zeit eines ihrer größten Probleme werden.
Sie hatte nicht geglaubt, dass sie es so schnell realisieren würden. Als sie in den Katakomben der Ranch ihren illegalen Bericht erstellt und in mehreren gefährlichen Nachtsitzungen Daten und Kopien von den Filmen der Anunnaki gezogen hatte, war sie nicht einmal übermäßig nervös gewesen. Irgendwie hatte sie stets gemeint, dass sie und Redcliff für Pegasus unantastbar und unverwundbar seien. Sie hatte gedacht, dass der Geheimdienstmann denen himmelhoch überlegen und stets fähig und mächtig genug sei, sie vor deren Zugriff und auch sonst vor allem Unheil beschützen zu können. Immerhin war er der zweite oder dritte Mann bei der CIA gewesen.
Sie besaßen jedoch offenbar mehr Macht und Einfluss, als sie es hatte wahrhaben wollen. Und sie hatten zu schnell bemerkt, dass Li Hui an einem Transfer zu einem anderen Ufer arbeitete. Arik Ben Whitestones Leute waren ebenso gefährlich wie charmant! Und obwohl ihr Redcliff eine Menge von jenen Tricks beigebracht hatte, mit denen man seine Arbeitsspuren an einem Computerarbeitsplatz bestmöglich beseitigen konnte, waren derartige Manipulationen vielleicht gerade der Auslöser für eine besondere Überwachung ihrer Aktivitäten in Area 51 und am SRI durch die Sicherheitsleute von Pegasus gewesen.
Sie musste nun schnellsten heraus aus Friscos Chinatown. Ihre Operationsbasis war vollständig zusammengebrochen. Wie lange mochten sie wohl ihr altes Schlupfloch schon kennen, in dem sie sie heute Morgen überrascht hatten? Welcher von ihren Verbindungsleuten waren ihnen in die Hände gefallen? Jedenfalls war es nun auch ziemlich gleichgültig, wenn sie über das Bankennetz die zusätzliche Information erhielten, dass sie ganz in der Nähe des morgendlichen Überfalls noch zweimal Geld gezogen hatte. Nach der nächtlichen Flugzeugsprengung, mit der sie Redcliff umgebracht hatten, mussten sie auch sie schnellstmöglich loswerden. Deshalb jagten ihr jetzt sicher nicht nur ein paar asiatisch verkleidete Gunmen hinterher, wie vor wenigen Stunden, sondern jetzt würden sie versuchen, das Stadtviertel hermetisch abzuriegeln, um sie durch ein paar ihrer Spezialkräfte systematisch aufspüren zu können. Höchstwahrscheinlich hatten sie bereits damit begonnen.
Im ersten geöffneten Eckladen an der Bush Street wechselte sie ihre Oberbekleidung und kaufte sich außerdem eine robuste Umhängetasche aus Leinen und eine Sportmütze, unter der sie ihre schweren, langen Haare verbergen konnte. Sie trug jetzt ein dunkelblaues T-Shirt und darüber eine grau und rot abgesetzte Outdoorjacke, die eine Anzahl Außen- und Innentaschen besaß. Ihre leichte Trainingshose und ihr verschwitztes graues T-Shirt, welches sie im Morgengrauen, als der Angstschrei ihres Herbergsvaters sie unsanft geweckt hatte, in Sekundenschnelle übergestreift hatte, bevor sie aus dem zweiten Stock des Hauses gesprungen und durch die Hintergärten geflüchtet war, warf sie in den nächstbesten Müllcontainer.
Während sie überlegte, was sie weiter tun musste und im Laufen die Reisröllchen verzehrte, die sie zusammen mit einer Flasche Wasser an einem Kiosk gekauft hatte, stiegen in ihr die Erinnerungen an ihre Fluchttage in Kairo hoch. Das war in Frühjahr 2011 gewesen und das hier war ein fast perfektes Déjà-vu-Erlebnis.
Nachdem sie damals in jenem koptischen Kloster in der westlichen Wüste, in welchem man sie nach ihrem Labyrinthabenteuer gefangen hielt, versehentlich drei Männer der CIA oder des Mossad getötet hatte, war sie unversehrt aus dem Wadi Abu Mingar bis in die Ägyptische Hauptstadt gelangt und hatte dort verzweifelt auf Redcliffs Hilfe gewartet. Nur, dass sie diesmal niemanden umgebracht hatte. Aber dafür hatte sie ihren Freund Jeremias Redcliff in der vergangenen Nacht für immer verloren. Und Pegasus hatte ihn auf dem Gewissen, da war sie sich sicher. Doch völlig unsicher war sie sich, was sie als Nächstes tun sollte.
Wahrscheinlich war es das Beste, wenn sie versuchte, sich per Autobus oder Truckstop in Richtung Florida abzusetzen. Einen Flieger zu nehmen, war einfach zu riskant. Flugzeugterminals konnten zu problemlos überwacht werden. Drüben in Oakland, jenseits des Sunds, gab es einen großen Busbahnhof. Dort konnte sie erkunden, welche Busrouten von hier an die Ostküste nach Florida führten.
Hier an der Bay, als sie noch für die NSA am Caltech und am MTI arbeitete, hatte sie einige Jahre mit diesem Deutschen zusammengelebt. Dennoch wusste sie von dem riesigen Land ihrer Träume und ihrer Liebe immer noch herzlich wenig. Deshalb hatte sie bis jetzt auch keinerlei Plan, wie sie den Häschern der Pegasus-Organisation endgültig entkommen und die Vereinigten Staaten unerkannt verlassen konnte. Ihre Identität als Jung Fu, die amerikanische Archäologin, die sie seit ihrer Zeit an den ägyptischen Königsgräbern auch hier benutzt hatte, war nun verbrannt. Und ihre Originalpapiere und ihre Versicherungskarte, die sie als Wissenschaftlerin und Angestellte der Stanford University namens Li Hui auswiesen, lagen in ihrer Wohnung an der Bay, oben in Palo Alto, versteckt. Doch auch die hätten ihr nichts mehr genutzt, denn sie kannten beide Identitäten. Sie brauchte völlig neue Papiere. Ihr blieb nur noch eine Chance und sie hoffte inständig, dass sie der einzigen Verbindung, die ihr noch verblieb, nicht bereits auf der Spur waren.
Li Hui blickte mittlerweile auf ein neununddreißigjähriges, bewegtes Leben zurück. Ihre Schönheit, die sie von ihrer taiwanesischen Mutter geerbt hatte, war noch längst nicht verblichen. Für eine Chinesin war sie mit 1,68 Metern ziemlich groß. Noch immer war sie sportlich durchtrainiert und in einigen Kampfkünsten des Wushu gut bewandert. In der letzten Zeit war sie allerdings zu selten zum Trainieren gekommen. Durch die Qualen ihrer Gefangenschaft in Ägypten waren ihre körperlichen Konturen härter und, wenn es so etwas gab, strenger geworden. Man konnte sie jetzt beinahe als hager bezeichnen. Ihre Haare, welche man ihr gleich nach ihrer Festnahme in Kairo abgeschoren hatte, waren in den inzwischen vergangenen drei Jahren wieder bis über Schulterlänge nachgewachsen.
Sie liebte ihren blauschwarzen, festen Kopfschmuck und war der Meinung, dass man auf diese Weise seine Frisuren und damit sein Aussehen viel variationsreicher verändern konnte. Dies war schon manchmal von Vorteil für sie gewesen. Li Huis Haut besaß auch immer noch diesen mattglänzenden, hellbronzenen Teint, der die Männer ihrer Umgebung stets so angezogen hatte. Doch ihre hellbraunen Augen blickten neuerdings oft traurig in die Welt und hatten ihren früheren, optimistischen Glanz beinahe verloren. Und das lag nicht nur daran, dass die Zeiten lange vorbei waren, als die taiwanesischen Jungens und Medien hinter ihr her waren, weil sie im Alter von fünfzehn Jahren, als sie noch aufs College ging, gleich im ersten Anlauf ihrer damaligen Bewerbung Miss Taipeh wurde.
Schon früh in ihrer Schulzeit hatte sich herausgestellt, dass Li Hui eine außergewöhnliche Begabung für Kalligraphie und für Mathematik besaß. Aber auch in musischen Dingen hatte sie von ihren Vorfahren gute Anlagen mitbekommen. Anfangs meinte sie, dass es mehr die Musik, als die Naturwissenschaft war, die ihr wirklich zusagte. Ihre Eltern, die als wohlhabende Taiwanesen an Mitteln für ihre Ausbildung nicht sparen mussten, schickten sie deshalb zusätzlich zu einer privaten Violinausbildung. Klassische Europäische Musik war in den neunziger Jahren auf der Insel große Mode geworden. Li Hui spielte bald im Schulorchester mit und übernahm sogar manchen Geigen-Solopart, wenn dieses Orchester öffentlich auftrat.
Als sie dann vor der Entscheidung stand, für ihr zukünftiges Leben zwischen Musik und Wissenschaft wählen zu müssen, hatte sie sich dann doch für die Mathematik entschieden. In ihrem Innersten war ihr klar geworden, dass sie diesen unbändigen Drang zur Selbstquälerei des unablässigen Übens an diesem besonderen Streichinstrument nicht besaß. Und den musste man unbedingt besitzen, wenn man es zu einem konkurrenzfähigen Solostar bringen wollte.
Nach ihrem Collegeabschluss begann sie deshalb auf ihren Wunsch, und unterstützt von ihrem Vater, mit einem Studium der Mathematik an der National Taiwan University. Das war im Jahr 1994 gewesen. Es dauerte jedoch nicht lange, und in ihr entwickelte sich eine triebhafte Vorliebe für alte Schriften und Sprachen. Zunächst hing es hauptsächlich mit ihrem besonderen Faible zur chinesischen Kalligraphie zusammen.
Sie fand diese uralte Schreibkunst des Reiches der Mitte formvollendet, schön und kunstreich wie keine andere und bemühte sich, darin eine besondere Meisterschaft zu erlangen. Alsbald fing sie an, sie mit anderen alten Kalligrafien Handschriften zu vergleichen. Mit dem Studium der wunderbaren arabischen und persischen Schriften gelangte sie natürlich alsbald zu den geheimnisvollen ägyptischen und altindianischen Hieroglyphen und schließlich zu den sumerischen Keil- und Bilderschriften. Damit war sie bei den ältesten bislang bekannten Schriftformen angekommen und Li Hui beschloss, ein Hauptgewicht ihrer Studien auf das Erlernen alter Sprachen und die Entzifferung ältester Schriften zu verlegen. Sie war im übrigen davon überzeugt, dass ihr mathematische Methoden und moderne Rechnerleistungen wertvolle Hilfe bei der Entschlüsselung der vielen ungelösten Rätsel der schriftlichen Überlieferungen des Altertums bieten konnten.
Bald aber interessierte sie sich auch für die bemerkenswerten Botschaften, die solche Texte enthielten. Sie überlegte, ob sie neben diesen Schrift- und Sprachstudien auch noch ein Studium in alter Geschichte beginnen sollte, entschied nach langem inneren Kampf aber, dass dieses Interesse vorerst zurückstehen musste. Alles zugleich ging einfach nicht, obwohl sie doch so überaus neugierig und wissensdurstig war. Das Studium der Mathematik wollte sie aber trotz ihres Sprachenfables mit Schwerpunkt Kryptologie weiter beibehalten und möglichst kurzfristig abschließen, wenn sie es durchhielt. Um ihrem neu gewählten Forschungsgebiet und den prähistorischen Quellen näher sein zu können, überzeugte sie ihre Eltern, ihr weiteres Studium in Kairo durchführen zu dürfen.
Im Herbst 1998, mittlerweile 24 Jahre alt, hatte sich Li Hui an der Amerikanischen Privatuniversität von Kairo eingeschrieben. Dass Taiwan-Chinesen an einer amerikanischen Privatuniversität alle möglichen Fächer studierten, war Ende des 20. Jahrhunderts nichts Ungewöhnliches. Dass eine Chinesin in Ägypten arabisch lernen sowie Hieroglyphen und sumerische Keilschriften entziffern wollte, schon.
Es dauerte einige Zeit, bevor Li Hui die ersten Kontakte zu einigen der zahlreichen Studenten aus aller Herren Länder knüpfte. Sie beobachtete ihre Kommilitonen genau und war sehr vorsichtig in der Auswahl ihrer Bekanntschaften. Erst nach einem halben Jahr schloss sich Hui der dortigen chinesischen Kolonie an und begann nach einigen Monaten sogar, eine behutsame Freundschaft mit Jiang Ju, einer fast dreißigjährigen Studentin für Geschichte der Antike, aufzubauen. Dass Jiang Ju sich später als eine Spezialagentin der Rotchinesen entpuppte, hatte dann ihr Leben in eine vollkommen andere Richtung gesteuert.
Li Hui, die stets sehr zurückhaltend agierte und deswegen von den meisten Mitmenschen ihrer Umgebung, die sie nicht näher kannten, als arrogant eingestuft wurde, hatte anderseits, wenn sie wollte, nur geringe Probleme, Menschen für sich zu gewinnen. Dabei halfen ihr sowohl ihr außerordentlich attraktives Aussehen, ganz besonders aber ihre Möglichkeiten, mit ihrem Instrument eine künstlerisch-beruhigende Atmosphäre um sich zu verbreiten, die auf die meisten ihrer Kommilitonen äußerst anziehend wirkte.
Hin und wieder lud Li Hui ihre Freunde und Kommilitonen zu kleinen abendlichen Violin-konzerten in einen gut geschützten, schattigen Seitenhof der Universität ein. Sie hatte sich bald zum Mitmachen im internationalen Orchester der Uni entschlossen. Ihre teure Violine, die ihr ihre Familie zu ihrem 21. Geburtstag geschenkt hatte, war seit jenem Tag der Volljährigkeit ihre treue Begleiterin an alle Orte geblieben, in denen sie ihr unruhiges, aufregendes, aber überwiegend auch einsames Leben verschlagen hatte.
Diese wertvolle Geige hatte sie wegen ihrer überstürzten Flucht nun zum dritten Mal zurücklassen müssen. Sie fragte sich, ob es noch einmal in ihrem Leben jemanden geben würde, der ihr dieses herrliche Instrument, das auf eine merkwürdig mystische Art stets wie eine treue Freundin gewesen war, erneut zurückbringen würde, so wie es Jeremias Redcliff im Oktober 2011 bei ihrer zweiten Begegnung in Kairo getan hatte.
Li Hui´s Reise an die Ostküste zog sich nach dem erzwungenen Aufbruch aus der Chinatown von San Francisco nicht nur einige Tage, wie sie zu Beginn gedacht hatte, sondern mehrere Wochen hin. Sie glaubte, auf diese Weise ihre Spuren ausreichend verwischen zu können. Jeremias Redcliff hatte ihr einige Adressen von Exilkubanern in Miami genannt, die als Schmuggler tätig waren und die gegen gute Dollars illegale Transfers mit leistungsfähigen Schnellbooten von und nach der Zuckerinsel durchführten. Darum musste sie unbedingt zu den Keys, um dort drüben an der Ostküste jemanden für ihre geheime Überfahrt zu finden.
Nachdem sie den Killerkommandos glücklich entkommen war, hatte Li Hui die Chinatown im morgendlichen Menschengewühl unentdeckt hinter sich lassen können und war bis hinunter zur Powell-Street-Station gelangt, ohne dass sie noch irgendwie behelligt worden war. Dann war sie in den dortigen Passagierströmen untergetaucht und mit der BART, der Friscoer U-Bahn, bis hinüber zum Oakland-City-Center gefahren. Vom großen Terminal aus hatte sie noch am gleichen Abend ein Ticket für den Nachtbus der US-Asia-Linie gelöst, mit welchem sie überraschend pünktlich am nächsten Morgen sieben Uhr an der Monterey Park Station, im noch dunstigen Los Angeles, angekommen war.
Nachdem Li Hui ihr erstes Ziel, die Chinatown von L.A. erreicht hatte, atmete sie trotz des Smogs, der über der Stadt lag, erst einmal tief durch, um anschließend vorsichtig die Lage zu sondieren. Es dauerte nicht lange, die Straße zu finden, in der ihr Großcousin früher gewohnt hatte. Aufmerksam beobachtete sie alle Passanten und Autos in der Umgebung seines unscheinbaren Hauses, bevor sie es betrat.
Xing-Hu Kuo, ein Vetter ihrer Mutter, lebte mit seiner großen Familie tatsächlich noch in seinem alten chinesischen Fachwerkhaus. Er besaß trotz seines fortgeschrittenen Alters und verschiedener Gebrechen immer noch gute Beziehungen zu einigen Bossen der Latino-, Afro- und Chinesencliquen aus den Ganglands der Riesenstadt. Nachdem sie ihm ihre nahezu aussichtslose Lage geschildert hatte, machte er sich in einer alten Fahrradrikscha, die ein halbwüchsiger Enkel bediente, auf , um einige Besuche zu absolvieren. Für derlei Operationen scheute der Chinese das Telefon, wie der Teufel das Weihwasser.
Nach ein paar Tagen übergab er Li Hui ein so genanntes Darlehen von zwanzigtausend Dollar und einen neuen Pass der Volksrepublik China mit einem gültigen Einreisevisum. Eines Tages, da sei er sicher, werde Li Hui dieses Darlehen an ihn zurückzahlen. Und wenn sie es nicht könne, werde Gott es ihm vergüten, meinte der alte Mann. Bessere Papiere hätte ihr auch der "Admiral", wie Jeremias Alban Redcliff in seiner Behörde immer genannt worden war, nicht beschaffen können. Aber der war seit zwei Tagen tot, und diese unumstößliche Tatsache traf sie erst hier, nachdem sie die unmittelbarste Gefahr überstanden hatte, mit voller Wucht. Ihre Wut auf Pegasus war grenzenlos. Doch auf ihrer Irrfahrt durch die südlichen Staaten des Imperiums wurde diese irre Rage bald durch ein lang anhaltendes, tieftrauriges Gefühl verdrängt und ihre Vernunft gewann allmählich wieder die Oberhand.
Natürlich war es höchst riskant gewesen, zu ihrem Großcousin nach L.A. zu fahren, denn es war gut möglich, dass sie von seiner Existenz wussten. Aber sie hatte keine Wahl gehabt. Und bis hierher war auch alles gut gegangen. Sie vertraute darauf, dass sie nichts aus ihm herausbekämen, wenn sie doch noch auf ihn stoßen sollten. Aus purer Vorsicht hatte sie ihm nur die nötigsten Informationen gegeben und er hatte das verstanden. Obwohl sie nun im Besitz neuer Papiere war, die sie als Du Chong, 32 Jahre alt, geboren in Hongkong, auswiesen, getraute sie sich immer noch nicht, einen Flug nach Miami zu buchen.
Sie hatte beschlossen, sich stattdessen per Bus oder Zug nach Florida durchzuschlagen. Aber die Busgesellschaft, die sie für die erste Etappe nach Flagstaff benutzen wollte, war gerade Pleite gegangen. Und aus einem reinen Bauchgefühl erschien ihr plötzlich auch eine Zugfahrt zu gefährlich. Als sie es dann auf der Interstate 40 per Truckstopp in zwei Tagen, durch die halbe Mojavewüste hindurch, bis in das einsame Nest Kingman geschafft hatte, legte sie an diesem hoch in den San Francisco Peaks gelegenen Ort erst einmal einen Tag Pause ein. Sie nächtigte in einem heruntergekommenen Motel, das ihr der freundliche farbige Trucker empfohlen hatte, der sie die letzten zweihundert Meilen mitgenommen hatte, ohne ihr irgendwie zu nahe zu treten. Es erschien ihr wie ein Wunder, dass sie bis hierher von den Pegasusleuten völlig unbehelligt geblieben war.
Sie waren nicht allmächtig, das hatte Redcliff immer wieder betont, wenn es darum ging, wie man sie bekämpfen könnte. "Immer gibt es Gegenkräfte und ´nobody is perfect´", hatte der Admiral stets gemeint, wenn sie gemeinsam die Macht der Finanztrusts, den Niedergang der amerikanischen Freiheitsrechte und die Verstrickung ihres Landes in den großen mittelasiatischen Krieg beklagten. Je umfassender eine Überwachung fast aller Bürger mit Hilfe der Elektronik möglich wurde, umso unfähiger waren sie zum Beispiel, die gewonnenen Datenmassen erkennungsdienstlich sinnvoll auszuwerten.
Gerade in den Kleinstädten des Mittelwestens war die Polizei nur schlecht bezahlt, unzureichend ausgestattet, personell schwach besetzt und mangelhaft qualifiziert. Die amerikanischen Kommunen waren inzwischen zum großen Teil pleite und es gab auf dem Lande kaum noch gute Lehrer und Polizisten. Meist waren Letztere nicht einmal in der Lage, Japaner, Kambodschaner, Vietnamesen und Chinesen wirklich auseinander zu halten. Li Hui hoffte auf den Vorteil, der sich für sie daraus ergab.
Wenn sie während ihrer Odyssee durch die Staaten hin und wieder mit Ordnungshütern in Kontakt geriet, erzählte sie ihnen die Geschichte von der arbeitslosen Chinesin Du Chong aus Wuhan, die ihre verheiratete Schwester in den USA besuchen wollte. Die Städte, in denen diese Schwester wohnen sollte, wechselten, je nachdem an welchem Stadtort sich Li Hui gerade befand. Die zumeist farbigen Polizistinnen und Polizisten waren überwiegend freundlich zu ihr. Unterbezahlt und ohne höhere Motivation gingen sie höchst selten an ihre veralteten Computer, um verdächtige Daten miteinander abzugleichen.
Im Gegensatz dazu waren die zahlreichen Geheimdienste des Landes technisch und elektronisch hoch gerüstet, verlangten nach immer neuer und sündhaft teurer Elektronik, konkurrierten untereinander aber höchst kontraproduktiv. Die Möglichkeiten der Pegasus-Leute gingen jedoch über die des offiziellen Apparates weit hinaus. Das wusste Li Hui aus der Zeit ihres Aufenthaltes in der so genannten Ranch in Area 51.
Sie überlegte, ob sie es wagen konnte, von Flagstaff aus einen Flug nach Miami zu buchen. Schließlich wollte sie so schnell wie möglich heraus aus den Staaten und hinüber auf die Zuckerinsel. Sie hatte den Kubanern Informationen anzubieten, die diese umwerfen würden. Und sie hoffte, dass ihr der legendäre Geheimdienst des schwerkranken früheren Führers Fidel Castro und seines Bruders Raúl im Gegenzug behilflich sein würde, zu ihrem Sohn zu gelangen. Das war das maßgebliche Ziel ihres Lebens und der zentrale Gedanke geworden, der sie nach all den Schicksalsschlägen und all dem Verrat, den sie erdulden musste, noch aufrecht hielt!
Ihr geschulter Instinkt riet ihr zu größter Vorsicht und hinderte sie daran, zum Clark Memorial Flugfeld hinaus zu fahren und sich einen Flug nach Orlando zu nehmen. Es lag nicht nur an der nächtlichen Katastrophe mit Redcliff, dessen Maschine sie ohne jegliche Rücksicht auf die übrigen Passagiere, die zufällig ebenfalls in diesem Unglücksflugzeug nach Washington saßen, in die Luft gesprengt hatten. Bei den gnadenlosen Körperkontrollen, wie sie seit den WTC-Anschlägen im September 2011 auch bei allen Inlandflügen an jedem Passagier, besonders aber an Ausländern, durchgeführt wurden, wäre sie mit der Menge an Bargeld, das sie mit sich führte, unbedingt in Verdacht geraten. Sie wusste, wenn sie sie in ihre Hände bekamen, würden sie den Minichip finden, so vermeintlich gut verborgen er auch unter der Hornhaut ihres rechten Fußes einoperiert war. Sie würden sie Zentimeter für Zentimeter auseinander nehmen. Sie hatte einst sorgfältig und mit quälendem Entsetzen gelesen, was die Folterärzte der amerikanischen Geheimdienste alles drauf hatten und was das CIA-Verhörhandbuch, das so genannte KUBARK, für exorbitante Befragungsmethoden empfahl.
Auf dem Truckerhof von Flagstaff hatte Li Hui einen gemütlichen Schwarzen kennengelernt, der mit gebrauchten Autos handelte. Ziemlich spontan kaufte sie ihm für vierhundert Dollar einen geräumigen, neun Jahre alten, Ford ab und besorgte sich in der Stadt ein kleines Zelt, einen Schlafsack und einige Campingutensilien. Und dann fuhr sie los, zunächst immer die Interstate 40 entlang, die zuweilen auf der legendären Route 66 verlief, immer in Richtung Florida.
Auf diesem Teilstück war der Highway recht komfortabel ausgebaut und Li Hui kam zügig voran. Memphis am Mississippi war ihr nächstes Ziel. Bei herrlichstem, klaren Herbstwetter durchquerte sie mit dem alten Kasten auf der unendlich scheinenden, große Strecken schnurgerade verlaufenden, Straße die südlichen Staaten Arizona, New Mexico, Texas, Oklahoma und Arkansas, bis sie am östlichen Ufer der zentralen Wasserstraße des Imperiums, des Vaters aller nordamerikanischen Ströme, angelangt war. Wäre sie nicht auf der Flucht und voller Trauer um ihren getöteten Freund gewesen, hätte diese Fahrt eine der schönsten Reisen ihres Lebens werden können.
Aber ihr Kummer wegen des Verlustes ihres Liebsten und verlässlichen Freundes verstärkten nur noch das Gefühl ihrer Einsamkeit, während sie die Schönheit des Herbstes und der Herrlichkeiten der Natur dieses Landes, dem sie einst dienen wollte und aus dem sie jetzt verstoßen wurde wie eine leprainfizierte Kranke, begierig in sich aufnahm. Die Widersprüchlichkeit zwischen ihrer Traurigkeit und den Schönheiten des nordamerikanischen Kontinents hätte für sie nicht schmerzhafter sein können. Und irgendwie war dann dieses denkwürdige abendliche Erlebnis auf einem Parkplatz unweit des berühmten Fort Smith eine seltsame Art von innerer Befreiung gewesen, wenn sie auch die Tage danach ständig Befürchtungen hegte, dass ihr Pegasus deswegen erneut auf die Spur kommen könnte.
Die Dämmerung war bereits eingetreten, als Li Hui endlich den Zeltplatz ausgangs des Kerr Lakes, unweit des Arkansas River, gefunden hatte. Sie war gerade damit beschäftigt, ihr winziges Zelt aufzustellen. Der kleine Campingtisch und zwei einfache Klappstühle aus Segeltuch standen bereits neben dem Heck des alten Ford. Nur die sich selbstaufblasende Isomatte machte momentan alles andere, als sich vorschriftsmäßig zu öffnen.
Langsam und fast geräuschlos kam ein offener Buick, ein schönes altes, cremefarbenes, wenn auch sehr rostiges Modell, mit vier unternehmungslustig darin lümmelnden farbigen Jungens die schmale Straße herauf, welche von der Interstate zum Campingplatz führte. Dicht am wackeligen Holzzaun, der den Parkplatz vom Campingareal trennte, hielten sie an. Es sah aus, als ob die Jungs hier öfter vorbeikommen würden. Vielleicht auch nur, um im kleinen Drugstore des Campingplatzes am diesem Freitagabend ein paar Bier zu trinken, weil anderswo in der Umgebung noch weniger los war.
Die Halbstarken hatten, während sie einer nach dem anderen den Buick verließen, das mit vereinzelten Weymutskiefern bestandene Gelände kurz inspiziert und die einsame Li Hui neben ihrem Ford schnell ausgemacht. Sie beobachteten die Chinesin zunächst ein paar Minuten bei ihrer Arbeit, bevor sie sich entschlossen, lässig mit den Hüften wippend, zu ihr hinüber zu schlendern.
Der Dialog verlief wie immer, wenn sich so etwas anbahnte, aufreizend eindeutig und primitiv. Li Hui wirkte schmal, jung und hilflos in ihren hellen Trainingshosen und dem locker übergestreiften, ockerfarbenen Baumwoll-T-Shirt. Ihr volles, schwarzes Haar hatte sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, der ihr vom Nacken vorn über die Brust herabhing, während sie sich noch immer mit der Luftmatratze plagte. Die widerspenstige Matte in den Händen drehend, forderte sie die aufdringlichen Jungens betont freundlich auf, dass sie verschwinden und sie in Ruhe lassen sollten. Sie war sich nicht ganz sicher, ob sie den richtigen Ton getroffen hatte. Kichernd und fröhlich herumtänzelnd gaben die vier Rabauken vor, ihr doch nur helfen zu wollen. Schließlich sei es für ein Mädchen wie sie viel zu kompliziert, solch eine Campingbehausung aufzubauen. Man hätte ja gesehen, wie sie sich mit der Isomatte abquäle. Und sie sei ja auch so alleine.
Li Hui erwiderte, dass ihr Freund nur zur Toilette gegangen sei und jeden Augenblick zurückkehren werde. Die Jungs glaubten ihr natürlich nicht und lachten. Sie hatten die Lage längst überblickt. Das unscheinbare Go-In und die Sanitärbaracke waren von hier etwa dreihundert Meter entfernt. Die kleine Holzhüttensiedlung, die ebenfalls zum Campingplatz gehörte, befand sich auf der anderen Seite der Einfahrtstraße und der sozialen Einrichtungen. Die beiden einzigen Zelte, die noch zwischen den Bäumen standen, waren momentan leer.
Ob sie schon länger hier sei, war die nächste Frage. Sie waren um ihren Ford gekreist und hatten das Kennzeichen gemustert. Sie wussten somit, dass die Chinesin nicht aus Oklahoma kam. Ob sie denn keine Lust auf Sex hätte? Freitag Abend hätten doch alle Lust auf auf einen schönen Fick. Sie wären gut darin und sogar zu viert. Da wäre für sie doch ´ne Menge drin!
Li Hui sah sich suchend um. Am nächsten Zelt, dass vielleicht dreißig Meter entfernt stand, kam gerade ein junger Mann an, der wohl Duschen gewesen war. Er schaute einen Augenblick lang interessiert herüber, verschwand dann aber im Innern seiner Behausung. Er wollte damit nichts zu tun haben! Vier gegen eineinhalb, unmöglich!
Li Hui forderte die vier Stänkerer noch einmal auf, sie in Ruhe zu lassen, sonst würden sie es sicher bereuen. Die Boys lachten über diesen Witz laut und lange. Vier junge, starke, abenteuerlustige Oklahomajungs sollten irgendetwas bereuen, was mit einem kleinen, einsamen Asiatenmädel zu tun hatte! Das war doch zu lustig! Einer zog ein Jagdmesser und ließ es im Abendlicht blitzen.
Er hatte die tänzerische Bewegung Li Hui´s noch nicht einmal gesehen, als der Außenknöchel ihres rechten Fußes bereits an seiner Schläfe einschlug. Der junge Mann kippte lautlos, wie in Zeitlupe, zur Seite und landete auf dem weichen Waldboden. Das Messer, welches er dabei fallen ließ, blieb in einer Wurzel stecken. Li Hui´s Unterbewusstsein schrie: "Hoffentlich ist er nicht tot, hoffentlich ist er nicht tot!..."
Der Zweite brach in der gleichen Sekunde nach einem blitzartigen Fingerknöchelkick auf seinen Solarplexus in die Knie und fiel dann vornüber auf sein Gesicht. Die beiden anderen waren einen Moment lang wie erstarrt, dann flüchteten sie mit schrillem Hilfegeschrei.
Während Li Hui in höchster Eile das Zelt abriss und ihre Sachen in ihr Auto warf, sah sie noch, wie der Typ gegenüber seinen Kopf aus dem Zelteingang steckte, ihn aber schnell wieder zurückzog. Die beiden Jungen lagen wie tot im Gras. Li Hui startete den Ford und fuhr verwirrt und mit großer Geschwindigkeit in die südliche Nacht. Es war nur noch ein Katzensprung bis hinüber nach Arkansas. Nach einer halben Stunde angstvoller Fahrt hatte sie es geschafft. Doch ihre Furcht vor Polizei und Pegasus war unbegründet. Die armen, farbigen, arbeitslosen Südstaatenboys, die ihr langweiliges, perspektivloses Leben mit einem kleinen sexuellen Abenteuer am Wochenende ein wenig aufpeppen wollten, waren weit davon entfernt, den staatlichen Behörden etwas von ihrem Fehltritt zu vermelden. Li Hui kam deshalb nach einem weiteren, sehr lang erscheinenden Tag Autofahrt am Ende des Monats September wohlbehalten, wenn auch aufgeschreckt und dadurch doppelt wachsam, in der einstigen Baumwollmetropole Memphis an.
Memphis, Tennesse! Wer nur hatte dieser Ansiedlung den Namen der einstigen nördlichen Hauptstadt des alten Ägyptens gegeben? Waren es die Spanier unter Hernando des Soto gewesen, die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts als erste Europäer auf die hiesigen Chickasaw-Indianer trafen? Oder die Franzosen, die im siebzehnten Jahrhundert ihr erstes Fort an den östlichen Steilufern des Mississippi errichteten? Oder waren die Engländer im achtzehnten Jahrhundert auf diese Idee gekommen, als sie diesen Flecken von den Franzosen erobert hatten?
Als Li Hui über die nördliche der beiden riesigen Flussbrücken fuhr, die von Westen in die auf dem Ostufer liegende Stadt hineinführten, sah sie im Licht des frühen Nachmittags zuerst die gewaltige American Memphis Pyramid aufragen und blitzen. Memphis und eine Pyramide – welches Omen! Sie wusste so gut wie nichts über diese große Stadt des Südens, aber der Strom, die Inseln und dieses merkwürdige Bauwerk machten sie neugierig und sie beschloss, sich gleich am andern Tag einen Stadtführer zu besorgen, aus dem sie etwas über Vergangenheit und Gegenwart dieser Metropole erfahren konnte. Es würde wohl kein Fehler sein, einige Tage hier abzuwarten und zur prüfen, ob sie ihr nicht doch auf die Spur gekommen waren.
Die Stadt strebte zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts nach langer Agonie wieder nach oben. FedEx war derzeit der ökonomische Dominator, von dem die meisten Arbeitnehmer der Region abhingen. Amerikas Frachtdienstleister Nummer eins, direkt am "Hub“ Memphis International Airport gelegen, hatte in der wirtschaftlichen Bedeutung die einstigen Baumwoll-, Soja- und Hartholzhändler auf die Plätze verwiesen. Aufmerksam studierte Li Hui ihren Geoguide. So erfuhr sie schließlich auch, dass in dieser Stadt einige ihrer Lieblingsmusiker, wie Elvis, Jerry Lee Lewis, Jonny Cash und B.B. King groß geworden waren.
Diese Stadt, in der man Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts während der Bürgerrechtskämpfe zwischen Schwarzen und Weißen den Baptistenprediger Martin Luther King erschossen hatten, wurde inzwischen vollkommen von Afroamerikanern und südamerikanischen Einwanderern beherrscht. Asiaten spielten hier kaum eine Rolle. Li Hui fand in dieser Halbmillionenstadt jedoch keine Chinatown, so wie sie es von Frisco und L.A. her kannte.
Sie war in einem bescheidenen, aber sauberen Motel in der Nähe des Rivermontparkes, knapp oberhalb der südlichen Mississippibrücke, untergekommen. Warum sie dann über eine Woche hier geblieben war, konnte sie sich selbst nicht schlüssig beantworten. Wahrscheinlich war es der Strom gewesen, der sie, wie alle hier, unausweichlich in seinen Bann zog. Diese zentrale Wasserstraße des Imperiums, den die indianischen Ureinwohner "Vater der Gewässer" genannt hatten und der durch zehn Bundesstaaten der Vereinigten Staaten floss, hatte sie von dem Moment an, als sie die Hernando-de-Soto-Brücke überquert hatte, auf beinahe mystische Weise beeindruckt.
Natürlich hatte sie während dieser nicht geplanten Reisepause Graceland, das Memorial des Rockkönigs Elvis Presley, und das Mississippi-Museum auf Mud Island besucht. Die Delta Queen, ein Schaufelraddampfer aus der Mark-Twain-Zeit, der hier verankert war, hatte sie dann auf die Idee gebracht, für ihre Weiterreise ein solches Riverboat zu benutzen. Sie hoffte, mit dieser gemächlichen Art zu reisen, ihre Spuren weiter verwischen zu können.
Der Herbst hatte jetzt ernsthaft begonnen, den Sommer zu verdrängen. Die Wälder auf der westlichen, der Arkansasseite, ebenso wie auf den Inseln Mud Island und Hopefield Chute, begannen bereits, ihre bunte herbstliche Färbung anzunehmen. Schon fegte mit dem einsetzenden Nordwestwind erstes schmutziges Laub durch die Straßen. Während Li Hui diese amerikanische Südstaatenmetropole für sich eroberte, nahm ihre Furcht vor Pegasus wieder zu. Besonders in ihren einsamen Nächten in dieser zweitklassigen Pension, erfasste sie tiefer Schmerz und das Gefühl grenzenloser Einsamkeit. Immer deutlicher trat ihr ins Bewusstsein, wie allein sie nun auf dieser Welt war und wie sehr ihr Jeremias Redcliff und Ning Sebastian fehlten. Nur die Hoffnung, den Sohn eines nicht allzu fernen Tages wiederzufinden, der ihr von ihren Pekinger „Freunden“ vor nunmehr fast acht Jahren genommen worden war, nährte noch ihren Überlebenswillen.
Am dritten Tag ihres Aufenthaltes in Memphis erfuhr Li Hui beim Frühstück in einem schlichten Café am Fluss von der dunkelhäutigen Bedienung, dass der Sunset Limited, eine Sonderzug auf der Eisenbahnstrecke von Los Angeles über New Orleans nach Florida, seit einem halben Jahr wieder in Betrieb war. Durch die Hurrikankatastrophe Katrina im Jahre 2005 waren große Teile der Strecke und auch einige wichtige Eisenbahnbrücken zerstört worden. Der Zug verkehrte nun wie vordem alle drei Tage auf der über viereinhalbtausend Kilometer langen Bahnstrecke von West nach Ost.
Spontan hatte sie also beschlossen, mit einem der historischen Raddampfer abwärts des Mississippi bis nach New Orleans zu schippern, um von dort ihre Reise per Eisenbahn in Richtung Orlando fortzusetzen. Sie verkaufte ihren Ford und enterte am dritten Tag eines der regelmäßig zwischen den beiden Städten verkehrenden Flussschiffe. Von Memphis bis in die südliche Hafenstadt waren es noch gut fünfhundert Kilometer Wasserweg und Li Hui war überrascht, in welch gewaltigen Bögen der große Strom durch das Land führte.
Die Pioniere der Mississippiflussschifffahrt hatten zwar bereits im frühen neunzehnten Jahrhundert versucht, den „Vater der Gewässer“ etwas zu bändigen und abschnittsweise zu begradigen. Doch trotz zahlreicher Stauwehre, Buhnen und Nebenkanäle, die von den Generationen inzwischen errichtet worden waren, änderte der Fluss in vielen seiner Teilstücke weiterhin Jahr für Jahr seinen Lauf und plagte die Anrainer zudem mit seinen unregelmäßigen Hochwassern.
Ihre Vorstellung vom Strom war in Memphis eine ganz andere gewesen, als dieser sich ihr vom Schiff aus darbot. Erst jetzt bekam sie eine Ahnung davon, wie lebendig, gefährlich und eigenständig der Mississippi in Wirklichkeit war. In der Stadt hatte sie einige Male an den Ufern und Kais gesessen, ihn scheinbar träge, breit und gleichmäßig an sich vorbeifließen sehen und dabei den vielfältigen Schiffs- und Bootsverkehr beobachtet. Von seiner Gewalttätigkeit hatte das breite Wasser ihr dabei nichts offenbart. Während der drei Tage, die diese Reise flussabwärts führte, blieb sie abends, nach der stets schnell einsetzenden Dunkelheit, auf einem der Liegestühle in eine Decke gehüllt auf dem Oberdeck liegen und beobachtete das an ihr vorüberziehende Amerika. Es waren auch Stunden intensiver Trauerarbeit, die ihr allmählich ein wenig innere Beruhigung und neuen Lebenswillen gaben.
Während der Fahrt erzählte der Kapitän der „Piasa“ den Passagieren die unsterblichen Legenden von den frühen Pionieren der Mississippischifffahrt, von den Sezessionskriegen und natürlich von Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Regelmäßig entstand dann auf dem Schaufelraddampfer eine romantische Stimmung, als wäre es der einstige Flusslotse, Journalist und Schriftsteller Mark Twain selber, der ihnen diese Geschichten erzählte. Und in solchen Stunden fragte sich Li Hui, ob es Pegasus und die Reduktionspläne des New Yorker Trusts tatsächlich gab, so entrückt von der übrigen Welt fühlte sie sich auf dem Strom und auf diesem behaglichen Schiff.
Der komfortable, alten Vorlagen nachgebaute, Dampfer glitt ruhig und gleichmäßig auf dem langen Flussabschnitt zwischen den Bundesstaaten Mississippi und Louisiana dahin. Bei Nacht und Nebel passierten sie die auf dem linken Steilufer liegende geschichtsträchtige Stadt Vicksburg und mit dem Morgengrauen Natchez. Der Kapitän, ein patriotischer Südstaatler, erzählte zum Frühstück die Geschichte von der schrecklichen Belagerung Vicksburgs durch die Unionisten im Bürgerkrieg und die fürchterlichen Qualen, die die eingeschlossen Konföderierten erduldeten, ehe sie sich nach siebenundvierzig Tagen Kampf am 4. Juli 1863 ergaben. Ströme von Blut waren in diesem Bruderkrieg geflossen, ehe der Vater der Gewässer von seiner Mündung bis zu seinen Quellen im Itascasee in Minnesota völlig uneingeschränkt passierbar geworden war und der Aufstieg der nunmehr vereinigten Staaten von Nordamerika beginnen konnte.
Der Misse sepe, wie ihn die Natives des nördlichen Teils Amerikas immer noch nannten, änderte auch in diesem letzten Viertel seines Daseins kontinuierlich Gestalt, Aussehen, Breite und Fließgeschwindigkeit. Zahllose Passagierdampfer und riesige Verbände von Schubschiffen kreuzten immerwährend ihre Fahrt. All dies und das wechselnde, teils trübe und neblige herbstliche Wetter bescherten der Crew reichlich Arbeit. Doch dann klarte der Himmel plötzlich auf und sie legten am frühen Nachmittag des 28. September 2013 bei warmem Sonnenschein an den Passagierkais von New Orleans an. Bis hierher unbehelligt geblieben und von der Dampferbesatzung freundlich verabschiedet, schulterte Li Hui ihre kleine Reisetasche, verließ den Steamer und wanderte gemächlich in die ihr unbekannte große und berühmte Stadt.
Am Bahnhof löste sie ohne Verzögerung eine Fahrkarte für den Sunset Limited nach Orlando, Florida. Dort endete der Trail dieser Eisenbahnstrecke. Wie sie von da weiter zu den Keys gelangte, würde sie in der bunten, quirligen Vergnügungsstadt der grünen Halbinsel noch rechtzeitig in Erfahrung bringen. Es herrschte ein dichtes Gedränge auf der New Orleans Amtrak Station, als der Zug in den Bahnhof einfuhr und Li Hui alias Du Chong endlich einsteigen konnte. Pünktlich sechs Uhr am Abend setzte sich der Sunset in Richtung Florida in Bewegung.