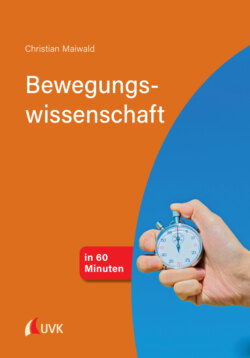Читать книгу Bewegungswissenschaft in 60 Minuten - Christian Maiwald - Страница 5
Оглавление1 Einführung – Charakterisierung der Bewegungswissenschaft
Die Bewegungswissenschaft ist eine, gemessen an traditionellen, etablierten Wissenschaften wie etwa der Physik, noch relativ junge Wissenschaftsdisziplin. Als integrative Disziplin vereint sie Erkenntnisse und Methoden aus anderen Disziplinen und ist für ihre Arbeit auch auf diese angewiesen. Die Beschreibung der Bewegungswissenschaft geschieht üblicherweise durch die Definition ihres Gegenstandsbereichs, ihrer Forschungsfragen, ihrer theoretischen Grundpositionen und ihrer Methoden. Als integrative Wissenschaftsdisziplin besteht für die Bewegungswissenschaft sowohl auf der Ebene der Theorien als auch der Methoden eine große Schnittfläche zu anderen Wissenschaftsdisziplinen, insbesondere zur Physik, zur Biologie, zur Psychologie und zur Medizin.
Die Charakterisierung der Bewegungswissenschaft ist insofern mit der Entwicklung der gesamten Sportwissenschaft in Deutschland verbunden, als dass es unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, ob die Bewegungswissenschaft als eine Teildisziplin der Sportwissenschaft aufgefasst werden sollte, oder ob Teilbereiche der Sportwissenschaft nicht eher einer übergeordneten Bewegungswissenschaft zugeordnet werden sollten (Zschorlich, 2000). Die Bewegungswissenschaft wird insofern als Teilgebiet der Sportwissenschaft aufgefasst, als die menschliche Bewegung mit all ihren Facetten einen Kernbereich des Sports darstellt (Roth & Willimczik, 1999, S.11). Innerhalb der deutschen Sportwissenschaft ist die Bewegungswissenschaft historisch eng verbunden mit der (pädagogisch inspirierten) Bewegungslehre des Sports. Der Begriff Bewegungswissenschaft verweist heute – vor allem im internationalen Kontext – allerdings weniger auf eine aus sportpädagogischer Tradition heraus entwickelte Wissenschaftsdisziplin, sondern impliziert einen naturwissenschaftlichen Zugang zur Analyse menschlicher Bewegung, insbesondere auch in Kontexten abseits des Sports wie beispielsweise in der (Patho-)Physiologie oder der Ergonomie (Mechling & Munzert, 2003, S.13–14).
Im angelsächsischen Sprachraum wird Bewegungswissenschaft oftmals mit den Begriffen human kinetics, kinesiology, motor control and learning, (sport) biomechanics oder etwas allgemeiner als human movement science bezeichnet. Diese Begriffsvielfalt deutet bereits an, dass es sehr unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, welche theoretischen Perspektiven und Methoden innerhalb einer im deutschen Sprachraum als Bewegungswissenschaft bezeichneten Wissenschaftsdisziplin zur Anwendung kommen, und wie sie im Kanon anderer (sport-)wissenschaftlicher Disziplinen verortet wird. Diese Vielfalt an theoretischen Zugängen zur Analyse menschlicher Bewegung wird im Abschnitt 3 näher thematisiert.
Göhner (1992, S.23) schlägt vor, dass die Bewegungslehre des Sports „als ein Lehr- und Forschungsgebiet zu sehen ist, das einerseits die sportliche Bewegungsvielfalt (bzw. früher die Bewegungen der Leibesübungen), andererseits aber (und inzwischen in fast ausschließlicher Weise) die Funktionsweise der sich bewegenden Person zum Gegenstand hat“. Loosch (1999, S.23) fasst seine Definition etwas weiter: „Die Gegenstände einer allgemeinen Bewegungslehre sind die Erscheinungsformen der menschlichen Motorik im Sport und angrenzenden Tätigkeitsfeldern, wie der sportorientierten Rehabilitation oder der bewegungstherapeutischen Ausbildungsrichtung. Der Kernbereich der Darstellungen bezieht sich auf den Sport“.
Den Gegenstandsbereich der Bewegungswissenschaft beschreiben Roth und Willimczik (1999, S.11) wie folgt: „Sie beschäftigt sich einerseits mit den beobachtbaren Produkten (Bewegungen und Haltungen) sowie andererseits mit dem Gesamtsystem jener körperinternen Prozesse (Motorik, Emotionen, Motive, Sensorik, Kognitionen), die den Vollzügen zugrunde liegen. In Abhängigkeit von dem wissenschaftstheoretischen Standort werden dabei vielfältige Zielsetzungen und Analyseinteressen verfolgt“.
Aus diesen Definitionen des Gegenstandsbereichs wird erkennbar, dass abseits aller kontroversen Diskussionen um Verortung, Einordnung und Bezeichnung der Wissenschaftsdisziplin ein gemeinsamer Nenner erkennbar ist. Dieser besteht darin, dass Bewegungswissenschaft und Bewegungslehre des Sports danach streben, die menschliche Bewegung (im Sport) sowie alle Prozesse, die Bewegung auslösen, steuern, regeln und beeinflussen, zu verstehen – das heißt, beschreiben, erklären und wenn möglich auch vorhersagen zu können.
Wissenschaftsdisziplinen sind nicht allein durch ihren Gegenstandsbereich, sondern auch durch ihre Theorien und Methoden gekennzeichnet. So unterschiedlich die Ausgangspositionen, das Selbstverständnis und die Zielsetzungen der Akteure innerhalb der Bewegungswissenschaft auch sein mögen, so zahlreich sind auch die Gemeinsamkeiten des bewegungswissenschaftlichen Methodenspektrums und ihrer Anwendungsbereiche. Beispielsweise sind Fragen nach den neurophysiologischen Grundlagen von Bewegung und Bewegungslernen, nach der motorischen Entwicklung des Menschen, nach den Wahrnehmungsprozessen im Kontext von Bewegung oder aber auch nach der Pathomechanik des Bewegungsapparats sowohl Bestandteil einer allgemeinen als auch einer speziell im sportwissenschaftlichen Kontext betriebenen Bewegungswissenschaft (Mechling & Munzert, 2003, S.13–15).
Als Bewegungswissenschaft des Sports wird eine mehr grundlagenorientierte, zunehmend an internationalen Forschungstendenzen ausgerichtete Herangehensweise an den Gegenstandsbereich bezeichnet, wohingegen die Bewegungslehre des Sports eine eher anwendungsorientierte Perspektive – insbesondere vor dem Hintergrund der im deutschen Sprachraum pädagogisch inspirierten Tradition der Sportwissenschaft – beschreibt.
In beiden Begrifflichkeiten finden sich unterschiedliche Zielsetzungen und Zugangsweisen zur Analyse sportlicher Bewegungen wieder. Diese erstrecken sich von einem auf sportpädagogisches Handeln orientierten, morphologischen Ansatz, über eine biomechanisch-physikalische Sichtweise, hin zu neurophysiologisch oder auch psychologisch geprägten Perspektiven auf den Bewegungsapparat, das Nerv-Muskelsystem und die zentralnervösen Prozesse der Bewegungssteuerung (Roth & Willimczik, 1999, S.9–19; Wollny, 2007, S.27–33).