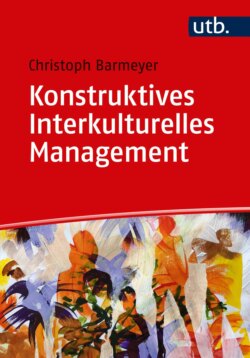Читать книгу Konstruktives Interkulturelles Management - Christoph Barmeyer - Страница 10
ОглавлениеKultur(en) und Kulturdimensionen
Kulturkonzepte der Interkulturellen Managementforschung
Interkulturelles Management geht davon aus, dass Kultur für Organisationen und Arbeitsverhalten bedeutsam ist. Dabei steht der Einfluss von Kultur auf Akteursund Organisationspraktiken im Vordergrund, d. h. die Wirkung von Kultur auf Strategien, Strukturen und Prozesse in Organisationen, sowie resultierende Muster und Effekte. Ein Wissen über Logik und Funktionsweisen von Kultur ist insofern zentraler Bestandteil und gleichzeitig Grundlage Konstruktiven Interkulturellen Managements.
Kultur als Konzept ist seit vielen Jahrzehnten zentraler Diskussionspunkt sozialwissenschaftlicher und kulturwissenschaftlicher Forschung (Busch 2014; Treichel/Mayer 2011). Ausgelöst durch gesellschaftliche Entwicklungen wie Internationalisierung, Migration und Diversität findet ein Paradigmenwechsel bezüglich des Kulturbegriffs statt: In der neueren Forschung wird der sogenannte hermetische Kulturbegriff, der soziale Systeme als »geschlossene Container« (Läpple 1991, 194; Beck 1997, 115) betrachtet und von einer bestimmten Determiniertheit menschlichen Verhaltens ausgeht, zunehmend von einem pluralistischen Kulturbegriff überlagert, der multiple Kulturen und Identitäten explizit untersucht (Fang 2006; Nathan 2015). Heutzutage stehen sich verschiedene Positionen bezüglich der Konstrukte Kultur und Interkulturalität und ihrer Einflussnahme auf (Arbeits-)Verhalten und Organisationen gegenüber:
1. Kultur-Negation: Bis heute wird von vielen Praktikern und Wissenschaftlern der Einfluss von Kultur auf Organisationen nicht wahrgenommen oder unterschätzt. Diese ethnozentrische Haltung findet sich umso stärker bei Akteuren, die sich in übergeordneten Positionen befinden, die also in wirtschaftlich einflussreichen Ländern oder in Großunternehmen agieren. In ähnlicher Weise ist auch die Wissenschaft betroffen, etwa hinsichtlich der Dominanz des angloamerikanischen Wissenschaftssystems, das zunehmend andere Wissenschaftssysteme und deren Traditionen, Denkschulen und Sprachen verdrängt (Locke 1989; Tietze/Dick 2013; Chanlat 2014).
2. Kultur-Akzeptanz: Zunehmend hat sich durch interkulturelle Forschung und Praxis seit den 1960er Jahren eine ethnorelativistische Position verbreitet, die Kultur und Interkulturalität einen besonderen, teilweise herausragenden, Stellenwert einräumt (Barmeyer 2000). Vertreter der Kultur-Akzeptanz nehmen Kultur als Einflussvariable wahr und nutzen diese zur Gestaltung von Gesellschaften und Organisationen.
3. Kultur-Dekonstruktion: Diese Position entstand als Reaktion auf die Überbewertung von (national-)kulturellen Einflüssen und Interkulturalität von Vertretern der Kultur-Akzeptanz. Die Dekonstruktion von Kultur entledigt sich in gewisser Weise ihrem Objekt, und räumt ihm im Vergleich zu anderen kontextuellen, persönlichen oder situativen Variablen nur einen geringen Stellenwert ein.
Dieses Buch legt den Schwerpunkt auf die Kultur-Akzeptanz, da davon ausgegangen wird, dass Kultur und Interkulturalität Einfluss auf Arbeitsverhalten und Organisationen nehmen. Es ist ein Anliegen, diesen Einfluss zu verstehen und stärker ins Bewusstsein zu rücken, um die vielfältigen komplexen interkulturellen Arbeitsund Führungssituationen in Organisationen – deren Bewältigung die beteiligten Akteure oft viel Energie und Zeit kostet – konstruktiv zu gestalten.
Kulturkonzepte spielten in den Anfängen der US-amerikanischen Managementforschung, die vor allem seit Mitte des 20. Jahrhundert eine Pionierrolle in den angewandten Sozialwissenschaften einnahm, keine Rolle (Adler 1983). Mit fortschreitender Internationalisierung jedoch wurde deutlich, dass Managementansätze einer Gesellschaft nicht einfach auf andere Kontexte übertragen werden konnten, wie es US-amerikanische Ansätze zeigten (Javidan et al. 2006). Das Interesse an kultureller Forschung stieg insbesondere mit Hofstedes Werk Culture’s Consequences: International Differences in Work-Related Values aus dem Jahr 1980 (Nakata 2009). Seither beschäftigen sich verschiedene Ansätze und Wissenschaftsdisziplinen mit dem Einfluss von Kultur auf Management und Organisationen.
Je nach Wissenschaftstradition und -disziplin haben sich zahlreiche Kulturdefinitionen herausgebildet (Kroeber/Kluckhohn 1954). Jedoch können sich die verschiedenen Fachvertreter – entsprechend der Vielfalt der Wissenschaftsdisziplinen – auf keinen einheitlichen Kulturbegriff einigen (van Maanen 2011). Dies ist kaum zu kritisieren, da der Kulturbegriff a) als abstraktes Konzept, wie viele sozial- und geisteswissenschaftliche Begriffe, schwer greifbar ist und sein Inhalt je nach Kontext variieren kann, b) in den unterschiedlichen Disziplinen einen anderen Stellenwert einnimmt und c) unterschiedlich genutzt wird (Geertz 1973). Zu bemängeln ist jedoch vielmehr, dass die jeweiligen Fachvertreter im Sinne einer interdisziplinären Verständigung entweder ihren Kulturbegriff nicht genug deutlich machen (Caprar et al. 2015) oder aber den der anderen Fachvertreter nicht kennen oder nicht akzeptieren. Entsprechend der konstruktiven Ausrichtung dieses Buches werden die divergierenden Begriffe jedoch nicht als konträr, sondern vielmehr als komplementär aufgefasst.
Kultur wird verstanden als »erlerntes Orientierungs- und Referenzsystem von Werten und Praktiken, das von Angehörigen einer bestimmten Gruppe oder Gesellschaft kollektiv gelebt und tradiert wird.« (Barmeyer 2011b, 13–14). Dabei ermöglicht jede Kultur ihren Mitgliedern, gemeinsames und individuelles Handeln zu gestalten. Wichtig ist, dass sich diese Definition nicht nur auf nationale Kontexte und Gemeinschaften beschränkt, sondern auf alle Formen sozialer Systeme wie Regionalkulturen, Organisationskulturen, Bereichskulturen, Berufskulturen oder »Geschlechterkulturen« Anwendung finden kann.
Der Kulturbegriff als zentraler Gegenstand des Interkulturellen Managements fungiert dabei als Konstrukt, welches Konkretisierung und Komplexitätsreduzierung ermöglicht (D’Iribarne 1994, 92).
Kultur bildet sich in spezifischen Sozialisationskontexten heraus (Durkheim 1911; Parsons 1937, 1952). Dabei geht es nicht darum, Kultur essentialistisch oder deterministisch auf eine Nation oder Ethnie zu reduzieren. Es geht vielmehr darum, einen bestimmten Erfahrungsraum zu erfassen, in dem Menschen durch Sozialisation und Enkulturation prägende Lebenserfahrungen machen, d. h. in welchen Räumen und zu welcher Zeit unter welchen Bedingungen Werte und Normen vermittelt und aufgenommen werden, sowie Bedeutungen und (Verhaltens-)weisen/Praktiken beobachtet und erlernt werden. Diese konstituieren ein emotionales und kognitives System, das unbewusst als Haltungen, Lebensregeln und Werte gespeichert wird (Kluckhohn/Strodtbeck 1961; Hofstede 2001; Inglehart/Welzel 2005; Schwartz 2011).
Vorstellungen über Vertrauen, Freiheit, Gleichheit, Unterordnung oder ›richtigem‹ Verhalten in Arbeits- und Führungssituationen sind Ergebnisse der Sozialisation (Baumgart 2008). Diese vollzieht sich in familiären und persönlichen Institutionen, wie Eltern, Großeltern, Freunde sowie in öffentlichen Institutionen, wie Kindergarten Schule oder Hochschule (Barmeyer 2000). Gegenüber kurzfristigen Veränderungen weisen diese Institutionen eine relative Kontinuität und Stabilität auf (Elias 1979; Ammon 1989).
Der Einfluss des Bildungssystems ist in bestimmten Gesellschaften bedeutend: Schule und Hochschule sind zentrale Orte der Sozialisation, an denen in der Gemeinschaft Wissen erworben sowie Normen und soziales Verhalten erlernt werden (Johnson/Tuttle 1989). In diesem zeitlich und räumlich begrenzten Rahmen findet zwischen Akteuren Kommunikation und Interaktion statt, es werden also Denk- und Verhaltensweisen, die etwa Autoritäten oder Problemlösungsstrategien betreffen, konditioniert, die für die jeweilige Gesellschaft charakteristisch sind. Aus den vielen Stufen des Bildungssystems wird exemplarisch die frühkindliche herausgegriffen, da davon ausgegangen wird, dass das Individuum in dieser Phase eine besondere kulturspezifische Prägung erfährt (Hofstede 1980).
Bildungssystem: ›Kindergarten‹ versus ›Ecole maternelle‹
»Im Rahmen des Sozialisationsprozesses wird Sozialverhalten und Autoritätsverständnis in Kindergarten und Ecole Maternelle erlernt. Die Bezeichnungen geben hierüber Auskunft: Die Ecole Maternelle ist eine ›Schule‹, also eine Institution, die dem französischen Bildungsministerium untersteht und landesweit Wissen (Mathematik, Sprechen, Lesen und Schreiben, Malen) vermittelt, auch wenn es spielerisch geschieht. Tagesablauf und Aktivitäten werden durch die Institutrice, die Erzieherin, strukturiert. Sie stellt eine personalisierte Autorität dar, die über das Sozialverhalten der Kinder ›wacht‹ und gegebenenfalls regulierend eingreift. Die Förderung intellektueller Leistung, auch durch Noten, führt zu individualistischem Konkurrenzverhalten. In der deutschen Bezeichnung Kindergarten steht das ›Kind‹ im Vordergrund, das im ›Garten‹, einem privaten oder halbprivaten Raum Zeit verbringt. Das Kind hat Gelegenheit mit seinesgleichen in Gruppen zu spielen, Regeln und Verhaltensweisen in der Gemeinschaft, als in einer Art soziales Laboratorium, zu erproben, auszuhandeln und sich zu integrieren. Deutsche Kinder entdecken somit spielend Freiheit und Grenzen in der Gruppe. Lernprozesse finden spielerisch und vor allem freiwillig ohne die Regulierung einer übergeordneten Autorität statt. Anders als das französische Kind, das den ganzen Tag in ein institutionelles System eingebunden ist, kann das deutsche Kind seine Zeit relativ eigenverantwortlich einteilen, um z. B. Aktivitäten in frei gewählten Gemeinschaften nachzugehen.«
Quelle: (Barmeyer 2013, 277)
Kultur, entstanden und entwickelt in Sozialisationskontexten, berücksichtigt auch multiple Kulturen und Identitäten. Denn bikulturelle Menschen haben verschiedene kulturelle Orientierungssysteme verinnerlicht (Brannen/Thomas 2010), weil sich ihre prägenden Sozialisationskontexte etwa durch Migration verändert haben oder weil sie durch unterschiedliche Sozialisationskontexte geprägt wurden, etwa weil ihre Eltern und das gesellschaftliche Umfeld kulturell unterschiedlich sind.
Drei komplementäre Kulturkonzepte
Im Folgenden werden drei komplementäre Kulturkonzepte präsentiert (Tab. 16), die sich in der Interkulturellen Managementforschung und -praxis zur Analyse bewährt haben (Barmeyer 2011b). Sie lassen sich mit den von Sorge (2004a) dargestellten drei Ansätzen (Kulturalismus, Symbolischer Interaktionismus und Institutionalismus) der kulturvergleichenden Organisationsforschung zuordnen.
| Kultur als | Ausrichtung | Ansätze |
| 1. Wertesystem, das Denken, Fühlen und Handeln beeinflusst | Normativ: Was wird als gut und böse, richtig und falsch, erstrebenswert und verwerflich, etc. erachtet? | Kulturalismus |
| 2. Referenz- und Bedeutungssystem, das sinnvolle Interpretationen der Wirklichkeit ermöglicht | Interpretativ: Welche Bedeutung haben Praktiken und Artefakte und welche Interpretationen werden ihnen zugeschrieben? | Symbolischer Interaktionismus |
| 3. System der Problembewältigung und Zielerreichung, das bestimmte Lösungen bevorzugt und integriert | Aktionsorientiert: Wie werden Herausforderungen angegangen, Probleme gelöst und Ziele erreicht? | Institutionalismus |
Tab. 16: Drei komplementäre Kulturkonzepte
Kultur als Wertesystem
Einen besonderen Stellenwert nehmen Werte ein. Sie beeinflussen menschliches Verhalten, auch Arbeits- und Organisationspraktiken (Smith et al. 2002). Samovar und Porter (1991, 15) definieren Werte als »a set of organized rules for making choices, reducing uncertainty, and reducing conflicts within a given society. Cultural values also specify which behaviors are important and which should be avoided within a culture.« Werte sind erlernte, kulturrelative, wünschenswerte Leitvorstellungen, Handlungsprinzipien und verhaltenssteuernde Entscheidungsregeln (Parsons 1952). Häufig handelt es sich um ethische, religiöse oder humanistische Leitbilder einer Gesellschaft, wie z. B. Sicherheit, Fleiß, Ordnung oder Pflichterfüllung (Weber 2006). Werte beeinflussen und organisieren als Maßstäbe und Präferenzen das Verhalten, werden also in sozialen Interaktionen sichtbar und bringen Vorstellungen über ›richtige‹ bzw. wünschenswerte Formen des Zusammenlebens zum Ausdruck (Genkova 2012).
Werte werden jedoch nicht als verhaltensdeterminierende Einengungen verstanden, sondern vielmehr schlagen sie Lösungen und Verhaltensweisen vor, die sich bewährt haben (Inglehart et al. 2005). Jedoch verändern sich Werte langsamer als Institutionen und Strukturen und können eine hohe Kontinuität aufweisen (Münch 1986). Werte beeinflussen wiederum Strukturen und Institutionen (Braudel 1990; Todd 1990; Whitley 1992b).
Verschiedene internationale Studien erheben vergleichend Werte und Wertewandel, wie die World Values Survey, Eurobarometer, die Shell Jugendstudie, die Studie von Schwartz (1992, 2006) oder arbeitsbezogene Werte wie die GLOBE Studie (House et al. 2004, 2014). Auch die Studie von Hofstede (1980, 2001) orientiert sich an Werten, die in Kulturdimensionen Eingang finden.
Der US-amerikanische Sozialwissenschaftler Ronald Inglehart zeigt in seinen Untersuchungen zu Werten anhand des World Values Survey (WVS), dass in Gesellschaften ein stetiger Wertewandel stattfindet – etwa durch gesellschaftliche Modernisierung (Inglehart/Baker 2000). In der Umfrage, die von einem Netzwerk aus Sozialwissenschaftlern durchgeführt und in regelmäßigen Abständen aktualisiert wird, werden Weltanschauungen und Überzeugungen von Menschen auf der ganzen Welt erhoben und verglichen. Die Werte betreffen die Vorstellung von Leben, Umwelt, Arbeit, Gesellschaft, Religion und Moral und nationaler Identität. Die Forschergruppe untersucht hierbei, inwiefern wirtschaftliche Entwicklung zu einer kulturellen Modernisierung und Werteverschiebung führt (Inglehart/Welzel 2005; Norris/Inglehart 2009, 2012). Tab. 17 zeigt anhand der WVS exemplarisch die Ausprägung ausgewählter arbeitsbezogener Werte einzelner Länder.
Tab. 17: Arbeitsbezogene Werte ausgewählter Länder der World Values Survey, 6. Erhebungswelle 2010–2014 (V = Variablen Nummer)
Die WVS stellt Werteausprägungen von Gesellschaften dar. Dazu dienen zwei Achsen: traditionell vs. säkular-rationale Werte sowie Überlebens- vs. Selbstentfaltungs-Werte (Abb. 1).
Durch kulturelle Dynamik lassen sich in den meisten Gesellschaften Werteverschiebungen konstatieren. Nach Inglehart (1997) wandeln sich Werte von materialistischen in postmaterialistische, sobald ein gewisser Lebensstandard erreicht ist. Materielle Werte beziehen sich auf die ›Aufrechterhaltung der Ordnung‹ oder wirtschaftliches Wachstum‹, während sich postmaterielle Werte in ›Partizipation in Politik und Arbeit‹ oder ›Schutz der freien Meinungsäußerung‹ ausdrücken. Bestimmen Überlebensnöte nicht mehr den Alltag, so wenden sich Menschen der Selbstverwirklichung zu. Ebenso stellt die WVS einen Wertewandel von traditionellen Werten zu säkular-rationalen weltlichen Werten fest. Dies hat etwa zur Folge, dass in sich modernisierenden Gesellschaften eine größere Toleranz gegenüber Randgruppen, wie Ausländern und Homosexuellen besteht und ein größeres Bewusstsein für das subjektive Wohlbefinden entsteht, das Vertrauen und politische Mäßigung fördert (Inglehart/Baker 2000).
Abb. 1: Cultural map – World Values Survey Wave 6 (2010–2014), http://www.worldvaluessurvey.org/images/Culture_Map_2017_conclusive.png
Werte und ihre Unterschiede beziehen sich jedoch nicht nur auf Nationalkulturen, sondern betreffen genauso Organisationen, Generationen (Smola/Sutton 2002; Sackmann/Phillips 2004; Scholz 2014b) oder Lebensstile wie den LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability), eine Personengruppe, die eine nachhaltige Ausrichtung ihres Lebens verfolgt (Ray/Anderson 2000).
Für das Konstruktive Interkulturelle Management ist von Bedeutung, dass sich Werte nicht nur auf der Ebene der Nationalkultur, sondern auch innerhalb einer Nationalkultur auf der Organisations- und Branchenebene situieren. Dies zeigen z. B. Studien in brasilianischen (Arellano et al. 2013), italienischen (Canhilal et al. 2013) oder spanischen (Esteve et al. 2013) Verwaltungen. Als theoretischer Bezugsrahmen dient Dolans (et al. 2004) Drei-Achsen-Modell. Dieses lässt eine Kategorisierung und Priorisierung von Werten zu und verhilft zum besseren Verständnis bezüglich organisationaler Werte. Das Modell teilt in drei Werte-Achsen ein:
–Ethisch-soziale Achse: Umfasst Werte vor allem in Bezug auf Gruppen und Verhaltensweisen in Gesellschaften. Zugeordnet sind ihr beispielsweise Großzügigkeit, Ehrlichkeit und Transparenz.
–Ökonomisch-pragmatische Achse: Umfasst Werte vor allem in Bezug auf Planung, Erfolg und Qualität der Arbeit. Zugeordnet sind ihr beispielsweise Effizienz, Ordnung, Pünktlichkeit und Disziplin.
–Emotionale Entwicklungsachse: Umfasst Werte vor allem in Bezug auf ein erfülltes, ausgestaltetes Leben. Zugeordnet sind ihr beispielsweise Kreativität, Autonomie, Anpassungsfähigkeit und Freude.
Tab. 18 zeigt das Ergebnis der Achsen-Zuordnung (als Säulen) der Werte der Studie zur Verwaltung in Italien (Canhilal et al. 2013).
| Ethisch-sozial | Ökonomisch-pragmatisch | Emotionale Entwicklung |
| Authentizität, Zugehörigkeit, Mitgefühl, Glaubwürdigkeit, Ehrlichkeit, Integrität, Respekt, Vertrauen, Verständnis | Genauigkeit, Engagement, Beitrag, Effektivität, Effizienz, Wissen, Logik, Vorbereitung, Professionalität, Pünktlichkeit, Realismus, Struktur, Synergie, Teamarbeit, Nützlichkeit | Anerkennung, Abenteuer, Herausforderung, Kreativität, Kompetenz, Wachstum, Glück, Motivation, Aufgeschlossenheit, Optimismus, Leidenschaft, Freude, Zufriedenheit |
Tab. 18: Klassifizierung von Werten in der italienischen Verwaltung (Canhilal et al. 2013, 548, Auszug, eigene Übersetzung)
Neben zusätzlichen Analysen zu Alter, Geschlecht, Beziehungsstatus oder Verantwortungsebene können somit weitere Erkenntnisse bezüglich Wertetendenzen in Abhängigkeit der demografischen Variablen entsprechender Organisationen gewonnen werden.
Kultur als Referenz- und Bedeutungssystem
Trotz aller Einmaligkeit und Individualität verfügen Menschen nach Thomas (2004, 145) über ein gewisses »Repertoire an Gemeinsamkeiten«, um miteinander zu kommunizieren, also durch Zeichen Bedeutungen auszutauschen und sinnvoll zu interagieren, wie es Max Weber (1904) bereits Anfang des 20. Jahrhundert vertrat.
»[…] keine Erkenntnis von Kulturvorgängen [ist] anders denkbar […], als auf der Grundlage der Bedeutung, welche die stets individuell geartete Wirklichkeit des Lebens in bestimmten einzelnen Beziehungen zum Inhalt hat. In welchem Sinn und in welchen Beziehungen dies der Fall ist, enthüllt uns aber kein Gesetz, denn das entscheidet sich nach den Werteideen unter denen wir die ›Kultur‹ jeweils im einzelnen Falle betrachten. Kultur ist ein vom Standpunkt des Menschen aus mit Sinn und Bedeutung bedachter endlicher Ausschnitt aus einer sinnlosen Unendlichkeit des Weltgeschehens.« (Weber 1904, 55)
Kultur besteht aus gemeinsamen Wissensbeständen sowie aus selbstverständlich und natürlich erachteten Grundannahmen, Erwartungen, Vorstellungen und Bedeutungen, die innerhalb einer Gruppe Eindeutigkeit, Sinnstiftung und geteiltes Wissen schaffen können (Hall 1981; Witt/Redding 2009). Diese erlernten und geteilten Ideen, Symbole und Bedeutungen ermöglichen es Mitgliedern einer Kultur, sinnhaft und zielorientiert zu kommunizieren und zu kooperieren (Geertz 1973). Soziale Gruppen müssen dabei nicht ein exakt gleiches Wissen oder Bedeutungssystem teilen; sie lassen vielmehr durch einen gemeinsamen Bezugsrahmen ein weitgehend geteiltes Verständnis der sozialen Wirklichkeit entstehen (Berger/Luckmann 1966; Holden 2002). Dieses Bedeutungssystem wird im Sozialisationsprozess erlernt (Dubar 1991) und dient zur angemessenen Interpretation kommunikativer Handlungen (Wimmer 2005).
»All cultures […] provide interpretative systems that give meaning to the problems of existence, presenting them as elements in a given order that have therefore to be endured, or as the result of a disturbance of that order, that have consequently to be corrected.« (D’Iribarne 1994, 92).
Eine besondere wichtige Rolle nehmen hierbei Zeichen und Symbole ein, die nach Geertz (1973) dazu beitragen, dass Kultur ein »Bedeutungsgewebe« und »semantisches Inventar« darstellt. Dabei stehen sich auch bezüglich dieses sinngebenden Bedeutungsgewebes das Gemeinsame und das Individuelle, das Geteilte und das Partikulare, das Eindeutige und das Ambivalente gegenüber. Bieri (2011) unterstreicht außerdem den Zusammenhang von Identität und Bedeutungssystem: Identität bildet sich heraus aus »Bedeutungsgeweben«.
Interkulturell relevant werden Bedeutungssysteme, wenn bestimmte Symbole von Interagierenden nicht verstanden werden, da diese nicht über das jeweilige Regelwissen verfügen und bestimmte Symbole nicht kennen. Außenstehende sehen sich deshalb mit einer »Vielfalt komplexer, oft übereinander gelagerter oder ineinander verwobener Vorstellungsstrukturen [konfrontiert], die fremdartig und zugleich ungeordnet und verborgen sind.« (Geertz 1973, 15). Dabei entsteht in der interkulturellen Situation etwas Uneindeutiges, Vages und Neuartiges, das als bedrohlich oder anregend wahrgenommen werden kann. Die Relativität von Bedeutungssystemen und die in interkulturellen Situationen möglichen Irritationen werden im Kapitel »Sprache und Kommunikation« vertieft.
Kultur als System der Problembewältigung und Zielerreichung
Nach den Kulturanthropologen Kluckhohn und Strodtbeck (1961) ist Kultur eine Art und Weise der Problemlösung. Dies bedeutet, dass Akteure in sozialen Systemen spezifische Formen und Wege finden, Ziele zu erreichen. Auch wenn eine Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten existiert, werden aufgrund von (unbewussten) Werten, Erfahrungen und Ansprüchen bestimmte bewährte, ›dominante‹ Lösungen zur optimalen Regulierung zwischenmenschlichen Handelns und zum Überleben und Fortbestand des Systems vorgezogen (Parsons 1952). Diese Lösungen können z. B. Regeln oder Methoden, aber auch Institutionen sein. Wenn relativ ähnliche Wertorientierungen in Gemeinschaften bestehen und sich diese als erfolgreich herausgestellt haben, entwickeln Gemeinschaften bestimmte Lösungsmuster mit besonderer Häufigkeit und Ausprägung. Kluckhohn und Strodtbeck formulieren diesbezüglich drei Annahmen:
»First it is assumed that there is a limited number of common human problems for which all peoples at all times must find some solution. This is the universal aspect of value orientations because the common human problems to be treated arise inevitably out of the human situation. The second assumption is that while there is variability in solutions of all the problems, it is neither limitless nor random but is definitely variable within a range of possible solutions. The third assumption […] is that all alternatives of all solutions are present in all societies at all times but are differentially preferred. Every society has, in addition to its dominant profile of value orientations, numerous variant or substitute profiles. Moreover it is postulated that in both the dominant and the variant profiles there is almost always a rank ordering of the preferences of the value-orientation alternatives.« (Kluckhohn/Strodtbeck 1961, 10)
Somit bilden Gesellschaften ein bestimmtes Wertesystem heraus, das deren Verhalten und Handlungen im Sinne von Problemlösung beeinflusst (Parsons 1937; Kluckhohn 1953). Zur Einordnung werden fünf allgemeinmenschliche Probleme erarbeitet:
1.Wie ist das Wesen der menschlichen Natur? (Human Nature)
2.Wie ist die Beziehung des Menschen zur Natur? (Man-Nature)
3.Wie ist die Zeitorientierung des Menschen? (Time)
4.Wie ist die Aktivitätsorientierung des Menschen? (Activity)
5.Welche Art von Beziehung hat ein Mensch zu anderen aus der Gruppe? (Human Relations)
Auf dieser Basis entwickelten die Forscher eine allgemein anwendbare Methode mit Kategorien, um einen Vergleich unterschiedlicher Kulturen zu ermöglichen: die Value Orientation Method (Tab. 19).
| Orientierung | Möglicher Variationsbereich | ||
| Menschliche Natur | Schlecht | Gut und schlecht/Neutral | Gut |
| Veränderlich – unveränderlich | Veränderlich – unveränderlich | Veränderlich – unveränderlich | |
| Beziehung des Menschen zur Natur | Unterwerfung des Menschen unter die Natur | Harmonische Beziehung zwischen Mensch und Natur | Beherrschung der Natur durch den Menschen |
| Zeitorientierung des Menschen | Vergangenheit | Gegenwart | Zukunft |
| Aktivitätsorientierung des Menschen | Sein | Werden | Handeln |
| Beziehung des Menschen zu anderen Menschen | Linearität | Kollateralität | Individualismus |
Tab. 19: Fünf Wertevariationen (Kluckhohn/Strodtbeck 1961, 12, unsere Übersetzung)
Der Kultur-Ansatz von Kluckhohn und Strodtbeck, ihre Wertevariationen und ihre Methodik haben die Interkulturelle Managementforschung – insbesondere die kontrastive – über Jahrzehnte hinweg geprägt.
Veränderungen und Entwicklungen kultureller Systeme geschehen, wenn Menschen feststellen, dass bestimmte Lösungsmuster nicht mehr geeignet sind, bestehende Herausforderungen oder Probleme zu meistern. Durch die Suche nach wirksamen neuen Lösungen hinterfragen sie Selbstverständlichkeiten und erlangen somit mehr Bewusstsein über ihre Problemlösungen. Neue Strukturen und Prozesse können somit zu einer Veränderung und Entwicklung von Systemen beitragen.
»The values of any living culture had helped it survive in the environment where it found itself. Borrowing from evolutionary theory, it has become common to ask how well these cultural values fit the environment so that the culture survives. These survival values are passed down the generations. There are therefore as many sets of different cultural values as there are environments across the globe. These are not good or bad, high or low, civilized or primitive. They are to be judged, if at all, by their evolutionary fit.« (Hampden-Turner/Trompenaars 2006, 57)
Je mehr Werte im Gegensatz zueinander stehen, desto konfliktreicher ist ihr Einfluss auf ein soziales System. Je mehr sie in Einklang gebracht werden, desto stabilisierender wirken sie auf ein soziales System. Eine wichtige Funktion einer ausgeglichenen und wirkungsvollen Interkulturalität besteht also darin, Gegensätze, Wertedifferenzen als gegenseitige Kräfte positiv aufeinander wirken zu lassen (Demorgon 1998; Hampden-Turner/Trompenaars 2000). Im Sinne eines Konstruktiven Interkulturellen Managements geht es um die komplementäre, synergetische Findung von Lösungen.
Zusammenfassend werden Merkmale und Funktionen der drei komplementären Kulturkonzepte dargestellt (Tab. 20).
| Kultur als | Merkmal | Funktion | Einfluss auf das Management |
| 1. Wertesystem | ›Mentale Software‹: Bestimmte und spezifische, durch Sozialisation erworbene Muster des Denkens, Fühlens und Handelns, die ein emotionales und kognitives System konstituieren. | Orientierung und »Selbstverständlichkeiten«, die wiederum Entscheidungen beeinflussen und die optimale Regulierung zwischenmenschlichen Handelns ermöglichen. | Ausrichtung und ethische Orientierung: Welche Ziele werden als erstrebenswert erklärt? Wie werden Entscheidungen und Verhaltensweisen begründet? |
| 2. Referenz- und Bedeutungssystem | ›Semantisches Inventar‹: Geteilte Wissensbestände, Symbole und Bedeutungsinhalte führen zu gemeinsamen Grundannahmen, Erwartungen, Vorstellungen und Interpretationen. | Eindeutigkeit, Klarheit, Sinnstiftung, zielführende adäquate Interpretation kommunikativen Handelns. | Kommunikatives Handeln und Sprache: Welchen Sinn ergeben Symbole und Verhaltensweisen? Wie werden sie verstanden, bzw. interpretiert? |
| 3. System der Problembewältigung und Zielerreichung | ›Problemlösung‹: Spezifische Bewältigung von grundsätzlichen universellen Herausforderungen und Problemen. | Bewährte Muster der Problembewältigung und Zielerreichung werden reproduziert und verfestigen sich. Trotz der Vielfalt an Lösungsmöglichkeiten weisen Gesellschaften bestimmte Lösungsmuster mit besonderer Häufigkeit und Ausprägung auf. | Arbeits- und Organisationspraktiken: Wie wird mit Herausforderungen umgegangen? Wie werden Ziele erreicht? Wie wird organisiert, gesteuert, gestaltet? |
Tab. 20: Merkmale und Funktionen drei komplementärer Kulturkonzepte und ihr Bezug zum Management
Konstruktiver Umgang mit Kultur-Konzepten
Im Sinne Konstruktiver Interkulturalität illustrieren die drei vorgestellten Kultur-Konzepte die identitätsbildende und sinnstiftende Orientierungs- und Ordnungsfunktion, die Kultur hat, und es Individuen ermöglicht, sich innerhalb eines sozialen Systems zurechtzufinden und in einer Gruppe oder Gesellschaft dauerhaft mit möglichst wenigen Widersprüchen miteinander zu leben.
Einerseits stellt sich die Frage der Entwicklung und Veränderung bezüglich der drei Kulturkonzepte, denn mit der Entwicklung von Gesellschaften sind auch Kulturkonzepte einem Wandel unterworfen. Inwiefern sind sie davon betroffen? Aufgrund zunehmender Multikulturalität von Gesellschaften durch Zuwanderung von Menschen mit Migrationshintergrund wird sich eine Plurikulturalität herausbilden, mit vielen bikulturellen Menschen, der sogenannten Third Culture Individuals (TCI) (Moore/Barker 2012) oder Third Culture Kids (TCK) (Pollock et al. 2003). TCI bzw. TCK bezeichnet Jugendliche, die in der Phase des Heranwachsens diversen interkulturellen Einflüssen ausgesetzt sind, etwa aufgrund häufiger Wohnortwechsel und Schulbesuchen in unterschiedlichen Ländern oder der Erziehung durch Elternteile, die aus unterschiedlichen Gesellschaften stammen.
Anderseits ist die Überlegung interessant, wie Akteure auf Kultur und Interkulturalität einwirken können. Hier wird deutlich, dass es unterschiedliche Beeinflussungsgrade gibt: Das Wertesystem eines Menschen ist nur schwer und langsam entwickelbar. Es gilt vor allem, dieses zu kennen und zu verstehen. Bedeutungssysteme dagegen lassen sich durch kulturelles Wissen – vor allem Sprache – erweitern und nach und nach durchdringen. Was Problemlösungen betrifft, so gibt es viele Möglichkeiten der Einwirkung: Welche neuen, alternativen Lösungen lassen sich finden, um konstruktiv zielführend zu handeln? Es ist wichtig, sich der komplementären drei Kulturbegriffe bewusst zu sein und diese anzuerkennen, um sie dann gestalterisch zu nutzen. Um die Kulturkonzepte konstruktiv zu behandeln, braucht es vor allem kulturelle Mittler, Boundary Spanner, die an – interdisziplinären und internationalen – Schnittstellen sozialer Systeme agieren, v. a. beim Übersetzen zwischen den unterschiedlichen Zeichensystemen (Barner-Rasmussen et al. 2014). Hier wiederum spielen TCI bzw. TCK eine zentrale Rolle: Durch ihre interkulturelle Sozialisation haben sie mehrere kulturelle Wertesysteme verinnerlicht, die ihnen eine offenere und ethnorelativistische Weltsicht bieten. Ebenso beziehen sie sich auf unterschiedliche Referenz- und Orientierungssysteme, die es ihnen ermöglichen, verbales und nonverbales Verhalten bewusster wahrzunehmen und vielleicht treffender zu interpretieren. Bezogen auf die Problemlösung steht ihnen ein großes Handlungsrepertoire zu Verfügung, in interkulturellen Situationen kreativ und auch integrativ zu wirken. Somit sind TCK insofern konstruktiv, als dass genau sie als Personen an Schnittstellen zwischen Kulturen eingesetzt werden können, um zwischen a) Wertesystemen, b) Bedeutungssystemen und c) Problemlösungssystemen zu vermitteln und zu schlichten.
Multiple Kulturen und kulturelle Dynamik
Seit langer Zeit äußern sowohl die Wissenschaftler der Interkulturalität als auch Sozial- und Geisteswissenschaftler Kritik an den in Forschung und Praxis verwendeten Kulturkonzepten, die sich vor allem auf Nationalkulturen beziehen (McSweeney 2009). Dabei wird vor allem kritisiert, dass sich Kulturkonzepte häufig auf eine mehr oder weniger homogene Gesellschaft beziehen und diese als ›autonome Insel‹ betrachten, die von äußeren Einflüssen nicht oder kaum tangiert werden. Metaphorisch ausgedrückt stellen viele Kulturbegriffe ›Korsette‹ dar, die von der Mannigfaltigkeit moderner kultureller Systeme gesprengt werden. Deshalb kritisieren einige wissenschaftliche Vertreter generell an interkultureller Praxis und Forschung die als zu homogen eingestuften Kulturbegriffe (Dahlén 1997; Moosmüller 2004). D’Iribarne unterstreicht, dass der Bezugspunkt der Nationalkultur nicht dazu dient, ihre Spezifika »nur« hervorzuheben, sondern dass es um die Analyse und das Verstehen von Besonderheiten geht:
»When national cultures are concerned, the aim is not to highlight the supposedly persisting characteristics of certain cultures. It is rather a matter of analysing how, within a given organisation, the encounter of people coming from different societies and with different habits leads to the emergence of a specific culture, understood as a common way of doing things.« (D’Iribarne 2009, 310–311)
Multiple Kulturen
Eine zentrale Frage ist, in welchem Ausmaß Individuen ihre kulturelle Prägung in Denken, Fühlen und Handeln auch leben, also inwiefern sie »typische« Repräsentanten ihrer Kultur sind – oder nicht. Brannen (1998) verweist darauf, dass nicht nur der Kontext zu beachten ist, in dem Interkulturalität stattfindet, sondern auch die kulturellen Charakteristika der Akteure. Zurecht wird der monolitisch-funktionalistische und nationale Kulturbegriff als zu deterministisch kritisiert. Akteure in interkulturellen Organisationen sind durch viele unterschiedliche kulturelle Einflüsse geprägt und weisen insofern viele pluralistische kulturelle und identitäre Bezugspunkte auf, die weit vielfältiger sind als nur die Prägung durch eine nationale Kultur. Diese Pluralität wird u. a. von verschiedenen Ansätzen thematisiert: multiple cultures (Sackmann/Phillips 2004), Fuzzy Diversity (Bolten 2010b) oder Fuzzy Cultures (Bolten 2011, 2014).
Entsprechend dem Ansatz der multiplen Kulturen beschäftigt sich die interkulturelle Forschung zunehmend nicht nur mit Nationalkultur, sondern auch mit anderen Kulturen wie Branchen-, Organisations-, Abteilungs- und Berufskulturen. In Organisationen betreffen sie die auch aus dem Diversity Management (Özbilgin/Tatli 2008; Genkova/Ringeisen 2016) bekannte Kategorien wie Geschlecht, Alter, soziale Klassen, hierarchische Position (Mitarbeiter, Führungskraft), Abteilung/Bereiche (Forschung, Marketing), Profession (Ingenieur, Jurist) sowie Organisationskulturen (flexibel, verschlossen). Solche kulturellen Gruppierungen werden auch als Stratifizierung subkultureller Merkmale (Zander/Romani 2004) bezeichnet oder als kulturelles Mosaik (Chao/Moon 2005). Von den vielen kulturellen Gruppierungen werden folgend drei genannt, die das Interkulturelle Management besonders betreffen:
Organisationskultur ist seit den 1980er Jahren ein vielbeachtetes Thema der (Interkulturellen) Managementforschung und -praxis (Schein 1986). Auch Hofstede (1980) initiierte seine große Studie Culture’s Consequences unter anderem, um das Einfluss- und Spannungsverhältnis zwischen Nationalkultur und Organisationskultur zu untersuchen. Ausgehend von den USA ist das Konzept der Organisationskultur zu einem breiten Forschungsfeld mit zahlreichen Publikationen geworden. Organisationskultur, zu verstehen als ein Subsystem von Kultur, erfüllt wichtige Funktionen in Organisationen: Sie konstituiert die gemeinsame Identität der Organisationsmitglieder, gibt Orientierung und Entscheidungshilfen und prägt das Handeln der Mitarbeiter (Scholz 2000). Somit zeigt sie Koordinations-, Integrations- und sogar Motivationsfunktionen auf (Brown 1998). Im Sinne der konstruktiven Interkulturalität kann Organisationskultur als eine Ressource verstanden werden, die zur Erhöhung der Wertschöpfung der Organisation und der Zufriedenheit der Mitarbeiter beiträgt. Dies kann durch eine »starke« Organisationskultur begünstigt werden, in der eine hohe Kohärenz gemeinsamer Orientierungsmuster existiert, die Transaktionskosten verringert (Schreyögg 2003). Insofern ist Organisationskultur ein zentrales Element des Konstruktiven Interkulturellen Managements.
Bereichskultur ist eine bisher wenig erforschte (Sub-)Kultur. Sie betrifft kollektive Grundannahmen innerhalb eines Bereichs (Abteilung) einer Organisation, die sich in bereichsspezifischen Werten, Praktiken und Artefakten niederschlagen (Zander/Romani 2004; Sachseneder 2013). Diese Grundannahmen betreffen z. B. spezifische Ziele, Verhaltensweisen oder Sprachen von Funktionsbereichen wie Marketing, Forschung & Entwicklung, Vertrieb oder IT. Bereichskultur kann eine identitätsstiftende Wirkung für das Kollektiv bewirken, so auch durch Abgrenzung: »Wir im Marketing gegen die in der Entwicklung«. Die bereichskulturelle Identität speist sich primär aus diesen Aufgaben und Zielen eines Bereichs (Sachseneder 2013). In einem konstruktiven Verständnis von Interkulturalität können sie jedoch auch positive Auswirkungen aufweisen: Eigenheiten der Bereiche und ihre unterschiedlichen Sichtweisen erzeugen durch gegenseitige Reibung auch ein fruchtbares Spannungsverhältnis. Gelingt es Organisationen, konstruktiv mit Bereichskulturen umzugehen, so entstehen positive Impulse und bereichernde Diskussionen.
Berufskultur ist zu verstehen als eine »spezifische und relativ stabile Merkmalskombination aus Selbstbild und Rollenverständnis, professionellem Wissen, Kompetenzen, Erfahrung und Praktiken einer Gruppe von Menschen bezüglich ihrer Arbeit, die sich in bestimmten Arbeitskontexten über einen gewissen Zeitraum herausgebildet hat und die identitätsbildend ist (›Wir Ingenieure‹; ›Wir Informatiker‹; ›Wir Journalisten‹).« (Barmeyer 2012a, 28). Wenig deutet darauf hin, auch wenn sich naturwissenschaftlich und technisch geprägte Berufskulturen (wie z. B. Ingenieure) landesübergreifend scheinbar ähnlicher sind als geistes- und sozialwissenschaftlich geprägte, dass die Berufskulturen länderübergreifend homogen sind (D’Iribarne 2001). Zu verschieden sind die – national geprägten – Institutionen beruflicher Sozialisation (Maurice et al. 1986), die ihrerseits Werte und Praktiken widerspiegeln (Pateau 1998). Trotzdem ist es möglich, dass Angehörige einer bestimmten Berufskultur, aufgrund einer gemeinsamen beruflichen Basis, implizit kommunizieren und effektiv kooperieren können (Malin 2000). Für das Konstruktive Interkulturelle Management ist es bedeutend, dass Berufskulturen nicht an Nationen, Branchen, Organisationen oder Personen gebunden sind und somit ein verbindendes Verstehenselement über »Kulturgrenzen« hinweg darstellen können (Mahadevan 2008, 2011). So zeigt Chevrier (2012) bezogen auf internationale Teams, dass, trotz kultureller Unterschiedlichkeit und dem Einsatz von Fremdsprachen, Berufskulturen – und damit verbundene spezifische geteilte Einstellungen, Interessen, Denkweisen, Kompetenzen, Erfahrungen, Verfahren und Fachausdrücke – ein verbindendes Element sind, um erfolgreich interkulturell zu kommunizieren und zu kooperieren.
Somit bilden Nationen nach einem postmodernen Verständnis kein monolithisches, sondern ein heterogenes soziales System, das vielfältigen kulturellen Einflüssen ausgesetzt ist und deshalb viele Kulturen, Identitäten oder »Kollektive« (Hansen 2009) vereint: »The multiple cultures perspective acknowledges that individuals may identify with and hold simultaneous membership in several cultural groups.« (Sackmann/Phillips 2004, 378). Eine Person kann weiblich, jung und sportlich sein, der gesellschaftlichen Oberschicht angehören, als Ingenieurin in einer Forschungsabteilung eines deutschen Großunternehmens in der Chemiebranche arbeiten, als Führungskraft ein Team führen und einen italienischen Pass besitzen. Dieses Individuum führt also viele verschiedene Rollen aus und fühlt sich mehreren kulturellen Gruppierungen, wie Ingenieuren, Forschern, Führungskräften etc. zugehörig.
In manchen Situationen spielt dann beispielsweise eher die Zugehörigkeit zu einer Landes- oder Regionalkultur eine größere Rolle, in anderen eher die Zugehörigkeit zum Geschlecht, zur Organisations-, Bereichs- oder Berufskultur. Je nach Art der Aufgabe, der bisherigen Erfahrungen, der Interaktionssituation und des Interaktionskontextes treten in sozialen Interaktionen bestimmte Eigenschaften der Teammitglieder stärker in den Vordergrund als andere: »Some differences may matter more than others« (Milliken et al. 2003, 37). Hinsichtlich der Dimensionen der Vielfalt kann dies bedeuten, dass Denk- und Verhaltensmuster aufgrund von nationalkultureller Zugehörigkeit eine wichtigere Rolle spielen als das Geschlecht oder das Alter der Mitglieder. In anderen Gruppierungen spielt vielleicht die berufliche Laufbahn oder der Abschlussgrad eine geringere Rolle als das aufgabenbezogene Wissen und die Fähigkeit, ein bestimmtes Problem zu lösen (Reiter-Palmon et al. 2012). Wie manifestieren sich nun multiple Kulturen in Organisationen?
Multiple Kulturen bei Infineon
Das deutsche multinationale Unternehmen im Bereich Halbleiter-Technik Infineon Technologies AG erwarb im Jahre 2014 das US-amerikanische Unternehmen International Rectifier Corporation, zu dem zahlreiche internationale Tochtergesellschaften gehören, so auch eine südfranzösische Tochtergesellschaft. In dieser Tochtergesellschaft arbeiten seit fast 20 Jahren vor allem Ingenieure und Informatiker aus Paris und Nordfrankreich, die durch US-amerikanische Managementmethoden sozialisiert wurden und diese in ihren Arbeitsstil integriert haben.
Nun, mit dem Aufkauf durch das deutsche Unternehmen Infineon werden neue Methoden und Prozesse eingeführt, nämlich die der deutschen Zentrale von Infineon, die die »alten« ersetzen, bzw. überlagern. Gleichzeitig werden neue Informatiker eingestellt, die gerade ihr Studium abgeschlossen haben und der jüngeren Generation der Digital natives angehören. Sie weisen einen anderen Arbeitsstil auf als die älteren Kollegen. In der südfranzösischen Tochtergesellschaft, die von einer französischen Ingenieurin geführt wird, koexistieren nun – im Sinne multipler Kulturen – nicht nur verschiedene Regionalkulturen (Nord- und Südfrankreich) und Generationskulturen (jung und alt), sondern auch unterschiedliche Unternehmenskulturen (International Rectifier und Infineon) und Nationalkulturen (Frankreich, USA, Deutschland).
Quelle: Eigene Erhebung
Multiple Kulturen – auch im Sinne von Diversität – ermöglichen somit ein wesentlich differenziertes Bild kultureller Wirklichkeiten. Diversität ist eine Stärke, wenn sie zum einen spezifische Merkmale von Akteuren berücksichtigt und zum anderen zu einer Akzeptanz der Vielfalt von Gemeinschaften führt. Konstruktives Interkulturelles Management ist gefordert, strategisch und steuernd der Komplexität multiplen Kulturen zu begegnen, etwa durch die bewusste Betonung von verbindenden Gemeinsamkeiten (etwa die Berufskultur von Ingenieuren). Jedoch kann die zu starke Betonung von Singularitäten (Reckwitz 2017) sowie die Pluralisierung und Differenzierung von Kultur(en) in Organisationen und Gesellschaften problematisch sein: Anstatt Kultur(en) und ihre Merkmale zusammenzubringen und zu kombinieren, besteht die Gefahr, Besonderheiten und Unterschiede zu sehr zu betonen und damit eine trennende, zersplitternde Wirkung zu erreichen. Die vielen multiplen Kulturen stehen dann in permanenten Abgrenzungsprozessen und tragen zu Spaltungen bei.
Stabilität und Dynamik von Kulturen
In der Interkulturellen Managementforschung überwog lange Zeit das funktionalistische bzw. zweidimensionale Paradigma (Fang 2006). Diese Art nationale Kulturen zu beschreiben hat viel Kritik hervorgerufen (McSweeney 2009), da die Untersuchung bipolarer Dimensionen in der interkulturellen Forschung eine gewisse Stabilität voraussetzt. Wenn davon ausgegangen wird, dass nationale Identität kontextabhängig und dynamisch ist, kann dieser anfänglich herangezogene, in der nationalen Identität verankerte, kulturelle Referenzrahmen in neuen – interkulturellen – Kontexten modifiziert und angepasst werden. Bedeutungen, Praktiken und Normen können somit im Laufe der Zeit und im Rahmen von Interaktionen und Aushandlungen rekombiniert oder verändert werden (Brannen/Salk 2000, 458). Insofern eignen sich klassische Strukturmodelle, wie etwa die deterministisch wirkenden Kulturdimensionen interkultureller Forschung, wenig zur Beschreibung und zum Verständnis interkultureller Prozesse; Entwicklungsmodelle, die auf konstruktivistischen Annahmen beruhen und Dynamiken berücksichtigen, dagegen schon.
Für das dynamische Verständnis von Interkulturalität sind z. B. die Forschungen des Kulturanthropologen Franz Boas (1858–1943) grundlegend. Er wies als einer der ersten Forscher darauf hin, dass Kulturen komplexe soziale Systeme sind, in denen einerseits relativ stabile, anderseits auch dynamische Elemente und Muster co-existieren: Zum einen sind Kulturen in spezifische historische Kontexte eingebettet. Zum anderen erfahren sie durch systemimmanente Interaktion sowie äußere Einflüsse Wachstum und Entwicklung (Benedict 1943; Boas 1949). Wachstum und soziale Entwicklung erfolgen durch die Verbreitung von Ideen, die teilweise aus anderen Sozialsystemen stammen, aus Innovationen und durch die Schaffung und Aufrechterhaltung von Institutionen.
Boas verwies schon im Sinne von multiple cultures (Sackmann/Phillips 2004) darauf, dass moderne Anthropologie nicht »Kultur« im Singular, sondern »Kulturen« menschlicher Gruppen berücksichtigen sollte (Stocking 1966). Es ist sowohl der dynamische und evolutive Aspekt der Entwicklung von Kulturen als auch Boas humanistische, völkerverständigende Grundhaltung, die es Individuen und Gemeinschaften ermöglicht, durch reziproke und gleichberechtigte Kommunikations- und Interaktionsprozesse friedvoll und zugleich wirkungsvoll zusammenzuleben, was konstruktiver Interkulturalität entspricht.
Während die Metapher der Kulturzwiebel (Hofstede 2001) Kulturen als voneinander isolierte, vielschichtige Konstrukte mit stabilem Kern (Werte) betrachtet, erlaubt die »Ozean«-Metapher (Fang 2006) die Identifizierung von Verhaltensweisen und Werten in einem bestimmten Kontext und zu einer bestimmten Zeit. Zugleich hilft die Metapher des Ozeans, Kultur als etwas fließendes und übergreifendes zu verstehen. Kultur weist nach Fang (2006) ein Eigenleben auf, da sie historisch voller widersprüchlicher Entwicklungen ist. Die Gesamtheit aller Inhalte und Prozesse einer Kultur ist aber zu keiner Zeit sichtbar, denn diese verbirgt sich, wie im Ozean, unter der Oberfläche und fördert ständig neue Entwicklungen. Außerdem geschehen durch interkulturelle Interaktion Wandlungsprozesse in Verhaltensweisen und Werten. Diese beiden Metaphern passen zu den Bezeichnungen von Bjerregaard et al. (2009): »Culture as code« würde der Zwiebel und einem stabil-funktionalistischen Kulturansatz entsprechen, »Culture in context« lässt sich dem Ozean und einem dynamisch-interpretativen Kulturansatz zuordnen. Tab. 21 fasst die unterschiedlichen Strömungen zusammen.
| Stabil-funktionalistisch | Dynaniisdi-mterpretativ | |
| Management und Organisationen | Stabilität durch historische Traditionen und nationale Institutionen wie Bildungssysteme, Gesetze etc. | Dynamik durch Intensivierung von Interaktionen zwischen organisationalen Akteuren mit unterschiedlich kulturellem Hintergrund |
| Annahmen | Homogenität durch stabile Wertesysteme, Bedeutungssysteme | Heterogenität durch Internationalisierungsprozesse und Multikulturalismus |
| Paradigma | Funktionalistisch/positivistisch | Interpretativ |
| Kulturelle Strömungen | Länderübergreifender Kulturvergleich | Interkulturelle Interaktion und multiple Kulturen |
| Kontext | »Kultur als Code«: dekontextualisiert | »Kultur als Kontext«: kontextualisiert |
| Metapher | Kultur als »Zwiebel« | Kultur als »Ozean« |
| Perspektive | Kultur als »Billardkugel« | Ausgehandelte Kultur |
Tab. 21: Zwei Kulturansätze: Stabil-funktionalistisch versus dynamisch-interpretativ
Kulturdimensionen und Kulturstandards
Kulturdimensionen und Kulturstandards sind sowohl zentraler Bestandteil der Interkulturellen Managementforschung als auch der organisationalen Praxis und finden sich in zahlreichen wissenschaftlichen Studien und Lehrbüchern (Mayrhofer 2017). Sie sind als Kategorien bzw. Variablen zu verstehen, die in bestimmter Kombination auftretende gesellschaftliche Phänomene beschreiben und auch für deren Analyse genutzt werden können. Sie werden oft herangezogen, um soziale Systeme wie Gesellschaften, Organisationen oder Gruppen zu charakterisieren oder zu vergleichen. Sie eignen sich, um anderskulturelles Wahrnehmen, Denken, Fühlen und Verhalten besser zu verstehen (Barmeyer 2011c). Kulturdimensionen und Kulturstandards beziehen sich etwa auf den Umgang mit Zeit, Information, Raum oder Wertorientierungen wie Individualismus, Machtdistanz oder Partikularismus etc. Wichtige Vertreter dieses Ansatzes sind Hall (1959, 1976), Hofstede (2001), Schwartz (1992, 2006) und Trompenaars/Hampden-Turner (1997).
Kulturstandards
Der US-amerikanische Kulturanthropologe Edward T. Hall gilt allgemein als Begründer der Interkulturellen Kommunikation (Rogers et al. 2002, 13). Hall (1959) verfolgte eine emische Herangehensweise an das Phänomen Kultur, dies wird in seiner methodischen qualitativen Vorgehensweise erkennbar: Ziel seiner Forschungsstrategie war es, ein profundes Verständnis von Struktur und Funktionsweise im Einzelfall zu erlangen. Halls Kulturdimensionen stellen eine Kategorisierung grundlegender Aspekte des menschlichen Zusammenlebens und Verhaltens dar. Bekannteste Dimensionen sind die Dichte von Informationsnetzen (Kontext), das Raumverhalten (Proxemik) und das Zeitverständnis (Zeit) (Tab. 22).
| Kontext: Implizite und Explizite Kommunikation | |
| Indirekte, spielerische und mehrdeutige Übermittlung von Informationen. Implizite Kommunikation ist schneller. Nur Beteiligte, die schon Vorwissen (Kontext) haben, verstehen Informationen richtig | Direkte, detaillierte und eindeutige Übermittlung von Informationen. Explizite Kommunikation ist langsamer. Alle Beteiligten verfügen über ein ähnliches Wissensniveau |
| Raumverständnis: Proxemik | |
| Strukturierung und Nutzung des Raums durch Ordnungs- und Leitungssysteme. Physischer Abstand (Nähe und Distanz) zwischen PersonenAufteilung, Ordnung und Nutzung des Raumes im Privatleben (Wohnung, Haus), im öffentlichen Leben (infrastrukturelle Maßnahmen) und in Unternehmen (Größe, Anordnung und Gestaltung von Gebäuden und Büros nach Zugehörigkeit, Funktionen, Hierarchien etc.)Eigenes menschliches und zugleich kulturspezifisches Kommunikationssystem, dessen Basiseinheiten (Körperhaltung oder Körperberührung) über verschiedene Kommunikationskanäle übermittelt werden und ein komplexes Muster des Raumverhaltens bilden | |
| Zeitverhalten: Polychronie – Monochronie | |
| (= vieles gleichzeitig)Im Arbeitsrhythmus finden sich häufig unvorhergesehene Unterbrechungen, Improvisation ist gefragt Individuen messen Pünktlichkeit weniger Bedeutung zu, als Individuen monochroner GesellschaftenZwischenmenschliche Beziehungen haben höhere Priorität als Aufgaben und ein festes Arbeitsprogramm | (= eins nach dem anderen)Zeit wird eingeteilt in kleine, unabhängige EinheitenRisiken werden durch Planung und Formalisierung verringert oder ausgeschaltet Arbeitsrhythmus ist gleichmäßig, Stress-Situationen sind dadurch selten. Eintreffende Ungewissheit ist störend, bringt den Ablauf durcheinander und kann Orientierungslosigkeit bewirken |
Tab. 22: Kulturdimensionen nach Hall (1966, 1983)
Weitere Kulturdimensionen stammen von dem Niederländer Geert Hofstede (1980, 2001). In seiner quantitativ durchgeführten Studie untersuchte er mithilfe standardisierter Fragebögen arbeitsbezogene Wertorientierungen und Einstellungen von 116.000 IBM-Mitarbeitern in 72 Ländern. Die Interpretation der Ergebnisse erfolgte durch Konzepte der Psychologie und Soziologie. Die gefundenen Kulturdimensionen (Tab. 23) sollen objektive und vergleichbare Kriterien zur Beschreibung und Analyse unterschiedlicher Gesellschaften liefern und weisen je nach Gesellschaft relativ unterschiedliche Ausprägungen auf. Sie werden anhand von Indizes in ein Ranking nach Ländern eingereiht. Mit seiner Studie Culture’s Consequences (1980, 2001) legte Hofstede die Basis für den strategischen Umgang mit kulturellen Einflüssen in der internationalen Arbeitswelt.
| Hohe Machtdistanz – Niedrige MachtdistanzAusmaß, bis zu welchem die weniger mächtigen Mitglieder von Institutionen bzw. Organisationen eines Landes erwarten und akzeptieren, dass Macht ungleich verteilt ist. | |
| Tendenz zur ZentralisationMitarbeiter erwarten, Anweisungen zu erhalten Der ideale Vorgesetzte ist der wohlwollende Autokrat oder gütige Vater | Tendenz zur Dezentralisation Mitarbeiter erwarten, in Entscheidungen miteinbezogen zu werden Der ideale Vorgesetzte ist der einfallsreiche Demokrat |
| Kollektivismus – Individualismus | |
| Individuen sind in starke, geschlossene Wir-Gruppen integriert, die ihn schützen und dafür bedingungslose Loyalität verlangenBeziehung Arbeitgeber-Arbeitnehmer wird an moralischen Maßstäben gemessen, ähnlich einer familiären Bindung Management bedeutet Management von GruppenBeziehung hat Vorrang vor Aufgabe | Bindungen zwischen Individuen sind locker: Man erwartet von jedem, sich um sich selbst und seine unmittelbare Familie zu sorgenBeziehung Arbeitgeber-Arbeitnehmer ist ein Vertrag, der sich auf gegenseitigen Nutzen gründen sollManagement bedeutet Management von Individuen Aufgabe hat Vorrang vor Beziehung |
| Schwache Unsicherheitsvermeidung – Starke UnsicherheitsvermeidungGrad, bis zu dem sich die Angehörigen einer Kultur durch ungewisse oder unbekannte Situationen bedroht fühlen. | |
| Zeit ist ein Orientierungsrahmen Wohlbefinden bei Müßiggang, harte Arbeit nur, wenn erforderlich Präzision und Pünktlichkeit müssen erlernt werden Motivation durch Leistung und Wertschätzung oder soziale Bedürfnisse | Zeit ist GeldEmotionaler Drang nach Geschäftigkeit, innerer Drang nach harter Arbeit Präzision und Pünktlichkeit sind natürliche Eigenschaften Motivation durch Sicherheitsbedürfnis und Wertschätzung oder soziale Bedürfnisse |
| Maskulinität – Femininität | |
| Geschlechterrollen sind klar abgegrenzt: Männer haben bestimmt und hart orientiert zu sein, Frauen sollen bescheidener, sensibler sein und Wert auf Lebensqualität legen Leben, um zu arbeiten Betonung liegt auf Fairness, Wettbewerb unter Kollegen und Leistung Konflikte werden beigelegt, indem sie ausgetragen werden | Geschlechterrollen überschneiden sich: Sowohl Frauen als auch Männer sollten bescheiden und feinfühlig sein und Wert auf Lebensqualität legen Arbeiten, um zu leben Betonung liegt auf Gleichheit, Solidarität und Qualität des Arbeitslebens Konflikte werden durch Verhandlung und Kompromiss beigelegt |
| Langfristorientierung – KurzfristorientierungDimension nachträglich hinzugefügt nach der Chinese Value Survey (1985). | |
| Förderung von Tugenden, die sich an zukünftigen Belohnungen orientieren, insbesondere Ausdauer und Sparsamkeit Zu den wichtigsten Arbeitswerten gehören Lernen, Ehrlichkeit, Anpassungsfähigkeit, Verantwortlichkeit und Selbstdisziplin Langfristige Pläne werden erstellt Hohe Bedeutung von Traditionen Ausdauer und Beharrlichkeit bei der Verfolgung von Zielen | Förderung vergangener und gegenwärtiger Tugenden, insbesondere die Achtung der Tradition, die Wahrung des »Gesichtes« und die Erfüllung gesellschaftlicher Verpflichtungen Zu den wichtigsten Arbeitswerten gehören Freiheit, Rechte, Leistung und selbstständiges Denken Kurzfristige Planung wichtiger als langfristige Planung Erwartung kurzfristiger Gewinne Konsumneigung |
| Genuss – ZurückhaltungDimension basierend auf Minkovs Begriff von Indulgence vs. Restraint (Minkov/Hofstede 2011). | |
| Freie Befriedigung grundlegender und natürlicher menschlicher Bedürfnisse in Verbindung mit Lebensfreude und Vergnügen Entspannte Haltung zu Arbeit, Sparsamkeit und Abweichungen Hohe Priorisierung der Freizeit Wahrnehmung, das eigene Leben kontrollieren zu können | Überzeugung, dass Befriedigung menschlicher Bedürfnisse durch strenge soziale Normen eingedämmt und reguliert werden sollte Persönliche Disziplin, um das Ziel zu erreichen Geringe Priorisierung der Freizeit Wahrnehmung von Hilflosigkeit: »Was mit mir geschieht, ist nicht mein eigenes Tun« |
Tab. 23: Kulturdimensionen nach Hofstede (1980, 2001, 2010 et al.)
Zwei weitere Personen, die Kulturdimensionen maßgeblich prägten, sind der Niederländer Fons Trompenaars, der 1993 das Werk Riding The Waves of Culture veröffentlichte, und der Brite Charles Hampden-Turner. Beide Forscher haben als Berater- und Autoren-Tandem zahlreiche Werke veröffentlicht. Wie auch Hofstede stützen sie sich auf die Annahme von Kluckhohn und Strodtbeck (1961), dass Kulturen universellen Problemen gegenüberstehen, wofür sie jeweils unterschiedliche Lösungen finden (Trompenaars/Hampden-Turner 1997). Methodisch arbeitete Trompenaars in seiner ersten Studie (1993) mit 30.000 standardisierten Fragebögen, die er in 30 Unternehmen in 50 verschiedenen Ländern beantworten ließ. Die daraus resultierenden Kulturdimensionen leiten sich zum einen von Kluckhohn und Strodtbeck (1961) ab, zum anderen von dem US-amerikanischen Soziologen Talcott Parsons (1952) und Parsons und Shils (1951/1991). Sie finden sich in Tab. 24.
| Universalismus – PartikularismusGrad der Wichtigkeit, den eine Kultur entweder dem Gesetz oder den persönlichen Beziehungen beimisst. | |
| Haltung, die besagt, dass Normen und Regeln für das Verhalten gegenüber anderen Menschen für alle gleich gelten | Haltung, die besagt, dass partikulare Verpflichtungen gegenüber einzelnen Mitgliedern wichtiger sind, als das Befolgen allgemeinverbindlicher Normen und Regeln |
| Individualismus – KollektivismusGrad, zu dem Menschen sich selbst eher Individuum sehen oder eher einer Gemeinschaft zugehörig fühlen. | |
| Individuum steht vor der Gemeinschaft. Das bedeutet, dass individuelles Glück, Erfüllung und Wohlergehen vorherrschen, Menschen Eigeninitiative zeigen und für sich selbst sorgen | Gemeinschaft ist wichtiger als die Einzelperson. Es liegt also in der Verantwortung Einzelner, im Dienste der Gesellschaft zu handeln. Damit werden individuelle Bedürfnisse bereits automatisch berücksichtigt |
| Spezifität – DiffusitätGrad, zu dem Verantwortung spezifisch zugewiesen oder diffus akzeptiert wird. | |
| Akteure analysieren zuerst die Elemente einzeln und setzen sie dann zusammen. Das Ganze ist die Summe seiner Teile. Das Leben der Menschen ist dementsprechend geteilt und es kann jeweils nur auf eine einzige Komponente eingegangen werden. Interaktionen zwischen Menschen sind klar definiert. Individuen konzentrieren sich auf Fakten, Standards und Verträge | Eine diffus orientierte Kultur beginnt mit dem Ganzen und sieht einzelne Elemente aus der Perspektive des Ganzen. Alle Elemente sind miteinander verknüpft. Beziehungen zwischen Elementen sind wichtiger als einzelne Elemente |
| Neutralität – AffektivitätGrad, zu dem Individuen ihre Emotionen zeigen. | |
| Menschen wird beigebracht, ihre Gefühle nicht offen zur Schau zu stellen. Der Grad, in dem sich Gefühle manifestieren, ist daher minimal. Emotionen werden kontrolliert, wenn sie auftreten | In einer affektiven Kultur zeigen Menschen ihre Emotionen, und es wird nicht als notwendig erachtet, Gefühle zu verbergen |
| Leistung – HerkunftGrad, zu dem sich Einzelpersonen beweisen müssen, um einen gewissen Status zu erhalten, im Gegensatz zu einem Status, der einfach zugeschrieben wird. | |
| Menschen leiten ihren Status von dem ab, was sie selbst erreicht haben. Erreichter Status muss immer wieder nachgewiesen werden und der Status wird dementsprechend vergeben | Menschen leiten ihren Status von Geburt, Alter, Geschlecht oder Reichtum ab. Hier beruht der Status nicht auf Leistung, sondern auf dem Wesen der Person |
| Interne Kontrolle – Externe KontrolleGrad, zu dem Individuen glauben, dass die Umwelt kontrolliert werden kann, anstatt zu glauben, dass die Umwelt sie kontrolliert. | |
| Menschen haben eine mechanistische Sicht der Natur; Natur ist komplex, kann aber mit dem richtigen Fachwissen gesteuert werden. Menschen glauben, dass sie die Natur beherrschen können | Menschen haben einen organischen Blick auf die Natur. Menschen werden als eine der Naturgewalten betrachtet und sollte deshalb in Harmonie mit der Umwelt leben. Menschen passen sich daher den äußeren Gegebenheiten an |
| Serialität – ParallelitätGrad, zu dem Individuen Dinge nacheinander tun, im Gegensatz zu mehreren Dingen auf einmal. | |
| In einer sequentiellen Kultur strukturieren Menschen die Zeit sequentiell und tun Dinge nacheinander | In einer parallelen, synchronen Zeitkultur tun Menschen mehrere Dinge gleichzeitig, weil sie glauben, dass Zeit flexibel und immateriell ist |
Tab. 24: Kulturdimensionen nach Hampden-Turner und Trompenaars (2000, unsere Übersetzung)
In Forschung und Praxis werden die einzelnen Kulturdimensionen anhand von kulturtypischen Beispielen oder auch kritischen Interaktionssituationen illustriert und konkretisiert. Wissenschaftlich findet sich eine häufige Nutzung der Kulturdimensionen durch das von Kogut und Singh (1988) entwickelte Konzept der kulturellen Distanz. Ausgehend von der These, dass kulturelle Faktoren einen Einfluss auf Managemententscheidungen bezüglich des Eintrittsmodus in einen fremden Markt (Akquisition, Joint Venture) haben, entwickeln Kogut und Singh einen Index zur Messung kultureller Distanz. Kulturelle Distanz beschreibt dabei die »psychische« Distanz, die gegenüber einer anderen Kultur wahrgenommen wird, d. h. »the degree to which a firm is uncertain of the characteristics of a foreign market« (Kogut/Singh 1988, 413). Nach Kogut und Singhs Modell wird die relative kulturelle Distanz zweier Länder anhand der Abweichung der jeweiligen Indexwerte von Hofstedes Dimensionen Unsicherheitsvermeidung, Individualismus, Machtdistanz und Maskulinität gemessen.
Nicht nur in der Wissenschaft, auch in der interkulturellen Praxis (Training und Beratung) wird das Konzept der kulturellen Distanz und Nähe anhand der Kulturdimensionen mithilfe von geschlossenen Fragebögen im internationalen Personalmanagement genutzt. Dabei wird mit Gegensätzen gearbeitet. Somit lassen sich Profile erstellen, bei denen etwa das persönliche Profil eines Mitarbeiters aus Kultur A dem Profil der Landeskultur B gegenübergestellt wird. In einem Artikel des Jahres 2001 stellt Shenkar fest, dass nur wenige Konzepte in der internationalen Managementliteratur eine so breite Akzeptanz gefunden haben, wie die kulturelle Distanz. Jedoch gibt es einige konzeptionelle Vorbehalte gegenüber diesem Konzept, wie die »Illusion der Symmetrie«, die »Illusion der Linearität« oder die »Illusion der Stabilität« (Shenkar 2001, 520–521).
Kulturstandards
Kulturstandards – als deutscher Beitrag zur interkulturellen Forschung und Praxis – sind ein emischer Ansatz zur Beschreibung und Kontrastierung von Kulturen. Sie wurden von dem deutschen Sozialpsychologen Alexander Thomas (2003a) entwickelt und dienen, ähnlich wie Kulturdimensionen der Beschreibung kultureller Systeme sowie der Analyse interkultureller Begegnungssituationen. Kulturstandards sind »[…] Arten des Wahrnehmens, Denkens, Wertens und Handelns, die von vielen Mitgliedern eines sozialen Systems als normal, typisch und verbindlich angesehen werden« (Thomas 2003a, 25).
Kulturstandards stellen als Orientierungsmaßstäbe kulturelle Selbstverständlichkeiten und Leitlinien sozialen Handelns dar. In Anlehnung an einen Standard, der definiert, wie Objekte beschaffen sein oder Prozesse ablaufen sollten, legt ein Kulturstandard den Maßstab dafür fest, wie sich Mitglieder einer bestimmten Kultur tendenziell verhalten, also wie Objekte, Personen und Ereignisabläufe wahrgenommen, bewertet und behandelt werden (Kammhuber/Schroll-Machl 2007). Eigenkulturelles und anderskulturelles Verhalten wird aufgrund dieser Kulturstandards gesteuert, reguliert und beurteilt. Die einem System inhärenten Kulturstandards sind in der eigenen Gesellschaft angemessen, normal, akzeptabel, funktional und zielführend.
Ihre Zweckmäßigkeit verdanken sie der Art ihrer Herausbildung: Spezifische geistesgeschichtliche Traditionen verdichten sich zu kollektiven Grundannahmen über das menschliche Dasein, auf deren Basis sich wiederum bestimmte Reaktionsmuster als taugliche Prinzipien im Umgang mit kollektiven Erfahrungen etablieren (Kühnel 2014). Ermittelt werden Kulturstandards auf der Basis von historischen, soziologischen und psychologischen Erhebungen (Thomas 2003a, 2011). Letztere werden in interkulturellen Interaktionen erhoben, die das Verhalten bei sozialen Ereignissen (Treffen, Feste), in sozialen Rollen (Frau/Mann, Vorgesetzter) oder in sozialen Situationen (Kommunikationsstile, Entscheidungen fällen, Konflikte lösen) betreffen. Dabei findet eine Kontrastierung von Eigen- und Fremdkultur statt. Anders als die relativ allgemeinen, ethischen Kulturdimensionen, die alle Gesellschaften in unterschiedlicher Ausprägung betreffen (Zeit, Regeln, Hierarchie) sind Kulturstandards eher als spezifische, emische Kulturdimensionen zu verstehen, die nur in bestimmten Gesellschaften auftreten (Barmeyer 2011c). Thomas (2003a, 28) unterscheidet drei verschiedene Arten von Kulturstandards:
1.Zentrale Kulturstandards sind unabhängig von Problemstellungen und Handlungsfeldern gültig. Sie betreffen kulturspezifische Orientierungen, die für ein Land oder einen Kulturraum charakteristisch sind. Sie sind vor allem für die Steuerung zwischenmenschlicher Wahrnehmungs-, Interpretations- und Handlungsprozesse von Bedeutung. Für Deutschland führt Thomas hier z. B. die Sach- und Regelorientierung sowie Direktheit an, für China z. B. »Gesicht wahren«, Hierarchieorientierung sowie soziale Harmonie. Tab. 25 zeigt exemplarisch brasilianische Kulturstandards.
2.Bereichsspezifische Kulturstandards sind kontext- und aufgabengebunden und wirken erst in einem spezifischen Handlungsfeld, etwa bei Prozessen in Gruppen, Teams oder Abteilungen wie Forschung & Entwicklung, Vertrieb oder Personal. Folglich besitzen sie nur für bestimmte Handlungsfelder eine Regulationsfunktion. Thomas nennt als Beispiel für einen bereichsspezifischen Kulturstandard die unterschiedliche Herangehensweise bei komplexen Problemlösungen in Arbeitsgruppen.
3.Kontextuelle Kulturstandards sind kulturspezifische Basisorientierungen, die Vertretern einer Kultur in einer gewissen Situation einen Handlungszwang auferlegen, z. B. die Beachtung des Senioritätsprinzips in ostasiatischen Gesellschaften, die dazu führt, dass jüngere Personen in Interaktion mit älteren Menschen ihr Verhalten (in Form von Respekt oder Höflichkeit) der älteren Person anpassen. Ebenso finden sich auch unterschiedliche Verhaltensweisen, je nachdem ob es sich um berufliche oder private Kontexte handelt. Als kontextueller Kulturstandard gilt nach Thomas die Senioritätsorientierung in China, welche bei einem Auftreten das gesamte Handlungsfeld und die Wahrnehmung, Interpretation und Handlung bestimmt.
| Personenorientierung | Vertrauensbasis notwendig für Informationsfluss Erwartung von Solidarität |
| Interpersonelle Harmonieorientierung | Sprachroutinen: Floskeln wie »Schau doch mal bei mir zu Hause vorbei« – sind aber nicht wörtlich gemeint Gesicht wahren: indirekte Äußerung von Kritik |
| Kontakt- und Kommunikationsfreudigkeit | Interesse, Mitmenschen kennenzulernen Small-Talk |
| Emotionalität | schnelle Begeisterungsfähigkeit Optimismus |
| Hierarchieorientierung | Respekt vor Hierarchiegrenzen Genaue Vorgabe und Kontrolle von Arbeitsaufträgen |
| Gegenwartsorientierung | kurzfristige Planung, Pragmatismus opportunistische Lebenseinstellung ggü. Menschen, die nicht dem eigenen Familien- oder Freundeskreis angehören |
| Flexibilität | Anpassungsfähigkeit bei Planänderungen »o jeito«: Flexibler Umgang mit Regeln Ambiguitätstoleranz |
Tab. 25: Brasilianische Kulturstandards (Brökelmann et al. 2012)
Selbstverständlich können die individuelle und gruppenspezifische Art und Weise im Umgang mit Kulturstandards zur Verhaltensregulation innerhalb gewisser Toleranzbereiche variieren: So gibt es Verhaltensweisen, die außerhalb der bereichsspezifischen Grenzen liegen und in der Regel von der sozialen Umwelt abgelehnt oder sanktioniert werden (Thomas 2003a). Allerdings werden Standardabweichungen bei bestimmten Personen oder Gruppen wie Stars, Sportler und Künstler bewusst toleriert oder sogar erwartet.
Zu unterstreichen ist, dass Kulturstandards, ebenso wie Kulturdimensionen keinen Regelkanon zum erfolgreichen Umgang mit Personen anderer Kulturen darstellen. Sie werden vielmehr verstanden als Beschreibungsparameter, die durch individuelle Erfahrungen modifiziert werden können und sollten. Ein entscheidender Faktor innerhalb dieses Akkulturationsprozesses hierbei ist die Tatsache, dass die einzelnen Kulturstandards ihre handlungsleitende Wirkung nicht unabhängig voneinander entfalten, sondern dass es ihr spezifisches Zusammenspiel ist, wodurch soziale Interaktionen im Rahmen eines konzeptuellen Systems stabilisiert werden (Kühnel 2014).
Kritische Würdigung
Kulturdimensionen und Kulturstandards, insbesondere die von Geert Hofstede, finden seit Jahrzehnten eine breite Anwendung in Forschung und Praxis des (Interkulturellen) Managements, wie es Chapman (1997, 18) beschreibt: »Hofstede’s work became a dominant influence and set a fruitful agenda. There is perhaps no other contemporary framework in the general field of ›culture and business‹ that is so general, so broad, so alluring, and so inviting to argument and fruitful disagreement …«
Die Anzahl der meist positivistischen Studien, die auf Hofstedes Dimensionen zurückgreifen – Hofstedes Werk erreicht zurzeit (2018) 145.923 Zitationen in Google Scholar –, überwiegen in der Organisations-, Management und Marketingforschung. Aber auch in vielen anderen Disziplinen gibt es Hunderte von Replikationsstudien (Beugelsdijk et al. 2015, 2017). Bird und Fang (2009) würdigen die Arbeit von Culture’s Consequences für die (Interkulturelle) Managementforschung folgendermaßen:
»In 1980 Geert Hofstede published Culture’s Consequences and established a fundamental shift in how culture would be viewed, thereby ushering in an explosion of empirical investigations into cultural variation. Hofstede’s impact was at least fourfold: 1) he successfully narrowed the concept of culture down into simple and measurable components by adopting nation-state/national culture as the basic unit of analysis; 2) he established cultural values as a central force in shaping managerial behavior; 3) he helped sharpen our awareness of cultural differences; and 4) his notion of cultural value frameworks was adopted by others involved in large scale studies, e. g. the GLOBE project (Chokar et al., 2007). The impact of Hofstede’s paradigm is reflected in his second edition of Culture’s Consequences (2001), which identified over 1900 studies based on the original volume.« (Bird/Fang, 2009, 139)
Jedoch sind Kulturdimensionen und Kulturstandards – insbesondere von Kulturwissenschaftlern und Wissenschaftlern, die sich an interpretativen oder kritischen Forschungsparadigmen orientieren – immer wieder wissenschaftlicher Kritik ausgesetzt, die den inhaltlichen Realitätsgehalt und die Aussagekraft der dichotomen polarisierenden Darstellungen in Frage stellen (McSweeney 2002; Fang 2006; Kirkman et al. 2006, 2017; Bolten 2007; Nakata 2009; Dreyer 2011; Dupuis 2014).
Die zahlreichen Kritiken betreffend (Barmeyer 2011c), werden folgend drei besonders wichtige herausgegriffen:
Erstens wenden sich Kritiken häufig nicht gegen die an sich plausiblen Kulturdimensionen; es ist einsichtig, dass Menschen unterschiedliche Einstellungen zu Raum, Zeit, Macht, Geschlechterrollen, Zukunft, Regeln etc. aufweisen. Kritisiert wird eher die Methodik oder die ›Fixierung‹ von Kultur durch Kennzahlen auf Länder: »In dem Maße, in dem Kultur reduziert wird, schwindet menschliche Autonomie und Gestaltungsfreiheit.« (Hansen 2003, 287). Worauf wiederum Chapman (1997, 18–19) erwidert: »Those who take country scores in the various dimensions as given realities, informing or confirming other research, do not typically inquire into the detail of the procedures through which specific empirical data were transmuted into generalization.«. In der Tat können Kulturdimensionen zu nicht zulässigen Abgrenzungen und zur Verstärkung von Stereotypen führen.
Zweitens besteht durch die Fokussierung auf Nationalkultur die Gefahr, dass wichtige kulturelle Gruppierungen wie Geschlecht, Alter, Bereich, Profession etc. nicht berücksichtigt werden. Eine geäußerte Kritik betrifft die Zuordnung, Erklärung und damit Reduzierung menschlicher Denk- und Verhaltensweisen auf nationale Kulturdimensionen. Dabei lassen sich Kulturdimensionen genauso auf kulturelle Gruppierungen anwenden. Hofstede berücksichtigte in seiner Studie kulturelle Gruppierungen wie Geschlecht, Alter und Position, und stellte dabei auch statistisch heraus, dass die relativen Unterschiede zwischen Angehörigen nationalkultureller Gruppen bedeutsamer seien als etwa zwischen Mann und Frau einer bestimmten kulturellen Gruppe (Hofstede 1980, 53). So kam er bei der Dimension Machtdistanz zu dem Ergebnis, dass Führungskräfte in Frankreich, England und Deutschland eine niedrigere Machtdistanz aufweisen als Mitarbeiter und Arbeiter. Die Herleitung seiner Ergebnisse, die in seinen Büchern Culture’s Consequences (1980, 2001) genau dokumentiert und diskutiert sind, scheinen von seinen Kritikern überlesen und nicht rezipiert worden zu sein.
Drittens betrifft eine weitere Kritik die inzwischen lange zurückliegende Erhebung der Arbeitswerte, gerade in Bezug auf die Entwicklung von Gesellschaften durch Modernisierung (Inglehart 1997) und damit die Veränderung von Kulturdimensionen, bzw. ihrer Indexwerte. Autoren wie Minkov (2011) oder Beugelsdijk und Kollegen (2015) bestätigen die Stabilität und Kontinuität von Hofstedes arbeitsbezogenen Wertorientierungen bezüglich gesellschaftlicher Modernisierung unter Zuhilfenahme der Werte der WVS. Beugelsdijk und Kollegen (2015) untersuchen, wie sich die Länderwerte im Zeitverlauf entwickelt haben, indem Hofstedes Dimensionen für zwei Geburtskohorten – also Gruppen von Menschen, die alle im gleichen Jahr geboren wurden – anhand von Daten der WVS repliziert wurden. Die Ergebnisse zeigen, dass zeitgenössische Gesellschaften im Durchschnitt bei Individualismus und Genuss (Indulgence) gegenüber Zurückhaltung (Restraint) – eine höhere Punktzahl aufweisen und dass sie in Bezug auf Machtdistanz weniger Punkte erzielen als ältere Generationen. Die Forscher stellen fest, dass kultureller Wandel eher als relativ absolut sei, was bedeutet, dass sich die Länderwerte in Bezug auf die Hofstede-Dimensionen im Vergleich zu den Bewertungen anderer Länder nicht sonderlich stark verändert haben. Infolgedessen sind kulturelle Unterschiede zwischen Ländern (im Sinne kultureller Distanzen) im Allgemeinen stabil:
»Our finding that country differences on the scores of the (replicated) Hofstede dimensions have on average not become smaller implies that managing cultural differences remains important. Even in an increasingly interconnected world, there is continued need for global managers to take cultural differences into account when deciding where to expand […] how to organize global outsourcing […], which entry mode strategy to follow […], or whether to pursue an integration, responsiveness, or export-orientation subsidiary strategy […], among others. Cultural differences are still substantial and managing them remains a key challenge for global strategy.« (Beugelsdijk et al. 2015, 237)
Konstruktiver Umgang mit Kulturdimensionen
Trotz aller Kritik können Kulturdimensionen als Orientierungshilfe in interkulturellen Kontexten dienen, sofern mit ihnen in Forschung und Praxis differenziert umgegangen wird (Barmeyer 2011c). Kulturdimensionen und Kulturstandards sollten nicht als verhaltens-determinierende Einengungen verstanden werden. Vielmehr schlagen sie typische Lösungen und Verhaltensweisen von Akteuren vor, die sich bewährt haben. Allerdings sollte beachtet werden, dass Kulturdimensionen nicht absolut, sondern relativ verstanden werden, d. h. sie zeigen Besonderheiten im Verhältnis auf und sind immer in spezifische Handlungskontexte eingebunden. Vor allem aber sind Kulturdimensionen und Kulturstandards, wie auch Kultur, lediglich Konstrukte, die helfen können, gesellschaftliche Phänomene zu verstehen.
»CULTURE DOESN’T EXIST. In the same way values don’t exist […]. They are constructs, which have to prove their usefulness by their ability to explain and predict behavior. The moment they stop doing that we should be prepared to drop them, or trade them for something better. I never claim that culture is the only thing we should pay attention to. In many practical cases it is redundant, and economic, political or institutional factors provide better explanations. But sometimes they don’t, and then we need the construct of culture.« (Hofstede 2002, 1359)
Diese Konstrukte können als »interkulturelle Landkarten« (Barmeyer 2011c) verstanden werden. Dabei gilt der Grundsatz des Konstruktivismus, d. h. Menschen konstruieren sich durch Vorerfahrungen, selektive Wahrnehmung und Reflexion ihre Wirklichkeit (Watzlawick 1976). Somit stellt die Landkarte eine vereinfachte Abbildung der Umwelt und damit eine Interpretation der Realität dar. Sie bildet zwar wesentliche Elemente ab, andere jedoch lässt sie außer Acht. Somit hilft sie Menschen, sich zu orientieren und organisieren. Schwierigkeiten treten dann auf, wenn die jeweilige Landkarte für die Realität gehalten wird.
Im Sinne des Konstruktiven Interkulturellen Managements stellen Kulturdimensionen Orientierungshilfen dar, die bei der Gestaltung interkultureller Interaktion hilfreich sein können (Barmeyer 2011c). Sie lassen sich als Metawissen, als ›Steuerungsprogramme‹ verstehen, die es ermöglichen, die (1.) Eigenkultur bewusst zu machen, (2.) eine Fremdkultur besser zu verstehen und dadurch (3.) in interkulturellen Situationen konstruktiv und angemessen zu handeln. Tab. 26 stellt zusammenfassend Gefahren und Möglichkeiten von Kulturdimensionen dar.
| Kulturelle Dimensionen können sein: | Kulturelle Dimensionen sollten sein: |
| Kategorisierung und Klassifizierung kultureller Unterschiede | Orientierungsrahmen und Erklärungsansätze kultureller Unterschiede |
| statisch, starr | oszillierend, schwingend |
| schwarz/weiß | hellgrau bis dunkelgrau |
| »entweder oder« | »sowohl als auch« |
Tab. 26: Gefahren und Möglichkeiten von Kulturdimensionen (Barmeyer 2000, 129)
Zirkuläre Dynamik von Kulturdimensionen
Ein interessanter konstruktiver Ansatz ist, entsprechend einem postmodernen fluiden und flexiblen Kulturverständnis, Kulturdimensionen dynamisch und zirkulär zu denken und zu nutzen. Dabei ist die Grundidee, starre Bipolarität durch dynamische Zirkularität aufzulösen. Gegensätze befinden sich also nicht als Pole auf einer Geraden, sondern sind gegenüberliegende Elemente eines Kreises, was auf systemisches Denken und Kybernetik verweist. Kybernetik beschreibt Aufbau, Funktionen und Gesetzmäßigkeiten (wie Selbstregulation, lineare und nichtlineare Rückkopplung) von Systemen (Wiener 1952). Dieses Zirkuläre »sowohl als auch« kann metaphorisch wie folgt beschrieben werden:
»Think of collectivism as water and individualism as molecules of ice. As the temperature changes, the ice crystals expand. At all times you have some water and some ice. Thus cultures have both collectivist and individualist elements all the time and are changing all the time. At any one point of time, we take a picture of the culture when we really should be taking a movie of constantly changing elements. In this metaphor, the earth is entering a new ice age!« (Triandis 1995, 173–174)
Im Sinne dieses dynamischen Verständnisses von Kultur stellen Hampden-Turner und Trompenaars (1997), im Rahmen einer von Geert Hofstede im International Journal of Intercultural Relations initiierten wissenschaftlichen Kontroverse, das eher statische (Hofstede) und das eher dynamische (Hampden-Turner/Trompenaars) Konzept von Kulturen und Kulturdimensionen gegenüber (Tab. 27): »Instead of running the risk of getting stuck by perceiving cultures as static points on a dual axis map, we believe that cultures dance from one preferred end to the opposite and back.« (Hampden-Turner/Trompenaars 1997, 27)
| Hofstedes Annahme ist, dass … | Trompenaars Annahme ist, dass … |
| … Kulturen statischen Punkten in einem zweiachsigen Diagramm entsprechen. | … Kulturen sich zwischen einem bevorzugten Extrem und seinem Gegenteil hin und her bewegen. |
| … eine Kulturdimension, eine ihr entgegengesetzte ausschließt. | … eine Kulturdimension versucht, die ihr entgegengesetzte mit einzubeziehen. |
| … »unabhängige« Faktoren »abhängige« Variablen erklären. | … Wertedimensionen sich in Systemen selbst organisieren, um neue Bedeutungen hervorzubringen. |
| … anerkannte statistische Verfahren kulturell neutral und wertfrei sind. | … anerkannte statistische Verfahren kulturell voreingenommen und wertend sind. |
| … Kulturen linear sind und in gewisser Weise festgeschriebene Eigenschaften besitzen. | … Kulturen Kreisen entsprechen, die ihr entgegengesetzte mit einbeziehen. |
| … Daten von IBM aussagekräftiger sind als aus akademischer Forschung gewonnene Erkenntnisse, und besser die Herangehensweisen des Managements widerspiegeln. | … von IBM gewonnene Daten bloß Imitationen akademischer Forschung sind und die Regelkonformität des Managements widerspiegeln. |
| … er durch induktives Vorgehen seine Kategorien aus den IBM-Daten ableiten und damit seine eigenen Skalen entwickeln konnte. | … Hofstede durch die Wahl eines induktiven Denkansatzes nur diejenigen Skalen reproduziert hat, aus denen IBM bereits seine Fragen abgeleitet hatte. |
| … es keine bessere Platzierung innerhalb der Quadranten (kombinierter Kulturdimensionen) und somit auch keine Antwort auf die Fragen gibt, wie nun vorzugehen sei und in welche Richtung die Entwicklung stattfinden solle. | … es keine bessere Möglichkeit gibt, als, ausgehend von den sieben Dimensionen, gegensätzliche Werte zu integrieren und zum Ausgleich zu bringen sowie auf diese Weise bessere Ergebnisse zu erzielen. |
| Zu guter Letzt, was voraussichtlich folgen wird, dass … | |
| … A priori Konzepte wie das »Dilemma«-Konzept metaphysische Konstrukte sind, mit keinerlei empirisch begründeter Daseinsberechtigung, überprüfbarer Validität oder Möglichkeiten der Verifizierung. | … Dilemmata schon seit der klassischen griechischen Tragödie Teil einer jeden Kultur sind, von den ursprünglichen Gegensätzen im Taoismus, über Shakespeare bis hin zu den Binärcodierungen der Anthropologen der heutigen Zeit. |
| … alle Kulturen sich unterscheiden, wenngleich diese Abweichungen als relativ signifikant bezüglich der Ausprägung von lediglich vier Variablen verstanden werden können. | … alle Kulturen sich mit identischen Dilemmata konfrontiert sehen, sich jedoch hinsichtlich der gefunden Lösungen unterscheiden, welche Gegensätze auf kreative Weise überwinden. |
Tab. 27: Grundannahmen und methodische Herangehensweise an kulturvergleichende Forschung bei Hofstede und Hampden-Turner/Trompenaars (Hampden-Turner/Trompenaars, 1997, 156; unsere Übersetzung)