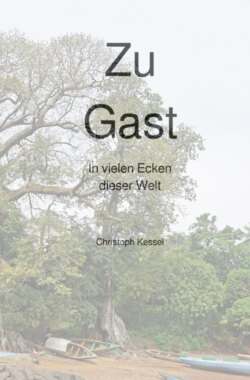Читать книгу Zu Gast - Christoph Kessel - Страница 7
Zu Gast bei den „No Problem“-Leuten
ОглавлениеKaribik – Januar/Februar 2001
Dank meiner Eltern hatte ich seit meiner frühesten Kindheit mehrmals im Jahr die Gelegenheit zu reisen. Mit eineinhalb Jahren war ich erstmals zu Gast im Ausland, genauer gesagt in Österreich. Nach der Überlieferung meiner Eltern habe ich das Laufen 1974 am Tag des WM-Finales Deutschland gegen Holland im damaligen Familienurlaub gelernt. Public Viewing gab es noch nicht, und während mein Vater in der Kneipe des Gasthauses den WM-Sieg von Kaiser Franz und Co. am Fernseher sah, schaute mir im Obergeschoss meine Mutter auf dem Flur zu, wie ich die ersten Schritte ohne fremde Hilfe hinbekam. Mit zwei Jahren stieg ich das erste Mal ins Flugzeug ein. Da ich so jung war, habe ich an den Flug heute keine Erinnerungen mehr. Das änderte sich im Folgejahr, als es nach Nordafrika gehen sollte. Auf diese Reise hatte ich keine Lust. Warum, weiß ich heute nicht mehr, aber es ist bisher die einzige Reise meines Lebens gewesen, bei der bei mir keine Vorfreude aufkam. Wir nahmen in Mainz den Zug zum Frankfurter Flughafen. Damals kam mir eine Zugfahrt nach Frankfurt ellenlang vor. Da ich wusste, dass wir, um nach Afrika zu gelangen, das Meer überqueren mussten, fragte ich nach der Rheinüberquerung mit dem Zug hoffnungsvoll, ob wir endlich dort angekommen wären, „in dem Afrika“. Als ich verstand, dass wir noch gar nicht in diese Blechröhre eingestiegen waren, da wir uns ja erst auf dem Weg zum Flughafen befanden, war meine „Geduld“ zu Ende und ich hatte überhaupt keine Lust mehr auf Afrika. Ich verkündete lauthals, dass ich nicht in das Flugzeug einsteigen würde. Dummerweise parkte der Flieger auf einer Gebäudeposition, so dass ich gar nicht bemerkte, wie wir über die Fluggastbrücke in den Flieger spazierten. Viel zu spät begriff ich, dass ich „überrumpelt“ worden war und nun doch im Flugzeug saß. Mein verbaler Protest endete bald, da es spätabends war und ich im Flieger einschlief.
Viele Flüge kamen zwischen Ende der 1970er und Anfang der 1990er Jahre nicht mehr hinzu, da Familienurlaube per Flugzeug gemeinsam mit meiner älteren Schwester für uns finanziell nicht mehr drin waren. Denn Kleinkinder ab zwei zahlten bereits 50 Prozent des Erwachsenentarifs und Kinder über zwölf sogar den vollen Preis. Billigflieger gab es in den 1980er Jahren noch nicht. Nachhaltiges Reisen spielte damals keine Rolle, aber durch die hohen Flugpreise hielt sich der Flugverkehr und damit die Belastung der Umwelt in Grenzen. Die Entscheidung der EU, den Flugverkehr in Europa zu liberalisieren, brachte Geschäftsmodelle auf, die es heutzutage fast allen Bevölkerungsschichten ermöglichen, das Flugzeug zu nehmen. Man kann diese „Demokratisierung“ natürlich gut finden. Doch für das Produkt Flug liegt die Zahlungsbereitschaft vieler Reisender mittlerweile so dermaßen niedrig, so dass es viele normal finden, für das Taxi zum Flughafen mehr zu bezahlen als für den Flug. Leider ist es auch vielen Reisenden egal, wie das Personal der Billigflieger behandelt wird. Entscheidend ist für viele nicht nur im Luftverkehr am Ende der Preis, den sie persönlich und nicht die Allgemeinheit zu zahlen haben. Schließlich werden manche Flugverbindungen von Regionalflughäfen subventioniert, so dass der Steuerzahler oftmals für den niedrigen Flugpreis draufzahlen darf, damit Hinz und Kunz für ein paar Euro aus dem Hunsrück oder aus Westfalen nach Malle düsen können.
Dass das Flugzeug für uns als Transportmittel ausfiel, hielt meine Eltern nicht davon ab, mit uns auf Reisen zu gehen. Mit dem Auto erkundeten wir viele Nachbarländer Deutschlands, und gerade die Reisen durch das heutige Ex-Jugoslawien Ende der 1980er Jahre hatten teilweise schon Abenteuer-Charakter, sei es durch die nicht geteerten Straßen Montenegros, die Sprachbarriere in Bosnien oder den Wintereinbruch an Ostern an den Plitvicer Seen im heutigen Kroatien.
Erst nachdem ich die Schule beendet hatte, bin ich wieder mit dem Flugzeug unterwegs gewesen. Da Ausbildungen immer im Spätsommer beginnen, hatte ich Anfang 1993 so viel „Resturlaub“ des alten Jahres angesammelt, dass ich praktisch „gezwungen“ war, Urlaub zu nehmen. Meine ersten Reisen ohne Eltern ab dem Ende der 1980er Jahre hatte ich fast ausschließlich in die Schweiz unternommen, um Wandern oder Radfahren zu gehen – immer vom späten Frühjahr bis in den Herbst hinein. Wohin sollte ich aber jetzt im Winter 1992/1993 reisen? Einer meiner besten Freunde kam auf die Idee, in Afrika wandern zu gehen. „Da ist es warm, und wir können den höchsten Berg Afrikas besteigen“. So starteten wir beide auf unsere erste Fernreise überhaupt – nicht in vergleichsweise einfache Reiseländer wie die USA oder Thailand, sondern nach Kenia und Tansania, um den Kilimandscharo zu besteigen.
Von Afrika sehr angetan, unternahm ich mit zwei Freunden nach dem Ende meiner Berufsausbildung meine bis heute zweitlängste Reise: Von Mainz reisten wir innerhalb von zehn Wochen bis nach Kapstadt, wobei wir nur Teilstrecken mit dem Flugzeug zurücklegten. Es war ein prägendes, wunderbares Abenteuer. Gleichzeitig waren wir alle drei manchmal wegen der anderen genervt. Dieses Gefühl wurde bei mir auf die Spitze getrieben, als ich zwei Jahre später mit vier Freunden durch Namibia, Botswana und Simbabwe reiste. Ich war zuvor mit allen vieren bereits verreist und dachte, diese Reise würde ein grandioses Abenteuer mit den, abgesehen von meiner Familie, damals wichtigsten Menschen meines Lebens.
Wir bildeten allerdings eine Gemeinschaft, die sich unwillkürlich abschottete, und es war nahezu unmöglich, mit der Außenwelt, sprich den Einheimischen, mehr als den üblichen Kontakt mit Leuten in der Tourismusbranche (Mietwagenfirma, Hotel, Restaurant) zu erhalten. Das frustrierte mich enorm, denn gerade in Afrika sind es die Begegnungen mit den Menschen, an die ich mich noch heute gerne erinnere. Daher entschloss ich mich 1998, erstmals alleine nach Afrika zu reisen. In Dakar, der Hauptstadt des Senegals, traf ich am Hauptbahnhof am ersten richtigen Reisetag Tanja aus dem Odenwald. Am Ende bin ich während dieser Westafrika-Reise exakt drei Tage alleine gereist, und zwar die drei Tage zwischen der Landung und der Abfahrt des Zuges in Dakar. So musste der Plan mit dem Alleinreisen ein weiteres Jahr warten. 1999 bin ich schließlich alleine mit dem Fahrrad von Mainz nach Biarritz an die französisch-spanischen Grenze geradelt. Danach war ich vom Alleinreisen angefixt, so dass ich im Januar 2001 alleine auf Fernreise ging: Ab in die Karibik!
Dachte ich bisher an die Karibik, fielen mir hauptsächlich die Begriffe „Pauschaltourismus“ und „All-Inclusive“ ein. Dieses Fleckchen Erde besteht allerdings aus ziemlich vielen Inseln, die nur zum Teil von Touristen überschwemmt werden. Von den meisten Karibik-Inseln hat man wahrscheinlich noch nie etwas gehört, während die Bekanntesten vielleicht Kuba und die Insel Hispaniola sind. Letztere teilen sich die beiden Länder Haiti und die Dominikanische Republik. Beide Inseln gehören zu den „Großen Antillen“. Wo es etwas Großes gibt, muss es auch etwas Kleines geben. Daher zog es mich auf dieser Reise auf die so genannten „Kleinen Antillen“ zum Inselhüpfen von Nord nach Süd.
Am liebsten reise ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, die auch die Einheimischen nutzen: per Bus, per Bahn, mit dem Schiff und möglichst selten mit dem Flugzeug, so wie während der Afrika-Durchquerung mit meinen beiden Freunden 1995. Für mich ist der öffentliche Personenverkehr mit das Spannendste, was unsere Welt zu bieten hat. Schließlich möchte ich in fernen Ländern nicht nur Landschaften, Städte, Fußballstadien und Museen entdecken, sondern mich auch auf das Leben vor Ort einlassen. Das klappt meiner Meinung nach am besten, wenn ich dort möglichst auf Taxis und Mietwagen verzichte. Ich stelle mich da lieber mit den Einheimischen in eine Schlange und warte auf den Bus, das Schiff oder den Zug. Auf dieser Reise funktionierte dies nur teilweise. Ein Inselhüpfen ausschließlich mit Schiffen wäre in der Karibik leider nur per Kreuzfahrtschiff möglich. Viel zu selten existieren Fähren, die die Inseln (und Länder) miteinander verbinden. So war mir bereits vor der Reise bewusst, dass ich von meinem Vorsatz würde abweichen müssen, möglichst ohne Flugzeuge eine Region zu entdecken. Trotzdem wurde diese Reise alles andere als ein Urlaub, sondern das, was mich immer wieder in den Bann zieht: ein Reisen von Insel zu Insel bis hinunter nach Südamerika. Dieser Kontinent war noch Neuland für mich. Den Fuß, abseits eines Flughafens, erstmals auf einen neuen Kontinent zu setzen, war für mich immer etwas Besonders. Dies war mir außerhalb Europas bisher nur in Asien gelungen. 1995 hatte ich auf der Reise von Mainz nach Kapstadt mit der Fähre in Istanbul den Bosporus überquert. Afrika hatte ich, wie erwähnt, „unfreiwillig“ 1975 mit dem Flugzeug in Tunis erreicht. Gleiches gilt für Nordamerika (1994 in New York) und Ozeanien (1999 in Sydney). Eine Antarktis-Reise musste noch sieben Jahre warten.
Der Anflug auf die Antillen-Insel St. Martin gilt als einer der spektakulärsten weltweit. Leider saß ich seit dem Abflug in Paris acht Stunden zuvor in der Mittelreihe des Flugzeugs. Natürlich landeten wir nicht zwischen Achttausendern wie in Nepal. Weil ich aber in der Mitte saß, sah ich bis zum Touchdown kein Land, sondern nur Meer. Die Landebahn des Prinzessin-Juliana-Flughafens wurde auf einem schmalen Inselstreifen angelegt. So vernahm ich durch das Quietschen der Räder das Aufsetzen auf der Bahn. Ich sah aber beim Ausrollen weiterhin nur Meer. Sicherlich läuft eine Notwasserung anders ab, aber es kam mir komisch vor, mit 300 Sachen gelandet zu sein und links und rechts zog an den Fenstern kein Land vorbei. Erst als das Flugzeug in Schrittgeschwindigkeit seine Parkposition erreicht hatte, sah ich Palmen und das kleine Flughafengebäude.
Nachdem ich den Flughafen verlassen hatte, begegnete ich kaum noch anderen Touristen. Ich nahm an, dass sich die meisten in ihre Ressorts zurückzogen und diese erst wieder verließen, wenn der Rückflug anstand. So erging es mir auf fast allen Inseln dieser Reise. Die meiste Zeit war ich alleine unterwegs und traf weder auf Pauschaltouristen noch auf Rucksackreisende, wie ich es aus anderen Weltregionen gewohnt war.
Die kleine Antillen-Insel St. Martin ist besonders klein. Ihre Inselfläche entspricht dem Stadtgebiet von Mainz. Beansprucht wird die Insel von zwei Ländern: den Niederlanden, die die Insel „Sint Maarten“ nennen und von Frankreich, das von „Saint Martin“ spricht. Auf St. Martin kursierten sogar drei verschiedene Währungen: Der Antillen-Gulden, der Französische Franc und der US-Dollar. Letzterer war die dominante Währung, weil die Insel in der Nähe der USA liegt und Amerikaner hier gerne ihren Urlaub verbringen. Das konnte ich auch am Preisniveau erkennen: Je weiter ich im Verlauf der Tour nach Süden reiste und je weiter ich mich von den USA entfernte, desto günstiger wurden das Essen, das Übernachten und das Fortkommen.
St. Martin war zum Erholen ideal. Seine Strände, die bis an den Flughafen heran reichen, gelten als der Mekka der „Plane Spotter“, die sich einen Spaß daraus machen, Bilder am Strand mit landenden Maschinen zu schießen. Diese Freizeitbeschäftigung ist nicht ganz ungefährlich, da die Wirbelschleppen der landenden Maschinen Strandbesucher umwerfen können. Da ich in Mainz täglich genug Fluglärm ausgesetzt bin, musste ich mir das nicht noch am Strand von St. Martin geben. Daher hatte ich vielmehr das große Bedürfnis, meine Umgebung zu erkunden und „Bergsteigen“ zu gehen: Selbstverständlich musste ich den höchsten Berg des Königreiches der Niederlanden bezwingen. Dieser liegt 60 Kilometer westlich von St. Martin auf der Insel Saba. Innerniederländisch reiste ich mit einem Schnellboot auf die Nachbarinsel. Der Aufstieg dauerte eine Stunde und ich erreichte den Gipfel des Mt. Scenery in 887 Metern Höhe. Auf der ganzen Insel schien es keine Touristen zu geben. Jeder kannte jeden und Fremden gegenüber waren die Menschen sehr freundlich. Die Siedlungen erinnerten mich ein wenig an Bergdörfer in den Alpen. Allerdings machte mir der immergrüne Dschungel im Hintergrund klar, dass ich in der Karibik unterwegs war.
Die andere Insel, die ich von St. Martin aus besuchte, heißt Anguilla. Sie gehört zu Großbritannien. Da es auf Anguilla keine öffentlichen Verkehrsmittel gab, kam mein Roller, den ich vor dem Abflug in Deutschland an meinem Rucksack befestigte und als aufzugebendes Gepäck mitnahm, erstmals zum Einsatz. Klappräder gab es noch nicht, und ein richtiges Fahrrad mitzunehmen, schien mir einfach zu teuer, da viele Airlines für den Radtransport einen Aufschlag verlangten.
Mit meinem Roller erregte ich auf Anguilla überall großes Aufsehen. Ich war anscheinend die erste Person, die sich mit einem solchen Gefährt über das Land fortbewegte. Obwohl ich es allen Neugierigen anbot, traute sich leider niemand, damit zu fahren. War das Rollen über die asphaltierte aber wenig befahrene Hauptstraße Anguillas sehr angenehm, erinnerte mich zuvor die Überfahrt nach Anguilla mehr an einen Rafting-Trip. Das Boot flog permanent von Welle zu Welle. Ich war sehr erleichtert, diese „Schlaglochpiste“ auf dem Wasser heil überstanden zu haben. Die Insel selbst ist nur wegen ihrer paradiesischen Strände erwähnenswert. Diese entsprachen vollkommen dem Karibik-Klischee: weiß, leer, türkisblaues Wasser, und überall war kühles Carib-Bier verfügbar. Das Bier machte die Rückfahrt mit dem Roller zur Anlegestelle natürlich noch etwas lustiger.
Um meine Reise von St. Martin in Richtung Südamerika fortzusetzen, war ich nun auf das Flugzeug angewiesen. In diesem Teil der Welt sind die meisten Landebahnen so kurz, dass dort keine Jets sondern Propellermaschinen zum Einsatz kamen. Ferner waren die Flugzeiten so gering, dass es keinen Reiseflug gab. Vielmehr hatte das Fliegen in der Karibik mehr mit einem Aufzug gemein. Gerade in St. Martin zog die Maschine direkt nach dem Abheben recht steil nach oben, um dann nach wenigen Sekunden in eine Rechtskurve überzugehen, da sich hinter dem Flughafen der einzige Hügel der Insel befand und bedrohlich nah erschien. Zehn Minuten später war ich schon in einem neuen Land gelandet: St Kitts und Nevis.
Die bisher besuchten Inseln St. Martin, Saba und Anguilla gehörten immer noch europäischen Kolonialmächten. In St. Kitts und Nevis traf ich auf ein Novum der besonderen Art: Die beiden Inseln waren jeweils autonom, so dass jede beispielsweise ihre eigenen Briefmarken ausgab. Auf St. Kitts stehen noch Festungen aus dem 17. Jahrhundert, die als das „Gibraltar der Karibik“ bezeichnet werden. Innerhalb der Gemäuer gab es riesige Grünflächen. Diese würden sich optimal für das „Open Ohr“ eignen, das alljährlich an Pfingsten auf der Zitadelle in Mainz stattfindet. Dort hatte es über den Lärm in den letzten Jahren regelmäßig Anwohner-Beschwerden gegeben. Auf St. Kitts hätte sich mangels Menschen gar niemand beschweren können, wenn mal wieder die halbe Nacht durchgetrommelt würde.
Von St. Kitts setzte ich mit dem Schiff nach Nevis über, um dort durch den Dschungel um die Insel herum zu wandern. Auf der Tour begegnete ich vielen Affen, verschiedenen Schmetterlingen und zahlreichen Kolibris, aber keinen anderen Wanderern. Zurück auf St. Kitts flog ich wieder innerhalb weniger Minuten nach Antigua weiter, das zu Antigua und Barbuda gehört. Anscheinend war es Mitte des 20. Jahrhunderts in Großbritannien Sitte gewesen, die Inseln immer als Pärchen in die Unabhängig zu entlassen.
Das Land Antigua und Barbuda behauptet, für jeden Tag im Jahr einen Traumstrand zu bieten. Natürlich konnte ich nicht allen 365 Stränden einen Besuch abstatten, aber die Insel Antigua ist ziemlich zerfranst und bildet tatsächlich hunderte von kleinen Buchten mit weißem Sandstrand und türkisblauem Wasser. Leider hatten die Briten den gesamten tropischen Regenwald abgeholzt, um Zuckerrohr anzupflanzen. Deshalb standen, quer über die Insel verstreut, viele bis zu 200 Jahre alte Windmühlen herum, in denen das Zuckerrohr zerquetscht wurde. Daraus entsteht bis heute der berühmte karibische Rum. Dieser war, in eine Ein-Liter-Flasche abgefüllt, so teuer oder billig, wie ein Liter Bier.
Manchmal kam ich mit dem Flieger in der Karibik nicht weiter, wie ich in Antigua feststellen musste. Wenn der Zielflughafen von Lava verschüttet worden war, war das mit dem Landen natürlich schwierig. So bin ich mit dem Boot vom paradiesischen Antigua nach „Hot hot hot“ gefahren. Diese Bezeichnung steht für Montserrat, die Insel, auf der 1995 nach 400 Jahren Schlaf, der Vulkan Souffrière ausgebrochen war. Damals musste die gesamte Insel evakuiert werden. Zum Zeitpunkt meines Besuchs waren zwei Drittel der Insel gesperrt, da es ständig neue Eruptionen gab. Bereits vom 40 Kilometer entfernten Antigua konnte ich die Rauchwolke über dem Vulkan deutlich erkennen. Als ich mich von diesem Ungetüm nur noch vier Kilometer entfernt befand, kam mir das ziemlich unheimlich vor, und ich hatte ein flaues Gefühl im Magen. Permanent wurden Felsbrocken aus dem Krater herausgeschleudert, die jedes Mal beim Hinabrollen ins Tal eine riesige Staubwolke aufwirbelten. Die Massen an Lava hatten überall verbrannte Erde zurückgelassen, und wie der Flughafen waren viele Dörfer immer noch von Lava bedeckt. Die Menschen, die ihrer Heimat nicht endgültig den Rücken gekehrt hatten und auf Montserrat geblieben waren, waren die nettesten, die ich bisher getroffen hatte. Sie luden alle ein, diese Insel zu besuchen. In den Medien war in der Vergangenheit immer wieder berichtet worden, man könnte die Insel nicht besuchen oder ein Aufenthalt wäre zu gefährlich. Durch die wenigen Touristen, wir waren sechs Personen, erhielten die Bewohner wenigstens ein bisschen Geld zum Überleben. Ansonsten waren sie auf die Hilfe des Mutterlandes Großbritannien angewiesen. Von Montserrat schipperte ich wieder nach Antigua zurück, nachdem ich auf der Feuerinsel einen der schönsten Einreisestempel weltweit erhalten hatte: Ein grünes Kleeblatt, das ja für Glück steht. Den freundlichen Menschen auf Montserrat wünschte ich beim Wiederaufbau ihrer Heimat alles Glück der Welt.
War ich bisher mit relativ großen Propellermaschinen durch die Karibik geflogen, die mindestens 50 Leuten Platz boten, ging es am darauffolgenden Tag mit einem 19-Sitzer vom Typ Dornier 228 nach Guadeloupe. Auf Antigua lief das Fliegen noch ein bisschen anders ab als bei uns in Mitteleuropa. Zunächst wussten wir sieben Passagiere nicht, welches das richtige Flugzeug war, denn auf dem Rollfeld standen mehrere Flieger herum, und wir sollten zu unserer Maschine laufen. Also fragten wir bei den Piloten nach, die zum Glück bereits im Cockpit saßen. Da es bei diesen Maschinentypen immer eine separate Cockpittür gibt, war das Erfragen des Zielflughafens ziemlich einfach. Nach ein paar vergeblichen Anfragen fanden wir schließlich unseren Flieger. Kaum war die Passagiertür verschlossen, ging es schon los. Es gab keine Trennung zwischen Cockpit und Passagierkabine, so dass wir Passagiere die Tätigkeiten im Cockpit neugierig beobachten konnten. Ein Flugbegleiter befand sich nicht an Bord, weshalb die Sicherheitseinweisung auf dem kurzen Rollweg zur Startbahn vom Copiloten übernommen wurde.
In Guadeloupe fühlte ich mich fast wie in Frankreich. Vieles lief so ab wie im Mutterland 7.000 km entfernt. Guadeloupe gehört zur EU. Alle Autos fuhren mit EU-Nummernschildern durch die Gegend, und der Euro würde bald das Zahlungsmittel werden. Das Beste an Guadeloupe war das Essen. Nach all den englischsprachigen Ländern und der nicht wirklich spannenden Englisch angehauchten Küche mal wieder Croissants zu futtern und guten Rotwein zu genießen, war paradiesisch. Abends fühlte ich mich schon fast heimisch. Auf Guadeloupe startet die Hochphase der fünften Jahreszeit wie in Mainz direkt an Neujahr, so dass ich im Januar das närrische Treiben bei angenehmen 25 Grad genießen konnte. Das war das erste Mal, dass ich bei einem Fastnachtsumzug nicht frieren musste und das Ganze in Shorts und T-Shirt bestaunen konnte. Der Umzug bestand ausschließlich aus Musikgruppen, der Guggemusik nicht unähnlich. Die Leute tanzten ungezwungen auf der Straße, ohne dass ich auch nur einen Polizisten sah, der das Treiben regeln musste. An allen Ecken und Enden gab es die unterschiedlichsten Getränke und superleckeres Essen zu kaufen. Dass es weder für die Zuschauer noch für die Autos Absperrungen gab, war selbstverständlich. Natürlich endete alles in einem großen bunten Chaos...aber so macht die Straßen-Fastnacht ja erst richtig Spaß.
Nach dem vielen Fliegen von St. Martin via St. Kitts und Antigua nach Guadeloupe war ich froh, dass ich nun mein Inselhüpfen mit dem Schnellboot „L‘Express des Iles“ fortsetzen konnte. Erste Station war Dominica. Nein, nicht die Dominikanische Republik. Diese liegt 1.000 km weiter nordwestlich. Anders als in der „Dom Rep“ gab es hier keine All-Inclusive-Clubs, bei denen die Einheimischen recht wenig von den Besuchern hätten, da ja alle Mahlzeiten im Club im Heimatland entrichteten Preis inkludiert sind. Wen sollte es da zum Essen und Trinken noch nach draußen ziehen?
Christoph Kolumbus hat Dominica treffend als ein zusammengeknülltes Stück Papier beschrieben. Schließlich besteht die Insel tatsächlich nur aus engen Tälern und steilen Bergen. Das war genau der Grund, warum ich mich auf diese Insel bereits in Deutschland so gefreut hatte: Das herrliche Wandern im Regenwald und in den Bergen.
Schließlich war ich nicht vom „Alles-in-drei-Tagen-Sehen-Virus‘“ befallen. Ich war froh, in Dominica mehrere Tage zu verbringen. Der Name Dominica stammt auch von Kolumbus: Er besuchte sie erstmals an einem Sonntag, was auf Italienisch „Domenica“ heißt. Der Name wird von den Einheimischen „Do-mi-niiiiiie-ca“ ausgesprochen und unterscheidet sich damit noch ein bisschen mehr von der „Dom Rep“. Dominica hatte es mir angetan. Ich hatte bisher fast den ganzen Tag über Reggae gehört: auf der Straße, im Minibus, am Flughafen, im Restaurant, im Hotelzimmer und irgendwo in der Natur. In Dominica hörte ich hauptsächlich das Rauschen der vielen Bäche und Flüsse, den Wind, der durch die Baumwipfel pfiff sowie das Zwitschern der Vögel, die auf der ganzen Insel umherumflogen. Da Dominica, wie fast alle Inseln der kleinen Antillen, vulkanischen Ursprungs ist, gibt es zahlreiche geologische Kuriositäten. So wanderte ich zum Beispiel zum „Boiling Lake“. Der See sah aus wie ein riesiger Kochtopf voller Nudelwasser. Es kochte und blubberte auf der gesamten Oberfläche. Am Seeufer war ich von einer riesigen Dampfwolke umgeben. Je näher ich dem Ufer kam, desto weniger konnte ich etwas erkennen, da meine Brillengläser komplett beschlagen waren.
Der Weg zum „Nudelwasser“ führte zunächst durch tropischen Regenwald, der mit farbenprächtigen Blumen gespickt war. Später erreichte ich das „Valley of Desolation“. Dieses Tal hatte sich nach einem Vulkanausbruch vor hundert Jahren in eine Wüste mitten im Regenwald verwandelt. Dank der Schwefelsäure stank es überall wie auf einer ungereinigten Bahnhofstoilette. Aufgrund verschiedener mineralischer Ablagerungen war die Erde kunterbunt gefärbt: von Schwarz über Rostbraun und Gelb bis Weiß. In allen Löchern blubberte der kochende Schlamm, und der kleine, harmlos aussehende Bach bestand aus kochendem Wasser. Aufgrund ihrer Länge und des steilen Aufstiegs war diese Wanderung alles andere als ein Spaziergang. Folglich nahmen diese Strapazen nur sehr wenige Wanderer auf sich. Diese relative Abgeschiedenheit war auch ein Grund, warum ich mich einem einheimischen Führer anvertraute. So fühlte ich mich sicher, denn bei dem Weg hätte ich mir leicht den Fuß verknacksen können. Außerdem lernte ich noch ein bisschen etwas über den Alltag in Dominica, und meine Begleitung hatte ein entsprechendes Auskommen.
Am nächsten Tag begab ich mich im Regenwald auf die Suche nach Papageien. Nach vier Stunden fand ich das Wappentier Dominicas, den Imperial Parrot, fünf Meter von mir entfernt in einem Baum sitzen. Glücklicherweise fühlte er sich durch mich nicht bedroht, sondern schaute mich nur sehr neugierig an. Diese Papageien werden bis zu 50 Zentimeter groß und sind mit Ausnahme der lilafarbenen Brust ausschließlich grün gefiedert. Ein wirklich imposantes Wappentier im Vergleich zu unserem dürren Bundesadler, den man in der Natur Deutschlands leider immer weniger zu Gesicht bekommt.
Später unternahm ich mit einem Einheimischen eine Ruderboot-Tour in den Mangroven des Indian Rivers. Der Name geht auf die indigenen Einwohner zurück, die in Dominica noch zu Hause sind. Sie sind Nachfahren der Carib-Indianer, die der ganzen Region „Karibik“ den Namen gaben – und einem guten Bier schließlich auch. Leider sah ich sie kaum, da die „Caribs“ in ihrem eigenen abgegrenzten Territorium lebten. Ich wollte diese Menschen nicht wie in einem Zoo bestaunen und verzichtete daher auf einen Besuch.
Wo es viel Regenwald und viele Berge gibt, sind Wasserfälle nicht weit. So auch auf Dominica. Erneut lief ich auf ziemlich engen, steilen Pfaden durch den Regenwald. Gleich mehrere Wasserfälle, die bis zu 100 Meter hoch waren, belohnten mich für die beschwerliche Wanderung. Stundenlang sah ich keine Menschenseele, aber der Weg war gut markiert, so dass ich mich nicht verlaufen konnte. An einer Wegkreuzung sollte laut Touristen-Info eine Boa Constrictor leben. Diese Würgeschlange hatte aber heute anscheinend ihren freien Tag, so dass ich mit einigen gereizten Krabben, die mich ständig angriffen, zufrieden geben musste. Aber einige andere, ebenfalls ungiftige Schlangen lagen schon mal auf dem Weg. Nicht nur die Leute waren auf Dominica ziemlich entspannt, sondern auch die Tiere. Schließlich hatten die Schlangen überhaupt keine Lust, mir mal Platz zu machen. So musste ich häufig Umwege durchs Unterholz nehmen, um voran zu kommen.
Die Abende auf Dominica waren eher als ruhig zu bezeichnen, wenn nicht gerade wieder jemand mit seiner Proletenschüssel durch die Straße rauschte und die Bässe die Klapperschüssel fast zerlegten. Die Mucke erinnert laut Experten mehr an Calypso als an Reggae, was sich aber für meine Ohren recht ähnlich anhörte. Mehr Wert auf Details legte ich bei den Getränken. Der Erdnuss-Punsch und der „Bush-Rum“ waren es tatsächlich wert, probiert zu werden. Letzterer war Rum, der mit lokalen Kräutern angereichert wurde. Er schmeckte extrem komisch, aber gut. Auch das Kubuli-Bier war richtig süffig und nicht zu verachten.
Während gerade in Europa die Schweinepest grassierte, wurde ich, alleine schon aus finanziellen Gründen, zum Vegetarier. Fleisch war dank des schwachen Euros unbezahlbar. Wahrscheinlich gab es in der Karibik keine Agrar-Subventionen und hoffentlich auch keine Massentierhaltung, so dass hier dem Fleischesser ein entsprechend höherer Preis für ein Stück Fleisch abverlangt wurde. Das kulinarische Vergnügen kam aber keineswegs zu kurz. Zum Frühstück gab es Bananenbrot und Kokosnussbrötchen, was ziemlich sättigend war. Daher aß ich mittags nur Papayas, Bananen und anderes frisches Obst. Das beste Naturprodukt, das sowohl satt machte als auch den Durst löschte, waren die Kokosnüsse. Die in Deutschland angebotenen Kokosnüsse bestehen aus einer harten Schale und hartem Kokosnussfleisch, das sich schwierig aus der Nuss löste. Die Kokosnüsse der Karibik waren große unförmige grünlich bis gelbe Klumpen. Der Verkäufer schlug mit der Machete die Schale ab. Aus dem so entstandenen Loch konnte ich den halben Liter Flüssigkeit trinken. Diese schmeckte nur leicht nach Kokosnuss. Einmal ausgetrunken, spaltete der Verkäufer sie und hieb eine Kerbe hinein. Die Kerbe riss ich heraus und löffelte danach das glitschige Kokosnussfleisch aus den beiden Hälften heraus. Dieses kulinarische Highlight dauerte natürlich eine Weile. Aber diese Zeit hatte ich ja zur Genüge. Abends gab es Brotfruchtchips oder frittierte Kochbananen, die roh an ihren roten Schalen zu erkennen waren und auch ziemlich satt machten.
Leider musste ich von Dominica irgendwann Abschied nehmen. Aber das Eiland steht ganz oben auf meiner Liste, wenn es darum geht, einer bereits besuchten Karibikinsel nochmals einen Besuch abzustatten. Der „L‘Express des Iles“ brachte mich nach Fort-de-France, in die Hauptstadt von Martinique. Damit war ich erneut in die EU eingereist. Martinique bildet mit Guadeloupe ein französisches Überseedepartement. Da die Preise in Euro kalkuliert wurden, lag das Preisniveau auf Guadeloupe und Martinique unter dem der Nachbarinseln, auf denen mit dem Eastern Caribbean Dollar (EC) bezahlt wurde. Der EC war an den US-Dollar gekoppelt und völlig überbewertet. Übernachtungen und Lebensmittel waren auf den Inseln, auf denen ich mit EC zu zahlen hatte, recht teuer. Außerdem fehlten auf den nördlichen Kleinen Antillen, die den EC nutzten, die französischen, kulinarischen Genüsse. Daher befand ich mich auf Martinique wieder im siebten Futter-Himmel. Durch die Präsenz von Supermärkten, die Käse und Joghurt im Angebot hatten, wurden diese paradiesischen Zustände noch verstärkt.
Auf Martinique besuchte ich das „Pompeji der Karibik“: die alte Hauptstadt St. Pierre, die 1902 durch den Vulkan Mont Pelée verschüttet worden war. Mich überkam ein komisches Gefühl, als ich in den Häuserruinen herumlief und im Hintergrund den aktiven Vulkan sah. Allerdings war, anders als auf Montserrat, die Zone um den Vulkan nie abgesperrt worden. Vielmehr hatten die Bewohner bereits 1904 mit dem Wiederaufbau begonnen. Dadurch standen die Ruinen nun mitten in der neuen Stadt und das Stadtbild sah extrem bizarr aus.
Meine letzte Station mit dem „L‘Express des Iles“ war St. Lucia. Auf dieser Insel versuchte die Tourismus-Verwaltung, Dominica mit seinem Ökotourismus ein bisschen nachzuahmen. Allerdings setzte sie dies überbürokratisch um. Sie hatte Wanderwege im Gebirge anlegen lassen, für die auf der gesamten Insel Werbung gemacht wurde. Ich kam dummerweise sonntags morgens auf die Idee, dort wandern zu gehen, doch das Eingangstor zum Weg war abgeschlossen. Wanderer sollten zehn US-Dollar für dieses Vergnügen zahlen, was ich auch gern getan hätte. Allerdings war der Wanderweg von freitags um 16 Uhr bis montags morgens verschlossen, und eine Box, in der ich das Geld hätte deponieren können, gab es auch nicht. Ich stand also vor der Wahl, wieder in den Hauptort zurückzufahren oder „einzubrechen“. Ich entschied mich für die zweite Variante und kletterte um das Tor herum auf den Weg. Danach genoss ich in aller Ruhe die Aussicht, denn der Pfad führte auf einem Grat entlang. Auf dem Rückweg kurz vor dem Eingangstor hörte ich plötzlich Stimmen und erinnerte mich daran, dass es ein „Verbrechen“ war, unerlaubt einzutreten. Also flüchtete ich einen Zehn-Meter-Hang durch den dichten Regenwald hinunter auf die Straße. Unten angekommen schauten mich die Einheimischen etwas verdutzt an, denn der etwas abrupte Abstieg hinterließ ziemlich viel Dreck auf meinen Klamotten, so, als hätte ich mich gerade eine Runde im Schlamm gesuhlt.
Der Ökotourismus-Strategie der Regierung sei Dank, bot St. Lucia wirklich schöne Wege, die teilweise sogar offen zugänglich waren, und auf denen ich auch andere Backpacker traf: Geneviève, eine kanadische Flugbegleiterin aus Montreal, finanzierte ihr Studium mit dem Job über den Wolken. Sie hatte bisher in Deutschland genau eine Stadt besucht, und zwar ausgerechnet Mainz, da die Crewmitglieder nach den Flügen nach Frankfurt dort übernachteten. Daher kannte sie auch das „Eisgrub Bräu“, die erste Mainzer Gasthausbrauerei, wo jeden Tag sehr viel ausländische Mainz-Besucher zu Gast sind. Die Welt ist manchmal in der Tat sehr klein. Wir wunderten uns beide, dass wir über Wochen hinweg keine anderen Backpacker getroffen hatten. Aber die kleinen Antillen waren schlicht und einfach zu teuer für den Geldbeutel eines durchschnittlichen Rucksackreisenden. Wir verbrachten ein paar schöne gemeinsame Tage auf St. Lucia, denn das Alleinreisen heißt ja nicht, dass man am liebsten gar keinen Menschen um sich haben möchte. Ich hatte mich auf den anderen Inseln abends nicht wirklich einsam gefühlt, aber sich mal wieder mit einem anderen Menschen auszutauschen, tat wirklich gut.
Das Positivste an St. Lucia waren die Einheimischen, die miteinander sehr rücksichtsvoll umgingen. Im Straßenverkehr ließen die Autofahrer andere an sich vorbei oder gewährten unerwartet Vorfahrt. Auf Straßen, auf denen kaum Busse fuhren, wurde ich immer gefragt, ob ich mitfahren wollte. Nie wollte jemand von mir Geld dafür sehen. Die Menschen und ihre Lebensweise erinnerten mich sehr stark an meine Erfahrungen in Afrika, und die afroamerikanischen Bewohner waren sehr stolz auf ihre Wurzeln. Überall sah ich die Farben des Kontinents(Grün, Gelb, Rot), und sein Umriss war auf den Autos als Aufkleber omnipräsent. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel erinnerten mich, je weiter ich den kleinen Antillenbogen nach Süden bereiste, immer mehr an Afrika, vor allem was die Auslastung betraf. Gingen in St. Kitts in den Bus zwölf Passagiere, passten nun bis zu zwanzig in das gleiche Modell hinein. Außerdem nahm die Lautstärke der überall zu hörenden Musik deutlich zu. Südlich von Martinique rate ich zu Oropax: Erstens wegen der Lautstärke und zweitens wegen Brittney Spears und den Backstreet Boys, die den Reggae mittlerweile eindeutig auf Platz drei, noch hinter Gangsta-Rap, verdrängten.
Zwischen St. Lucia und meinem nächsten Ziel, St. Vincent und den Grenadinen liegen nur 30 Meilen. Trotzdem gab es keinen Direktflug, weshalb ich einen Umweg von 250 Meilen via Barbados einlegen musste. Diese Insel hat nach dem, was ich las, hörte und sah, außer Fish, Chips, Rum und Abhängen nichts wirklich Besonderes zu bieten. Deshalb wechselte ich dort nur das Flugzeug, um in St. Vincent den Höhepunkt meiner Karibikreise zu erleben: Den Cross-Island-Track mit Besteigung des aktiven Vulkans La Souffrière. Der Name kommt Euch bekannt vor? Richtig, hier wurde jeder zweite Vulkan auf diesen Namen getauft. Aber in Deutschland gibt es ja auch ein Dutzend „Neustadt“. Mangelende Kreativität bei Ortsangaben ist sicherlich global verbreitet.
Da ich nicht wusste, ob es überhaupt einen vernünftigen Weg auf den Vulkan gab, war dieser Tagesausflug ein kleines Abenteuer. Auch auf St. Vincent bekam ich wieder eine Mitfahrgelegenheit, diesmal auf der Ladefläche eines Pick-ups. Meine Mitfahrer waren Arbeiter auf einer der vielen kleinen Bananenplantagen, die es auf den Kleinen Antillen gibt. Dass die EU-Agrarpolitik auch Sinnvolles leisten kann, zeigte sich auf dieser Reise: Es werden in erster Linie Bananen aus den CARICOM-Staaten und den tropischen Departements Frankreichs (also den Karibik-Inseln) importiert. Dadurch erhalten die Plantagenbesitzer eine garantierte Abnahme zu fixen Preisen. Und die Plantagenbesitzer waren hier noch die kleinen Bauern, anders als in Mittelamerika, wo Großkonzerne beispielsweise aus den USA, dominierten.
Der Bergweg führte anfangs durch tropischen Regenwald, den ich aber relativ schnell hinter mir ließ. Der Bereich oberhalb dieser Baumgrenze war vom letzten Ausbruch des Vulkans 1979 mit Lava zugedeckt worden, so dass hier nur noch krautartiger Bewuchs zu sehen war. Bisher hatte es nur dieses Kraut geschafft, auf diesen Berghängen zu gedeihen. Mit zunehmender Höhe wurde es für hiesige Verhältnisse sehr kalt. Es waren nur noch 14 Grad, der Wind blies mir um die Ohren, und plötzlich befand ich mich mitten in den Wolken. Diese Szenerie erinnerte mich an das schottische Hochland. Ich kletterte weiter hinauf und schien mich auf einmal vor einem riesigen Tal-Einschnitt zu befinden. Die gegenüberliegende „Talseite“ war der 150 Meter hoch aufgetürmte Lava-Rest, der im Krater verblieben war. Als der Weg an dem Grad bergab statt bergauf führte, begriff ich langsam, dass ich den Krater erreicht hatte. Wenig später riss die Wolkendecke auf, und ich sah die riesigen Dimensionen des Kraters. Er hatte einen Durchmesser von etwa einem Kilometer und war etwa 200 bis 300 Meter tief. In der Mitte befand sich der besagte Lava-Haufen, der natürlich mittlerweile erkaltet war. Dieses Panorama mit der Karibik im Hintergrund würde ich sicher nicht vergessen.
Nach einer kurzen Mittagspause setzte ich meine Wanderung nach Westen fort. Schließlich wollte ich die Insel von der Atlantik-Seite bis zur Karibik-Seite durchqueren. Auf dem Weg hinunter begegnete ich im Regenwald glücklichen Kühen auf Weiden mit bunten Blumen mit Blüten von einem halben Meter Durchmesser, unbekannten Vogelarten und einem einzigen Einheimischen, der sich freute, mal wieder einem Menschen zu begegnen. An der Karibikküste angekommen lag vor mir ein zwei Kilometer langer, menschenleerer Strand. Aufgrund des vulkanischen Ursprungs der Insel war der Sand grau bis schwarz. Dies entsprach so gar nicht dem Klischee des typischen Karibikstrands, doch diese Abgeschiedenheit war traumhaft schön. Muss etwas unbedingt weiß sein, um als schön zu gelten? Ich denke nicht.
Um wieder in die Zivilisation zurückzukehren, hatte ich noch einen Fluss von 20 Metern Breite zu überqueren. Das Wasser reichte mir nur bis zu den Knien. Aber es war wegen der starken Strömung gar nicht so einfach, das andere Ufer zu erreichen. Dort empfingen mich Einheimische, die mir sofort eine Mitfahrgelegenheit ins nächste Dorf mit Busanschluss anboten. So landete ich zum zweiten Mal an diesem Tag auf der Ladefläche eines LKW. Dieser war mit Sand befüllt und ich blieb nicht lange der einzige „Fahrgast“ auf der Ladefläche. Am Ende waren wir ein Dutzend „Passagiere“, die die Fahrt in drei Metern Höhe genossen. Das einzige, worauf wir aufpassen mussten, waren die Telefonleitungen, unter denen wir hindurchfuhren, da sie ziemlich knapp über unseren Köpfen hingen.
Wie der Name schon sagt, besteht das Land St. Vincent und die Grenadinen ja nicht nur aus der Hauptinsel St. Vincent. Meine Reise durch die Grenadinen nach Süden setzte ich mit dem Frachtschiff fort und tuckerte so gemächlich von Inselchen zu Inselchen. Manches Eiland hatte keinen Hafen, so dass die Fracht dann auf kleinere Boote umgeladen und an Land transportiert wurde. Etwas bizarr war diese „Kreuzfahrt“ schon. Denn während es auf dem einen Inselchen überhaupt keine Infrastruktur gab, lagen direkt daneben Privatinseln mit Jachtanleger oder Heliport, die Promis wie Mick Jagger gehörten. Diese Inseln wurden nicht angefahren, da ein Rolling Stone natürlich nicht das Frachtschiff nimmt.
Auf Union Island, der südlichsten Grenadinen-Insel, angekommen, hatte ich gar keine Zeit, über Reich und Arm, die da so direkt aufeinanderprallen, zu philosophieren. Schließlich hatte ich ein großes Problem zu lösen. Ich wusste dank meines etwas oberflächlich verfassten Reiseführers nicht, wie ich von dort weiterkommen sollte. Die in dem Buch angegebenen Flugverbindungen gab es nicht mehr. Es bestand zwar zweimal die Woche eine Bootsverbindung auf die grenadische Insel Carriacou. Dummerweise war das Boot am Tag meiner Ankunft, einem Donnerstag, aber gerade abgefahren. Also musste ich mal wieder Glück haben: Die „No-Problem“-Leute halfen mir wie so oft auf dieser Reise aus der Patsche. Irgendjemand wusste, dass freitags irgendeine andere Person meistens mit dem Boot nach Carriacou fuhr, um Gasflaschen aufzufüllen. Es war die einhellige Meinung der Leute, dass ich sicherlich mitfahren könnte. Schnell wurde jemand losgeschickt, um den Kapitän ausfindig zu machen, und nach noch nicht einmal zehn Minuten kam die Person zurück und meinte, ich sollte mich am nächsten Morgen bei Sonnenaufgang im Nachbardorf am Hafen einfinden.
Das frühe Aufstehen war ich mittlerweile gewohnt. Die Menschen standen hier so gegen halb sechs Uhr morgens mit der Sonne auf, während nach Sonnenuntergang in diesem Teil der Welt nicht mehr viel passierte. Am nächsten Morgen erschien ich also bei Sonnenaufgang an der Mole, wo zwei kleine hölzerne Segelboote, etwa so lang wie ein VW-Bus, ankerten. Tatsächlich tauchte plötzlich ein alter Mann mit grauen Rastahaaren auf, stieg auf das Boot und setzte die Segel. Zusammen luden wir Cola-Kästen und Gasflaschen ein. Nachdem er mit dem zweiten Matrosen noch schnell einen Joint geraucht hatte, wurde der Kapitän in den nahen Mangroven aufgegabelt. Er watete durchs Wasser, kletterte ins Boot und meine Reise in Richtung Grenada, mein nächstes Land, begann. Union Island erinnerte mich ein wenig an das Deutschland vor 1990: Überall wimmelte es von US-Soldaten. Ihre Aufgabe bestand darin, den Drogenschmuggel von Süd- nach Nordamerika zu unterbinden. Diese militärische Präsenz hielt die Besatzung meines Bootes allerdings nicht davon ab, einen weiteren Joint zu drehen.
Die Überfahrt nach Carriacou verlief unspektakulär. Nur die reichen Yachtbesitzer, die durch die Karibik schipperten, staunten ein bisschen, dass da ein Weißer auf dem Holzschiffchen mitsegelte. Unorganisiert war meine Besatzung übrigens überhaupt nicht. Es befanden sich doch tatsächlich Einreisekarten an Bord. Gut, diese galten zwar für St. Vincent und die Grenadinen und ich war gerade auf dem Weg nach Grenada, aber in diesem Teil der Welt gilt einfach immer „No Problem!“. Mit dem Kugelschreiber wurde „St. Vincent & the Grenadines“ durchgestrichen und „Grenada“ nebendran geschrieben. Einmal das Ding ausgefüllt und beim Hafenmeister abgegeben, und schon hatte ich meinen Einreisestempel für Grenada ergattert. „No Problem“!
Grenada war noch „very British“. Die Menschen waren hier noch höflicher als auf anderen Inseln, man trank häufig „Tea“, und „Pie“ stand auf vielen Speisekarten. Hier konnte ich das letzte Mal auf dieser Reise eine Wanderung durch den Urwald in den Bergen unternehmen. Es gab tatsächlich Wanderwege mit Markierungen und Schildern, und die Zugänge waren noch nicht mal abgeschlossen. Ein anderes Wort für Urwald lautet Regenwald, der seinem Namen auf dieser Wanderung alle Ehre machte. Schon nach wenigen Schritten war der eigentliche Weg verschwunden. Ich kam mir eher wie auf einem Acker vor, auf den es drei Wochen am Stück niedergeregnet hatte. Die Taktik, die Schlammlöcher zu umgehen, hatten vor mir bereits Wanderer versucht. Den Spuren nach zu urteilen waren sie damit kläglich gescheitert: Alle Abdrücke führten über kurz oder lang in die Löcher hinein. Ich konnte mir vorstellen, wie die Schuhe der Wanderer danach ausgesehen hatten. Später fing es noch zu regnen an. Bald darauf sah ich aus, als ob ich einen Kampf im Schlammcatchen verloren hätte, denn auch ich landete in den Schlammlöchern. Trotzdem war die Tour ein großer Spaß, da in diesen Breiten bei Regen nicht gleich die Temperatur in den Keller fällt. Somit erhielt ich nur eine gratis Schlammpackung, aber keine Erkältung. Dieses Wetter verstärkte meinen Eindruck, dass Grenada „very British“ war.
Die Menschen hier waren, was ihre Meinung über Weiße anbetrifft, anscheinend gespalten. Viele waren zu mir wieder sehr nett, während manche grundlos auf mich einschimpften. Dies lag sicherlich an der Besetzung Grenadas durch die USA 1983, die hier zum Beispiel wieder einmal statt des Militärcamps ein Hospital bombardiert hatten, dessen Reste man heute noch „besichtigen“ konnte. Zum Glück dauerte die Besatzungszeit nur ein paar Wochen, seitdem war hier wieder alles friedlich.
Mein letzter innerkaribischer Flug führte mich von Grenada nach Trinidad, das selbstverständlich auch wieder eine Zwillingsinsel namens Tobago erhalten hatte, als es die Unabhängigkeit erlangte. Während Tobago sogar von Deutschland aus mit dem Charterflugzeug erreichbar war, traf ich in Trinidad gar keine Touristen, nicht einmal am Flughafen. Die Insel galt schon als ein industrialisiertes Schwellenland mit reichen Ölvorkommen. Nach mehreren Wochen sah ich das erste Mal Häuser, die höher als Palmen waren, roch Smog und traf auf hektisch agierende Menschen. Trotzdem war die Hauptstadt Port-of-Spain eine Reise wert, da sie wie Rio und Mainz eine Fastnachtshochburg war. Überall probten die Steelbands in den Straßen für ihren Auftritt während der fünften Jahreszeit Ende Februar. Bei den Steelbands handelte es sich um Gruppen mit riesigen Ölfässern, die einen superrhythmischen Sound produzierten, so dass mir gar nichts anderes übrig blieb als abzutanzen.
Port-of-Spain war die erste Stadt auf dieser Reise, bei der man von einem Nachtleben sprechen konnte. Auf den anderen Inseln war nach dem ersten oder zweiten Drink an der Strandbar gegen acht Uhr abends nichts mehr los. In Port-of-Spain fing alles erst nach neun Uhr abends an. Trinidad bot neben Fastnacht aber auch einen Artenreichtum, den es auf den zuvor bereisten Inseln nicht gab. Die Insel liegt nur elf Kilometer vor der Küste Südamerikas, was der Grund für diese Vielfalt ist. Die Mangrovensümpfe südlich von Port-of-Spain gefielen mir besonders gut. Mit einem Boot fuhr ich gemeinsam mit einigen anderen Besuchern die Kanäle entlang. Wir genossen die Ruhe, die hier fernab des Chaos und des Lärms der Hauptstadt, herrschte. Die Bäume über uns schlossen sich zu einem natürlichen Tunnel zusammen und boten, wie wir plötzlich bemerkten, nicht nur einen Lebensraum für Vögel, sondern auch für mehrere Mangroven-Boas, die zusammengeringelt auf den Bäumen ruhten. Die Schlangen warteten ab, bis die Dämmerung herein brach, um auf Nahrungssuche zu kriechen. Deshalb suchten die Vögel nach Möglichkeit Inselchen auf, wo sie vor den Boas sicher waren. Allerdings drohte den Vögeln auch von unten Gefahr, da sich Alligatoren im Gebüsch befanden.
Ein wunderschönes Schauspiel konnten wir vor einer ganz bestimmten Insel beobachten. Kurz vor Sonnenuntergang landeten hunderte von roten Ibissen auf der Insel, um einen Schlafplatz für die Nacht auszuwählen. Je weiter die Sonne sank, desto roter färbte sich die vormals grüne Insel. Es war beeindruckend zu sehen, wie dieses Massenlager ohne jegliche Geräusche belegt wurde. Der rote Ibis erhält seine typische Färbung erst nach drei Jahren, aufgrund seines Speiseplans, der aus Krebsen und Schrimps besteht. Das in den Meeresfrüchten enthaltene Karotin färbt das Gefieder der Vögel mit der Zeit knallrot. Die Ibis-Küken schlüpfen mit einem grauweißen Federkleid. Auf der Insel konnten wir beobachten, dass in den Wipfeln Grauweiß dominierte, während unten alles rotgefärbt war: Die Jungen wurden in die geschützten Flächen des „Obergeschosses“ gesetzt während die Alten im ungeschützten „Untergeschoss“ blieben.
Auch auf Trinidad wusste ich nicht genau, wie ich weiterkommen sollte, weil das regelmäßig nach Venezuela verkehrende Boot aktuell kaputt war. Also sprangen erneut die „No Problem“-Leute ein und fanden tatsächlich ein Boot, das ausgerechnet an meinem Geburtstag nach Venezuela fahren sollte. Dadurch verblieben mir noch ein paar Tage, um Trinidad zu erkunden und ein wenig die Fastnacht zu erleben. Wie bereits angedeutet, war sie in Trinidad genauso wie in Mainz eine ziemlich ernste Angelegenheit. Überall übten die „Trinis“ in so genannten „Mas Camps“ (von Maskerade) für ihren Auftritt mit den Steel Drums, den umgedrehten Ölfässern. Kostüme wurden ebenfalls in allen Ecken von Port-of-Spain zusammengenäht, trainiert wurde in den Parks und Gärten der Stadt. Überall überholten mich Jogger oder Walker. Ob jung, ob alt, alles war auf den Beinen, um später die fünfte Jahreszeit durchhalten zu können. Der Höhepunkt beginnt am Rosenmontagmorgen, bis Dienstagabend kommt wohl kein „Trini“ wirklich zur Ruhe. Auch hier war am Aschermittwoch alles vorbei. Allerdings lief das mit dem Fasten hier angeblich anders ab. Laut Gebot des „Carnivals“ existiert bis Fastnachtsdienstag ein Verzicht auf Fleisch, das am Aschermittwoch wieder aufgehoben wird. Diese Fastenzeit ist mit 30 Tagen vergleichsweise kurz, denn schließlich dauert sie in Europa mehr als sechs Wochen. Ob diese Story tatsächlich wahr ist, konnte ich nicht herausfinden, da der „Trini“, der mir sie erzählte, bereits einige Carib-Bier intus hatte. Vielleicht ein früher Fall von „Fake News“?
Was in Trinidad jedenfalls wirklich existierte, war etwas, auf dem wir täglich „abfahren“ und was mit relativ großer Wahrscheinlichkeit sogar aus Trinidad kommt: Trinidad besitzt weltweit den einzigen Teer-See. Dieser Teer wird kommerziell genutzt, und Deutschland ist der Hauptimporteur. Ausgerechnet kurz bevor ich den Teer-See erreichte, war die Straße in einem desolaten Zustand. Der Belag war vollkommen verschwunden, doch statt die eigenen Straßen auszubessern, wurde der gesamte Teer exportiert. Das erinnerte mich an eine Wanderung durch eine Kaffeeplantage in Kenia einige Jahre zuvor. An einem Kiosk machte ich Halt und bestellte einen Kaffee. Dieser kam auch, war aber Instantkaffee aus der Schweiz…
Ich konnte den See betreten, der zum Großteil wie Elefantenhaut aussah. Einmal die Oberfläche abgekratzt, fand ich darunter tatsächlich flüssigen Teer. Es roch wie im Hochsommer, wenn sich der Teer zum Beispiel auf einem Parkplatz verflüssigt. Wegen der Bildung von Gasen blubberte es überall um mich herum. Auf der Oberfläche gab es Verwerfungen, die mich an Gletscherspalten erinnerten. Darin befanden sich Wasser und sehr viel Schwefel. In dieser Brühe lebten Fische, die in „reinem“ Wasser sofort gestorben wären. Als Andenken bekam ich von meinem Teer-See-Führer ein Stück der Oberfläche des Sees geschenkt.
Am nächsten Tag ging mein Traum in Erfüllung und ich erreichte erstmals in meinem Leben Südamerika. Die Menschen in der Karibik halte ich in guter Erinnerung. Sie wissen wirklich, wie man das Leben in einem angenehmen Rhythmus verbringt. Das Schiff nach Südamerika war eigentlich eher eine schwimmende Open Air Disco, dessen Deck mit riesigen Boxen vollgestellt war. Die Musik von Brittney Spears, den Backstreet Boys, Christina Aguilera und anderen Künstlern wusste ich wie immer nicht allzu sehr zu schätzen. Nachdem ich allerdings in Grenada bereits die Calypso-Version von Celine Dion ausgehalten hatte, war ich nun ziemlich abgehärtet. Dies musste ich allerdings auch sein, wollte ich nicht den totalen Koller in Venezuela bekommen. Dort wurden die kleinsten Busse bis in die letzte Ecke mit Bassröhren, Endstufen, Equalizern und Lichterketten vollgestopft. Gepäck hatte damit keinen Platz mehr, aber das interessierte niemanden so richtig. Es wurde vielmehr auf „Play“ gedrückt, und die Herzschmerzmusik in der Lautstärke eines startenden Jumbos setzte alles daran, mein Trommelfell zu ruinieren. Ich bereute es tatsächlich, meine Gehörschützer zu Hause gelassen zu haben. Nach vier Stunden Überfahrt hieß es dann Hola Venezuela!
Mit dem Bus fuhr ich in Richtung der venezolanischen Hauptstadt Caracas. Brauchte ich bisher ein T Shirt und Shorts, wären in Venezuela Winterklamotten gar nicht verkehrt gewesen. Ich hatte den Eindruck, die Venezolaner wollten mich schon auf die Temperaturen in der Heimat einstimmen. Schließlich funktionierte immer etwas einwandfrei: Die Klimaanlage der Firma „Thermo King“ in den Überlandbussen. Schockgefrostet kam ich irgendwann in Caracas an. In Venezuela würde man wahrscheinlich den Smart für ein Matchbox-Auto halten, denn die Autos auf den Straßen der Hauptstadt waren amerikanischen „Schiffe“, hinter deren Windschutzscheibe ich meist einen winzigen „Kapitän der Straße“ erkennen konnte. Bei Spritpreisen von zehn Euro-Cent pro Liter besaßen viele Menschen solche „Schiffe“. Dadurch kam der Verkehr natürlich zum Erliegen, und ich hatte größte Probleme, meinen Flieger ins ähnlich kalte Europa zu erreichen.