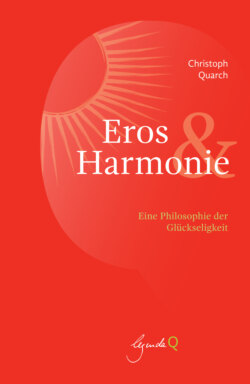Читать книгу Eros&Harmonie - Christoph Quarch - Страница 6
Оглавление1. Beate, Felicitas, Fortuna Drei Damen, die das Glück bedeuten
Was ist Glück? – fragen wir noch einmal diese Frage aller Fragen. Aber fragen wir sie richtig! Fragen wir aus der Mitte unseres Herzens, in dessen Tiefe die Antwort verborgen ist, die wir ihm doch erst über den Umweg des Denkens abringen müssen. Machen wir uns frei von allen fertigen und vorgefertigten Antworten, die uns auf der Zunge liegen und in denen wir so gerne von unseren Ratgebern und Lehrern bestätigt werden wollen. Fragen wir ins Offene, auch wenn das bedeutet, dass wir uns dabei selbst in Frage stellen lassen müssen. Fragen ist nicht nur, wie Heidegger sagte, die „Frömmigkeit des Denkens“ (12), Fragen ist überhaupt der Anfang aller Philosophie. Denn Fragen öffnet – und nur wer offen ist, kann Erfüllung finden. Fragen wir also mit dem depressiven Fuchs aus Selma, fragen wir mit allen aufrichtigen Glückssuchenden: „Was ist Glück?“ – Und lassen wir uns für einen Augenblick ein auf die Antwort jenes wunderlichen Philosophen, der uns von Jutta Bauer als großer Widder vorgestellt wird:
Es war einmal ein Schaf. Das fraß jeden Morgen bei Sonnenaufgang etwas Gras, lehrte bis mittags die Kinder sprechen, machte nachmittags etwas Sport, fraß dann wieder Gras, plauderte abends etwas mit Frau Meier, schlief nachts tief und fest. Gefragt, was es tun würde, wenn es mehr Zeit hätte, sagte es: „Ich würde bei Sonnenaufgang etwas Gras fressen, ich würde mit den Kindern reden – mittags, dann etwas Sport machen, fressen, abends würde ich gern mit Frau Meier plaudern. Nicht zu vergessen: ein guter, fester Schlaf.“ – „Und wenn Sie im Lotto gewinnen würden?“ – „Also, ich würde viel Gras fressen, am liebsten bei Sonnenaufgang, viel mit den Kindern sprechen, dann etwas Sport machen, am Nachmittag Gras fressen, abends würde ich gerne mit Frau Meier plaudern. Dann würde ich in einen tiefen festen Schlaf fallen.“
So die Geschichte von Selma, dem Schaf, geschrieben 1997. Als habe er diese Geschichte antizipiert, verfasste mehr als 100 Jahre zuvor einer, der sich selbst gern als den Philosophen des 21. Jahrhunderts bezeichnete, einen Abschnitt, der sich wie eine Entgegnung auf Jutta Bauers ländliche Idylle liest: Im ersten Abschnitt seiner Unzeitgemäßen Betrachtung „Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben“ schreibt Friedrich Nietzsche:
Betrachte die Heerde, die an dir vorüberweidet: sie weiss nicht was Gestern, was Heute ist, springt umher, frisst, ruht, verdaut, springt wieder, und so vom Morgen bis zur Nacht und von Tage zu Tage, kurz angebunden mit ihrer Lust und Unlust, nämlich an den Pflock des Augenblickes und deshalb weder schwermüthig noch überdrüssig. Dies zu sehen geht dem Menschen hart ein, weil er seines Menschenthums sich vor dem Thiere brüstet und doch nach seinem Glücke eifersüchtig hinblickt – denn das will er allein, gleich dem Thiere weder überdrüssig noch unter Schmerzen leben, und will es doch vergebens, weil er es nicht will wie das Thier. Der Mensch fragt wohl einmal das Thier: warum redest du mir nicht von deinem Glücke und siehst mich nur an? Das Thier will auch antworten und sagen, das kommt daher dass ich immer gleich vergesse, was ich sagen wollte – da vergass es aber auch schon diese Antwort und schwieg: so dass der Mensch sich darob verwunderte. (13)
Nietzsche, der selbst ernannte „Philosoph mit dem Hammer“, zertrümmert in diesem Passus mit einem gezielten Schlag unsere Selma-Idylle: Das Glück des Tieres ist eine Illusion – es ist das Glück der Geschichts- und Zeitlosigkeit oder wenigstens doch das Glück des Vergessens. Der Mensch aber vergisst nicht so leicht. Er ist ein zeitliches und geschichtliches Wesen und wird deswegen nie das einfache Glück einer Selma teilen können. Dagegen mag man einwenden, dass dies im Ganzen sicher zutrifft – dass wir es aber ungeachtet dessen doch darauf anlegen können, uns wenigstens für einen Augenblick einmal an den „Pflock des Augenblicks“ zu legen: ganz im Hier und Jetzt zu sein und eben darin die Zeit- und Geschichtslosigkeit des Tieres zu teilen. Tatsächlich legen nicht wenige spirituelle Lehrer ihren Adepten diese Strategie nahe – und wir werden sehen, dass sie nicht unrecht daran tun. Und doch ist es gut, sich klarzumachen, dass sich damit ein Konzept von Glück verbindet, das sich vorderhand nicht am menschlichen, sondern am tierischen Leben ausweisen lässt – ein sonderbares Glück, das uns abverlangt, all das auszublenden, was landläufig den Menschen vom Tier unterscheidet und ihm gegenüber seine Würde begründet:
Bewusstsein: die Fähigkeit, sich zu sich selbst ins Verhältnis zu setzen
Zeitlichkeit: das Vermögen, zu erinnern und vorauszuschauen
Identität: das Wissen um die Kontinuität des eigenen Daseins
Freiheit: die Ungebundenheit vom Unmittelbaren
Stattdessen: Bewusstlosigkeit, Zeitlosigkeit, Identitätslosigkeit und Gebundenheit an das Jeweilige, Je-Tunliche, Je-Anstehende. Und – merkwürdig genug – dennoch blicken wir, wie Nietzsche formuliert, eifersüchtig nach diesem Glücke hin, verspricht es doch Freiheit von Schmerz und Überdruss. Offenbar ist es genau dies, was am Tier zu sehen den Menschen „hart angeht“, weil er in seiner Glückssehnsucht davon träumt und doch weit davon entfernt bleibt. Denn wo ist der Mensch, der nicht von Langeweile gemartert ein Selma-Leben führen würde: Gras fressen, mit den Kindern reden, Sport treiben, Gras fressen, plaudern – von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr? Hier wird deutlich, dass wir über unser Menschsein nachdenken müssen, wenn wir verstehen wollen, was menschliches Glück ist. So müssen wir uns fragen, was es über unser Bild von uns selbst sagt, wenn wir auf die Idee kommen, das Glück außerhalb unserer eigenen Existenz zu suchen: bei Tieren oder auch – vor allem in früherer Zeit – bei Göttern?
Götter und Tiere haben eines gemeinsam, das sie vom Menschen unterscheidet: Zeitlosigkeit. Für die alten Griechen war es selbstverständlich, dass die Götter die Unsterblichen sind: diejenigen, denen nicht irgendwann die Stunde schlägt, diejenigen, die nicht den Gesetzen von Alter und Verfall preisgegeben sind, sondern sich in ewiger Jugend ihres Daseins freuen. Frei sind sie von Überdruss und Schmerzen, denn fremd ist ihnen das Wissen vom Ende, der Begrenztheit der Zeit. Wohl wissen sie um ihre Unsterblichkeit, sie sind sich ihrer selbst bewusst, und eben deshalb haben sie Geschichte – eben deshalb können wir Geschichten von ihnen erzählen. Das Glück der Götter ist nicht geschichtslos, da es nicht bewusstlos ist. Aber es ist zeitlos, da ihnen die Zeit nichts anhaben kann. Das ist beim Tier anders: Die Zeitlosigkeit des Tieres gründet in seiner – mutmaßlichen – Geschichts- und Bewusstlosigkeit. Eine Selma kann sich nicht zu sich selbst ins Verhältnis setzen und weiß deshalb nicht, dass sie eine Identität hat, die sich vom eben ins gleich fortschreibt. Sie vergisst, wie Nietzsche sagt, jeden Augenblick den vorherigen – kurz angebunden, unfähig aufzublicken und festzustellen, dass sie eine Geschichte hat.
Wenn wir uns das Glück in Gestalt einer Selma ausmalen, dann blenden wir diesen Aspekt aus. Wir tun so, als könne Selma befragt werden und im Lotto gewinnen. Wir stellen uns vor, sie verfüge über Bewusstsein und sei doch aller Schmerzen und allen Überdrusses enthoben. Kurz: Wir dichten ihr ein Glück an, das nicht menschlich ist und das traditionell eher als das Glück der Götter denn als das Glück der Tiere gedacht wurde. Damit sind wir mitten hineingeworfen ins Schlamassel unserer Begrifflichkeit. Zwar haben wir uns angewöhnt, beim zeitlosen Glück der Götter von „Glück“ zu reden, doch wäre es präziser, dafür andere Begriffe zu verwenden, die nur leider (sicher nicht zufällig) aus der Mode gekommen sind: Wonne etwa oder Seligkeit. Wobei für das Glück der Selma das Wort Wonne wohl am besten passt, da ihm eine Spur von jener Bewusstlosigkeit des Tieres beigemischt ist. Mit Wonne verbindet sich ein Überschwang an emotionaler Erfüllung – eine entrückte Gefühlsdichte, die sich eher mit Rauschzuständen als mit der klaren Bewusstheit göttlicher Seligkeit verbindet.
Mit der göttlichen Seligkeit hingegen klingt eine Wahrnehmung der Wirklichkeit an, die nicht mehr die unsere ist: das Paradigma des Mythos. Tatsächlich ist es gerade die Verwurzelung im mythischen Weltgewahren, die dem griechischen Geist und der griechischen Philosophie – wenigstens bei einigen ihrer wichtigsten Exponenten – große Unmittelbarkeit und Frische verleiht. Denn Mythen sind nichts anderes als hoch konzentrierte Verdichtungen einer umfassend wahrgenommenen Lebendigkeit. Sie sind wie Brausetabletten, die man nur in das Wasser des eigenen Lebens zu tunken braucht, um sie fröhlich sprudeln und ihren Geschmack und Reichtum freisetzen zu lassen.
Diese hochgradig verdichtete Lebendigkeit des Mythos prägt auch die griechische Sprache, die eine überaus differenzierte Begrifflichkeit für die Wirklichkeiten und Phänomene des Lebens aufweist. Daher gibt es zu denken, dass sie für das, was wir „Glück“ nennen, (mindestens) drei grundverschiedene Begriffe kennt. Da ist zunächst das den unsterblichen Göttern vorbehaltene Glück der Seligkeit (makariótēs), von dem noch Friedrich Hölderlin weiß, wenn er dichtet: „Ihr wandelt droben im Licht, selige Genien!“ (14) Daneben steht ein Wort, das unter den Bedingungen von Zeit und Geschichte das rein menschliche Glück benennt: eudaimōnía – zumeist übersetzt als Glückseligkeit. So konnte ganz am Ende der klassischen Phase des griechischen Geistes Aristoteles in seiner Nikomachischen Ethik darauf hinweisen, dass die makariótēs der Götter von der eudaimōnía der Menschen genau darin unterschieden sei, dass die Götter durchweg die vollendetste und beste Tätigkeit der Seele ausübten, während dies bei den Menschen nur partiell der Fall sei:
Das Leben der Götter ist seiner Totalität nach selig, das der Menschen nur, sofern ihnen eine Ähnlichkeit mit dieser Tätigkeit zukommt; von den Tieren aber ist keines glückselig, da sie an der Vernunft in keiner Weise teilhaben. (15)
Aristoteles sagt also: Die Seligkeit der makariótēs gründet in ihrer Unbegrenztheit, Absolutheit, Totalität – in all dem, was sich für den Griechen mit dem Prädikat göttlich verband. Die menschliche Glückseligkeit der eudaimōnía erscheint dagegen mangelhaft, bruchstückhaft. Ihr fehlt jener Glanz des Absoluten. Auf ihr liegt allenfalls dessen Abglanz, wenn der Mensch dem Göttlichen ähnlich wird. Anähnlichung, Ähnlich-Werden mit Gott (homoiōsis theō) konnte folglich bei Aristoteles ebenso wie bei seinem Lehrer Platon zu einem Leitmotiv der philosophischen Lebenskunst werden.
Bleiben wir aber noch ein wenig bei dem Glück der Götter – bleiben wir bei der makariótēs. Die antiken Texte sind voll von schönen und lichten Darstellungen jener göttlichen Seligkeit, und stets spüren wir darin all das Glänzende, Glitzernde, Glamouröse – die Glorie und die Grazie, das Goldene und das Ganze –, das Hermann Hesse aus dem GL des Glückes heraushören konnte. Und so erscheint es gewiss nicht unzulässig, wenn in unserem Sprachgebrauch die Seligkeit nachgerade in das Glück eingegangen und von diesem Begriff geschluckt worden ist.
Allein – wir sollten uns vor dem Missverständnis hüten zu glauben, damit wäre alles über das Glück gesagt. Wir sollten uns in Acht nehmen vor der Selma-Idylle, die so tut, als sei das aller Zeit und Geschichte entrückte Glück in seiner ganzen Ungetrübtheit auch die Glückseligkeit des Menschen. Wir sollten nicht der Versuchung anheimfallen, das Glück auf das goldene GL einzuschränken und das erdhaft-irdische ÜCK dabei zu ignorieren – dieses ÜCK, aus dem all das Lückenhafte, Bruchstückhafte und Bedrückte des menschlichen Lebens klingt. Davor dürfen wir die Augen nicht verschließen, wenn wir unser menschliches GlÜCK bedenken, das eben tiefer reicht als das Glück der GLänzenden göttlichen Seligkeit. Umgekehrt wäre es aber auch zu kurz gegriffen, wenn wir unser menschliches Glück nur als Antwort auf unser Schicksal als Sterbliche begreifen wollten. Am Ende scheinen uns die fünf Buchstaben des Wortes GLÜCK wohl bedeuten zu wollen, dass sich unser Glück aus beidem zusammensetzt – dass es sich irgendwo in der Mitte befinden muss zwischen dem GLanz vollendeter göttlicher Seligkeit und dem Schmerz irdischer BruchstÜCKhaftigkeit – in der Schwebe zwischen Erde und Himmel.
Und noch etwas: Ebenso wie die Vision von der GLanzvollen Seligkeit der Götter und das Bewusstsein um die LÜCKenhaftigkeit des menschlichen Daseins ist das Wissen um die SchiCKsalhaftigkeit des Lebens in unser Verständnis von Glück eingeflossen: Das Wissen um seine Zufälligkeit, seine Unverfügbarkeit – das Wissen um das Glück, das man haben muss, wenn man glücklich sein will. Denken wir nur an all die Glücksspiele, die Glücksbringer, die Glücksfeen und Glückskinder vom Schlage eines Gustav Gans; denken wir an das Glück, das wir hatten, wenn wir knapp einer Gefahr entronnen oder – zufällig – in den Genuss eines Gewinns gekommen sind. Auch das ist Glück, und vermutlich wird in der deutschen Sprache das Wort Glück am häufigsten in diesem Sinne verwendet.
Diesem Glück haben die alten Sprachen einen eigenen Namen gegeben – mehr noch: Es verdichtete sich für sie zu einer göttlichen Gestalt, die von den Griechen Týchē, von den Römern Fortuna genannt wurde. Der Týchē entspricht dabei das Verb tynchánein, dessen Bedeutungsfeld sich um Worte wie treffen und erlangen gruppiert. Týchē ist so gesehen dasjenige, was uns trifft, was sich trifft, was betroffen macht. Týchē ist, um ein mythologisches Wörterbuch zu zitieren, die „schicksalhafte Zuwendung“, wobei zunächst offen ist, ob sie uns im Guten oder im Bösen ereilt. Ursprünglich eigneten sowohl der Fortuna als auch der Týchē zugleich lichte wie dunkle Seiten, und erst im Laufe der Zeit wurde Týchē und stärker noch Fortuna zu jener Glücks- und Segensbringerin, die uns aus den endlosen Gründen ihres Füllhorns Glücksgüter vom SUV bis zum Traumurlaub auf den Malediven beschert.
Wenn man dies hört, ist es nur natürlich und naheliegend, dass Týchē und Fortuna für die mythisch gestimmten Menschen der Antike eine leibhaftige Gestalt annehmen mussten, die durch zweierlei gekennzeichnet ist: Jungfräulichkeit und Flügel. Das mythische Bewusstsein kennt Flügel in erster Linie bei solchen Wesen, die sich im Zwischenreich zwischen Menschen und Göttern bewegen: Daimonen nannten sie die Griechen (16), wobei man nicht an die putzigen Fratzengesichter romanischer Kapitelle denken sollte, sondern an Gestalten wie Nike, die – sei es als „Goldelse“ auf der Berliner Siegessäule oder als Nike von Samothrake im Louvre – den Siegern im Wettkampf den Ruhmeskranz reichte, oder den Eros, der mit Pfeil und Bogen bestückt unsere Herzen trifft. Natürlich gehören auch die Engel zu jenen geflügelten Wesen des Zwischenraums: ob nun als Engel der Verkündigung, als Cherubim und Seraphim, als Erzengel oder als deren abtrünniger Bruder Luzifer.
Es ist aber nicht nur die vermittelnde Tätigkeit zwischen Gott und Mensch, die in den Flügeln der daimonischen Wesen ihren Ausdruck findet, es ist vor allem ihre als Jungfräulichkeit symbolisierte Unverfügbarkeit. Einen Engel können Sie nicht herbeizwingen. Davon weiß sogar die österreichische Verkehrswacht, wenn sie Motorradfahrern nahelegt: „Gib deinem Schutzengel eine Chance.“ Den Geflügelten kann man sich öffnen, man kann sich für sie bereithalten, aber man kann sie sich nicht verfügbar machen. Das hat die Menschheit aber nicht davon abgehalten, Strategien, Kniffe und Mittel zu ersinnen, um sich Fortuna und Týchē gefügig zu machen. Doch am Ende haben sie nur zu einer Einsicht geführt: Das jungfräuliche Glück lässt sich nicht gewaltsam oder strategisch einnehmen. Es wendet sich uns zu oder eben nicht. Das mag – kein Wunder bei den Flügeln – dem einen oder anderen als flatterhaft oder gar zickig erscheinen, ihrem verführerischen Charme tut dies aber keinen Abbruch.
Göttliche Seligkeit (makariótēs), menschliche Glückseligkeit (eudaimōnía), unverfügbare schicksalshafte Zuwendung (týchē): Auch andere europäische Sprachen kennen für diese drei unterschiedliche Worte – Worte, die wir im heutigen Deutsch jeweils korrekt mit Glück wiedergeben können.
| Deutsch: | Glück als Seligkeit | Glück als Glückseligkeit | Glück als Zufall |
| Griechisch: | Makariótēs | Eudaimōnía | Týchē |
| Lateinisch: | Beatitudo | Felicitas | Fortuna |
| Italienisch: | Beatitudine | Felicita | Fortuna |
| Französisch: | Beatitude | Bonheur | Bonne chance |
| Englisch: | Blessedness | Happiness | Luck |
Was machen wir damit? Am einfachsten wäre es zu sagen, uns müsse der sonderbare Sonderstatus unseres Wortes Glück nicht belasten – etwa weil er einer allgemeinen Verflachung der deutschen Sprache geschuldet sei, in deren Folge die schönen alten Worte Seligkeit und Glückseligkeit verdrängt und durch das einfachere Glück überlagert worden seien. Dies hieße aber die Weisheit der Sprache unterschätzen. In der Sprache geschieht nichts zufällig, und selbst wenn alle Sprachen eine Tendenz zur Verflachung aufweisen, haben wir damit noch keinen Anhaltspunkt dafür, warum diese Vereinfachung ausgerechnet darin bestehen soll, dass Glück auch die Bedeutungen von Seligkeit und Glückseligkeit übernommen hat. Naheliegender ist es anzunehmen, dass es trotz der Differenziertheit der anderen Sprachen einen inneren Zusammenhang zwischen Seligkeit, Glückseligkeit und glücklicher Fügung gibt, der es rechtfertigt, alle drei unter die Oberhoheit des einen Glücks zu stellen. Wir werden nicht nur sehen, dass dieser Zusammenhang besteht, sondern auch, dass er so gewichtig ist, dass man Glückseligkeit nicht verstehen kann, wenn er außer Acht gelassen wird.
Aber eben darum ist es uns doch zu tun: um unser menschliches Glück, um unsere Glückseligkeit. So viel dürfte aus dieser kurzen Reflexion über unseren Sprachgebrauch deutlich geworden sein: Wenn wir das spezifisch menschliche Glück – die Glückseligkeit – verstehen wollen, sind wir gut beraten, die anderen Aspekte, die sich offenbar mit der menschlichen Glückseligkeit verbinden, auch wenn andere Sprachen eigene Begriffe für sie haben – die göttliche Seligkeit und das unverfügbare Schicksal –, im Auge zu behalten. Mehr noch: dass wir sie in unser Verständnis der Glückseligkeit integrieren müssen, wenn wir sie in ihrer Tiefe und ihrem umfassenden Reichtum zu Bewusstsein bringen wollen.
Eben darauf weist uns auch das ursprüngliche griechische Wort für das menschliche Glück: eu-daimōnía. Es bezeichnet den Zustand dessen, der in sich einen guten (eu) Geist (daimōn) zum Führer hat, wie es bei Euripides einmal heißt (17). Wobei dieser Geist eben Gabe ist: göttliche Fügung, göttliches Schicksal, unserer menschlichen Verfügung und Gewalt entzogen – aber vielleicht doch göttlich und daher vielleicht auch willig, sich zu uns zu gesellen, wenn wir ihm eine Chance lassen.
Was ist Glückseligkeit? – Die Frage ist noch unbeantwortet. Doch vielleicht stellen wir sie tiefer, wacher und bewusster, wenn wir uns klargemacht haben, wonach wir dabei eigentlich fragen – und was alles mitklingt in dieser Frage, die wir im Herzen bewegen und die unsere Geister bewegt. Damit dürften wir gut gerüstet sein, uns im nächsten Schritt den Antworten zuzuwenden: den vielfältigen (teilweise auch einfältigen) Antworten, die die Geschichte des Glücks für uns bereithält. Wenn wir uns ihr nunmehr zuwenden, dann nicht in der Erwartung, in ihr die eine, einzig richtige Antwort zu finden, sondern mit dem Vorsatz, aus der Zusammenschau des bislang Gedachten einen frischen und ursprünglichen Zugang zum Glück zu gewinnen – einen Zugang, zu dem wir im Herzen „Ja“ sagen können, weil unser Herz in seiner Tiefe seine Wahrheit kennt.