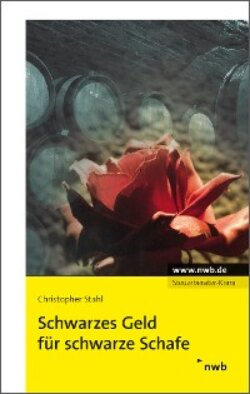Читать книгу Schwarzes Geld für schwarze Schafe - Christopher Stahl - Страница 4
Erstes Kapitel Sonntag, 11. Mai 2003 (Muttertag)
Оглавление„Arm oder reich, der Tod macht alle gleich.” Spielte mir mein Unterbewusstsein einen üblen Streich oder versuchte es, mich vor einem Nervenzusammenbruch zu bewahren? Da kam mir beim Anblick der Leiche meines Berufskollegen Simonis als Erstes nichts Besseres in den Sinn, als dieses Sprichwort aus Kindheitstagen? Meine streitbare Patentante hatte es stets parat gehabt, wenn sie wieder einmal feststellen musste, dass mehr Geld haben, allzu oft – wie sie hervorhob – eine unselige Symbiose einging mit mehr Recht bekommen. Für jemanden, der Peter Simonis kannte, eine durchaus begreifliche Assoziation, jedoch äußerst unpassend, pietätlos. Auch wenn er noch so viel Schuld auf sich geladen haben mochte, sein qualvoller Anblick war nun wirklich nicht dazu angetan, in dieser abscheulichen Tat eine Art ausgleichender Gerechtigkeit zu sehen.
An einer der mit leeren Weinflaschen bestückten Gitterboxen, die im hintersten Winkel der Lagerhalle des Weingutes Espenhof gestapelt waren, saß Simonis, lediglich mit einer Schlafanzughose bekleidet, auf dem von ihm durchnässten und verschmutzten Betonboden. Neben ihm lag eine nachlässig zusammengeknüllte Wolldecke. Seine ausgestreckten Arme waren wie bei einem Gekreuzigten mit aneinander gedrehten Agraffen an einem der Gitter festgebunden. Die Drahtschlinge, mit der er offensichtlich erdrosselt worden war, hatte sich tief in seinen Hals geschnitten und ragte mit den verdrillten Enden waagrecht nach vorn. Seinen Kopf hatte man mit dem hinteren Teil der todbringenden Schlinge ebenfalls an der Gitterbox fixiert. Aus seinem rechten, blutunterlaufenen Auge starrte er uns unverwandt an, das linke war mit Klebeband verschlossen. Der angst- und schmerzverzerrte Ausdruck auf seinem bläulich angelaufenen Gesicht zeugte von der barbarischen Art, auf die man Simonis vom Leben zum Tod befördert hatte.
Ein weiteres Stück Klebeband, das an seinem Mundwinkel baumelte, verlieh der Szenerie einen Anflug von Skurrilität. Mehrere blutige Striemen liefen schräg über seine unbehaarte Brust auf der rechten Körperseite zusammen. Das wohl Makaberste waren zwei kleine Gewichte in der Form von Erdbeeren, wie man sie ansonsten zum Fixieren einer Tischdecke benutzt, die man an seinem entblößten Hodensack befestigt hatte. Irgendwie passte das grausige Bild, das sich uns hier bot, eher in die Zeiten mittelalterlicher Gerichtsbarkeit als in das Jahr 2003 und ich hatte das untrügliche Gefühl, dass ihm ein Plan, eine Absicht zugrunde lag.
Es war Muttertag, kurz nach 8.00 Uhr morgens. Neben mir stand Wilfried Espenschied, der mit Heike, seiner Frau, das Weingut und das dazugehörige Hotel in Flonheim-Uffhofen, etwa 35 Kilometer südlich von Mainz, betrieb. Vor einer halben Stunde hatte er mich angerufen: „Ganz gleich, was du gerade tust, komm sofort zu mir … ins Flaschenlager, es ist etwas … etwas passiert … du musst kommen!”, hatte er gestammelt und schon wieder aufgelegt, bevor ich noch etwas hätte sagen können.
Wilfried, ansonsten ein Typ, den kaum etwas aus der Ruhe bringen konnte und der immer zu einem Scherz aufgelegt war, versuchte, seinen Schock in den Griff zu bekommen. „Das gibt es doch nicht, das träum ich doch bloß”, wiederholte er immer wieder, wobei er auf Simonis Leiche zeigte.
„Wenn ich nicht durch Zufall … weil ich hier hinten eine Birne auswechseln wollte … weil sie flackerte … und Heike hat mich schon seit Tagen darum gebeten … und heute ist doch Muttertag, da wollte ich das endlich machen und …”, brabbelte er völlig unsortiert, bis ich ihn unterbrach.
„Jetzt mal ganz sachte, Wilfried”, dabei legte ich freundschaftlich meinen Arm um seine Schultern, um ihn zu beruhigen, „es ist doch völlig egal, weshalb du heute Morgen hier heruntergekommen bist.”
„Das sagst du. Es war ein blöder Zufall, dass Heike den falschen Lichtschalter angemacht hat und dadurch die defekte Lampe im hinteren Teil des Lagers gesehen hat. Hier kommt sonst vor Herbst, bis wir die Flaschen brauchen, keiner hin. Das hätte Monate dauern können, bis wir den entdeckt hätten.”
„Wohl kaum. Wenn ihn innerhalb der nächsten Tage niemand gefunden hätte, dann hätte er sich durch den Geruch bemerkbar gemacht. So kalt ist es hier ja schließlich nicht.”
„Wie kannst du da nur so ruhig bleiben?”, fragte mich Wilfried fassungslos.
Ich wunderte mich selbst über meine scheinbare Gefühlskälte und konnte ihm seine Frage nicht beantworten. Stattdessen zuckte ich kurz mit den Schultern. „Kennst du ihn?”
„Klar, wer kennt den nicht? Du doch auch – oder?”
„Ja, nur zu gut!” Mehr wollte ich im Moment nicht preisgeben. Daher fragte ich sofort weiter: „Kannst du dir erklären, wie er hierher kommt?”
„Simonis war gestern Abend in Begleitung zum Essen bei uns im Restaurant, aber nicht mit seiner Frau. Er hatte vorher schon ein Doppelzimmer für eine Nacht reserviert. Und die beiden sind dann so gegen halb neun nach oben gegangen. Mehr weiß ich nicht”, erzählte er, kurzfristig gefasster, um dann – sofort wieder ganz aufgelöst – fortzufahren:. „Mensch, wie soll ich das der Heike beibringen?! Sie wartet mit den Kindern und dem Frühstück in der Küche, während der hier so rumliegt.” Inzwischen schwang so etwas wie Zorn auf Simonis in seiner Stimme mit. „Lass uns jetzt erst einmal … ich muss jetzt hier raus”, entschied er und sprach mir damit aus der Seele.
Draußen empfing uns die trügerische Stimmung eines jungen, friedlichen Sonntags. Wilfried atmete tief durch, schüttelte mehrmals den Kopf und strich sich mit beiden Händen über das Gesicht. „Was mache ich denn jetzt?”, fragte er mit kraftloser Stimme.
„Ich spreche mit Heike, ohne die Kinder, und du informierst jetzt die Polizei. Musst denen ja nicht auf die Nase binden, dass du zuerst mich angerufen hast! Und jetzt beruhig dich erst mal Wilfried, du kannst dem armen Schwein nicht mehr helfen. – Weshalb”, fiel mir endlich ein zu fragen, „hast du eigentlich nicht gleich bei der Polizei angerufen, sondern zuerst bei mir? Was habe ich denn mit dieser Sache zu tun?”
„Wenn ich dir das sage, wirst du gleich gute Ratschläge für dein seelisches Gleichgewicht brauchen. Ich habe dich nicht wegen mir gerufen, es geht um dich!”
„Davon kannst du doch gar nichts wissen. Woher hast du …” Von wem oder was wusste er überhaupt von meinen Recherchen über Simonis, in die außer Koman niemand eingeweiht war? Aber wir redeten aneinander vorbei.
„Die Frau, mit der Simonis heute Nacht hier war, die könnte doch mit dem Mord etwas zu tun haben.”
„Klar! Ist sie denn noch da?”, wollte ich wissen – ohne jegliche Vorahnung, welcher Schock mir bevorstand.
„Nein, ich war heute früh schon oben. Die Zimmertür stand offen, niemand drin. Ich habe mir allerdings nichts dabei gedacht”, antwortete Wilfried mit hörbarer Ungeduld. „Jetzt noch einmal: Da ist doch etwas dran, an dem Verdacht – oder?”
Ich zuckte mit den Schultern. „Ja, natürlich, aber überlasse das doch der Kripo!”
„Merkst du denn gar nicht, worauf ich hinaus will?”
„Nein, aber du wirst es mir doch hoffentlich sagen?”
„Wer, meinst du wohl, hat von gestern auf heute hier bei uns die Nacht mit Simonis verbracht?”, fragte er eine Spur schriller.
„Ist das erst die 100.000- oder schon die 250.000-Euro-Frage, Herr Jauch?”, grinste ich noch immer ahnungslos, bevor mir seine Antwort einen Schlag versetzte, der mich, wäre er physischer Natur gewesen, zu Boden geschickt hätte.
„Sie? … Das glaube ich nicht … bist du dir da absolut sicher?”, entgegnete ich mit brüchiger Stimme, während ich versuchte, eine plötzliche Kraftlosigkeit niederzuringen.
„Doch, Darius! Es tut mir so Leid, aber es stimmt”, hörte ich Wilfried noch leise sagen, während ich schon zu meinem Auto stürzte und wie in Trance, ohne auf den Verkehr zu achten, aus dem Hof des Weingutes fuhr.
„Warum in aller Welt tut sie das?”, fragte ich mich immer wieder. Andererseits konnte ich mir einfach nicht vorstellen, dass und wie sie Simonis umgebracht, in die Lagerhalle befördert und seine Leiche dann auch noch auf diese bizarre Art und Weise „arrangiert” haben sollte. So etwas schafft man doch auch nicht ohne weitere Hilfe! Obwohl Simonis’ Gewicht von etwa 60 Kilogramm bei ihrer körperlichen Konstitution für sie keine Herausforderung, die sie nicht meistern könnte, darstellen dürfte.
Und dann fuhr mir durch den Sinn, dass ich Beatrice heute Vormittag eigentlich anrufen wollte. Auch wenn wir schon seit sechs Jahren geschieden waren, hatte ich es bisher noch nie versäumt, den Muttertag zum Anlass zu nehmen, ihr zu unseren beiden großartigen Jungs zu gratulieren. Ob ich das heute auch könnte? Mit ihrer mir unheimlichen und manchmal geradezu fiesen Sensibilität würde sie mir garantiert anhören, dass irgendetwas nicht stimmte – und anlügen wollte und konnte ich sie noch nie. Das war allerdings ein marginales und leicht zu lösendes Problem.
Zu Hause angekommen rief ich Wilfried an und bat ihn noch einmal, der Kripo möglichst nicht zu erzählen, dass ich bereits wusste, was passiert war. Vergeblich zermarterte ich mir danach das Hirn, wie es nun weitergehen sollte. Ich konnte sie ja noch nicht einmal darauf ansprechen. So war ich zur quälenden Untätigkeit verdammt und konnte nichts anderes tun, als abzuwarten, wie sich alles im Rahmen der kriminalpolizeilichen Untersuchungen entwickeln würde
Aber vielleicht sollte ich die ganze Geschichte der Reihe nach erzählen – also von Anfang an.