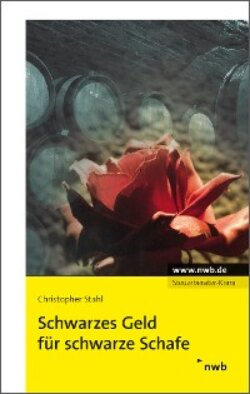Читать книгу Schwarzes Geld für schwarze Schafe - Christopher Stahl - Страница 5
Zweites Kapitel Freitag, 4. April 2003
ОглавлениеIm Grunde genommen begann alles ganz harmlos – mit einem Anruf von Heribert Koman, seines Zeichens Kriminalhauptkommissar bei der Polizeiinspektion Alzey.
„Hallo, Herr Schäfer, Koman hier!” Das Muntere in seiner Stimme hatte für mich durchaus auch etwas Bedrohliches. „Sie entsinnen sich?”
Wie sollte ich mich seiner nicht entsinnen? Mit Koman war das bisher entsetzlichste Ereignis meines Lebens verbunden: der Mord an meinem besten Freund Horst im Juli des letzten Jahres. Meine eigenmächtige Suche nach seinem Mörder hatte mir zwar meine physischen und psychischen Grenzen mehr als deutlich gemacht, mich aber letztlich auch auf den Weg in ein neues, wertvolleres Leben geführt.
„Aber natürlich erinnere ich mich”, antwortete ich daher. „Ich starre schließlich seit einem halben Jahr auf mein Telefon in Erwartung Ihrer avisierten Einladung zu einem Gespräch.”
„Ich weiß, ich weiß. Ich wollte mich ja auch schon im September mit Ihnen treffen. Ich sagte Ihnen ja, dass da so eine merkwürdige Sache mit einem Ihrer Kollegen auf meinem Tisch gelandet ist, bei der ich objektive Hintergrundinformationen brauche; sozusagen in einem inoffiziellen Gedankenaustausch. Übrigens störe ich Sie gerade?”
„Stören ist relativ. Es kommt darauf an, was Sie von mir wollen. Momentan unterbrechen Sie mich natürlich mitten bei der Arbeit.”
„Es geht um diese bewusste Angelegenheit. Ich schiebe sie seit Monaten vor mir her, aber inzwischen macht mir mein Chef die Hölle heiß. Gestern kam wieder so ein anonymer Wisch. Jetzt hat sich jedoch noch etwas anderes Gravierendes ergeben, weshalb ich die Sache endlich angehen muss.”
„Also, um wen oder was geht es denn?”, wollte ich nun doch wissen.
„Da läuft so ein Ding mit einem Alzeyer Kollegen von Ihnen. Da kann ich mir einfach keinen Reim darauf machen. Kennen Sie eigentlich einen Peter Simonis?”
Ich ging auf seine Frage nicht ein. „Und da wollen Sie, dass ich bei Ihnen vorbeikomme?” „Ja.”
Ich schwieg, sodass er geradezu genötigt war, ein „bitte!” nachzuschieben.
„Na also, geht doch”, murmelte ich.
„Wie bitte?”
„Kurzes, kreatives Selbstgespräch.” Nicht übertreiben, dachte ich, bevor ich fortfuhr. „Dann gehe ich wohl auch recht in der Annahme, dass es Ihnen keineswegs unangenehm wäre, wenn ich noch heute zu Ihnen käme?”
„Schön, dass Sie immer noch der Alte sind – ja, bitte! Wenn Sie es auch noch kurzfristig arrangieren könnten, wäre das Maß der Güte überreichlich gefüllt!”
Auch er konnte die Sticheleien, die wir seit dem ersten Moment unserer Bekanntschaft auszutauschen pflegten, nicht lassen. Wobei der Begriff pflegen den Spaß, den wir an unserem Umgangston hatten, trefflich beschreibt.
„So, so, das Maß meiner Güte”, wiederholte ich geziert. „Mit Güte lockt fast überall die Frau ihr Schweinchen in den Stall – Wilhelm Busch. Aber mal im Ernst: Wie wäre es in einer Stunde, so gegen 11 Uhr 30?”
„Gerne”, lachte er „Sie kennen ja den Weg.”
Ich gab Irene Dengler Bescheid, dass ich für den Rest des Vormittags außer Haus und nicht vor 15.00 Uhr wieder zu erreichen sei. Sie arbeitete seit vier Jahren als Sekretärin in der Kanzlei und ist inzwischen auch die Lebensgefährtin meines Partners Carlo. Bevor wir unsere Zusammenarbeit begründeten, war er Betriebsprüfer beim Finanzamt Alzey gewesen.
Beim Verlassen des alten Gehöftes, in dem ich nicht nur wohne, sondern auch unsere Kanzlei untergebracht ist, streichelte ich einem altvertrauten Ritual folgend meinen beiden Bernersennhündinnen Hanna und Kira, die mich erwartungsvoll bis zum Tor begleiteten, flüchtig über den Kopf und stieg in mein Auto.
Alzey liegt etwa eine viertel Stunde von Bernheim, meinem Heimatort, entfernt. Die kurvenreiche, schmale Kreisstraße dorthin verlangt zwar selbst dem ortskundigen Fahrer die volle Aufmerksamkeit ab, aber sie führt auch durch einen der schönsten Teile Rheinhessens, die so genannte rheinhessische Schweiz.
Ich weiß noch, dass ich das Autoradio anhatte. Die Nachrichten auf SWR1 wurden einmal mehr in diesen Tagen dominiert vom Irak-Krieg und den fragwürdigen Erfolgsmeldungen der so genannten Allianz der Willigen. Ich mochte von diesem ganzen Wahnsinn nichts mehr hören und schaltete mutlos ab.
Ich erinnere mich auch, dass die Fahrt durch diese inspirierende Landschaft meine Gedanken wie so oft auf eine Reise schickte durch alle Gefilde meines Gemütes.
Rebenbewachsene Hügel, schattige Wälder, Blumenwiesen mit sprudelnden, klaren Bächen, Äcker, je nach Jahreszeit bewachsen mit Raps, Sonnenblumen, Braugerste und Zuckerrüben, aber auch Heide-, Gewürz- und Heilkräuterbewuchs und das milde, sonnige Klima prägen den Charakter dieser Landschaft, die nicht zu Unrecht oft mit der Toskana verglichen wird.
Romantische Ortschaften, mit liebevoll renovierten Winzerhöfen, urigen Straußwirtschaften und Gutsausschänken, kleine Schlösser, Burgruinen und idyllische Kirchen fügen sich anheimelnd in das Bild ein. Und natürlich spielen der exzellente Wein in seiner Artenvielfalt sowie die bodenständige Küche eine nicht unerhebliche Rolle bei der Prägung dieses Ambientes.
Den entscheidenden Ausschlag gibt für mich aber der besondere Menschenschlag in meiner Wahlheimat. Ein Menschenschlag, der sich über Jahrhunderte immer wieder mit neuen Situationen, vor allem aber den unterschiedlichsten Kulturen und Glaubensrichtungen arrangieren und sie adaptieren musste. „Meine geliebten” Rheinhessen! Ihre eigene Mundart mit einer Fülle sprachlicher Feinheiten und Absonderlichkeiten, jedoch ohne Einheitsklang, ist Ausdruck ihrer Identität und ihres südländisch anmutenden Lebensgefühls. Man muss sie einfach mögen. Aber wie könnte man sie einem Fremden beschreiben?
Carl Zuckmayer, ging es mir durch den Kopf. Der rheinhessische Literat hatte seine Landsleute nur zu gut gekannt und in seinen Romanen und Schauspielen stets treffend beschrieben. Am trefflichsten in einem engagierten Monolog des Harras in „Des Teufels General”. … Mein Gott, wie lange war das her? 40 Jahre? Länger? Bei einer Aufführung der Schauspielgruppe im Gymnasium hatte man mir die Rolle des General Harras gegeben. Natürlich konnte ich mich nicht annähernd mit Curd Jürgens messen, der eine Paraderolle daraus gemacht hatte, aber ich bekam Szenenapplaus, daran konnte ich mich noch erinnern … und ich bekam sogar den Monolog noch zusammen. Ohne zu Stocken und fehlerfrei deklamierte ich ihn laut auf der Fahrt zu Koman, wohl zur Verwunderung der Dame, die ihren Wagen vor mir steuerte und im Rückspiegel meine dramaturgischen Eskapaden mit einem Kopfschütteln quittierte.
„Schrecklich. Diese alten verpanschten rheinischen Familien! Stell’n Se sich doch bloß mal ihre womögliche Ahnenreihe vor: da war ein römischer Feldherr, schwarzer Kerl, der hat einem blonden Mädchen Latein beigebracht. Dann kam ’n jüdischer Gewürzhändler in die Familie. Das war ’n ernster Mensch. Der ’s schon vor der Heirat Christ geworden und hat die katholische Haustradition begründet. Dann kam ’n griechischer Arzt dazu, ’n keltischer Legionär, ’n Graubündner Landsknecht, ein schwedischer Reiter … und ein französischer Schauspieler. Ein … böhmischer Musikant. Und das alles hat am Rhein gelebt, gerauft, gesoffen, gesungen und … Kinder jezeugt. Hm? Und der Goethe, der kam aus demselben Topf, und der Beethoven, und der Gutenberg, und der … Matthias Grünewald. Und so weiter und so weiter. … Das war’n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei’n Sie stolz drauf, Leutnant Hartmann, und hängen Sie die Papiere Ihrer Großmutter auf den Abtritt!”
Apropos Curd Jürgens, spielte der nicht auch den Bösewicht Schinderhannes? Und trieb der Schinderhannes, alias Johannes Bückler, nicht auch in Rheinhessen sein Unwesen? Und „Bösewicht” Simonis, war der nicht auch Rheinhesse? So wurden meine Gedanken wie von selbst wieder auf den Mann gelenkt, der der Grund für diese Fahrt war und dessen Schicksal mich während der nächsten Monate mehr beschäftigen sollte, als es mir lieb war: Kollege Peter Simonis!
Natürlich kannte ich ihn, obwohl ich sehr gut auf seine Bekanntschaft hätte verzichten können. Es fiel mir schwer, aus meiner Missbilligung für seine Lebens- und Verhaltensweise keinen Hehl zu machen. Es war ihm aber auch trefflich gelungen, die Grenzen meiner Toleranz gnadenlos aufzudecken.
Wann hatte ich eigentlich das erste und auch letzte Mal mit ihm persönlich zu tun? Ich glaube, es war nicht lange nach dem Umzug meiner Steuerberatungskanzlei von Wiesbaden nach Bernheim im Jahr 1989. An den genauen Zeitpunkt konnte ich mich zwar nicht mehr erinnern, aber es musste an einem besonders heißen Sommertag gewesen sein. Und ich erinnerte mich natürlich vor allen Dingen daran, dass es ihm alsbald mühelos gelang, dem Ruf, der ihm dank des Kollegentratsches vorauseilte, gerecht zu werden: ein unkollegiales, hinterhältiges und arrogantes Arschloch zu sein. Dass, neben anderen absonderlichen Spezialitäten, grobe Verstöße gegen das Kollegialitätsprinzip unseres Berufsstandes zu seinen Steckenpferden gehörten, wurde mir so ziemlich als erstes von den Kollegen beim Steuerberaterstammtisch in Alzey erzählt.
Simonis war natürlich nicht dabei. Er schien überhaupt jedem direkten Kontakt mit seinen Berufskollegen auszuweichen. Keiner, so hieß es, hatte ihn jemals bei einer Verbands- oder Kammertagung gesehen und Fortbildungsveranstaltungen besuchte er zumindest nicht im Raum Alzey, Mainz, Bingen. Dafür galt seine ganze Zuwendung der regionalen High Society aus Politik und Wirtschaft. Unbeleckt von der offenen und liebenswerten Mentalität des typischen rheinhessischen Alzeyers hatte sich – auch darüber wurde ich alsbald informiert – unter seiner Leitung eine Subkultur Gleichgesinnter entwickelt. Zwar kleinbürgerlich müffelnd, aber auch hier herrschte ein exorbitantes Standesdenken und man bezog seinen nicht unerheblichen Einfluss aus dem Auf- und Ausbau sorgsam gepflegter und geschützter Netzwerke. Die weiblichen und männlichen Kumpanen dieser Bussi-Bussi-Gesellschaft, die sich bei Winzer-, Sänger- und Straßenfesten und bei den Prunksitzungen des Alzeyer Karneval-Vereins überschwänglich begrüßten und abschleckten – was, so wurde gemunkelt, oft hinter verschlossenen Türen als „Bäumchen-wechsel-dich-Spiele” seine feizügige Fortsetzung fand – brauchten in ihrem Dünkel und ihrer Dekadenz einen Vergleich mit großstädtischen Vorbildern nicht zu scheuen. Sie hatten ihre eigene Ethik und Moral, getreu der Philosophie: Recht und rechtens ist, was uns gefällt und nützt. Der Klebstoff, der diese Mischpoche zusammenhielt, waren die Leichen, die sie gemeinsam in diversen Kellern versteckt hielten.
Und mit dieser Clique machte Peter Simonis seine Geschäfte und Geschäftchen. Dabei wurde geklüngelt und zugeschustert, was das Zeug hielt, und vor allem konnte er sich wiederum die Kontakte seiner Kamarilla, die sich nicht nur auf Deutschland, sondern auch auf das benachbarte Ausland erstreckten, zu Nutze machen.
Das alles wusste ich wohlbemerkt nicht aus eigener Erfahrung, sondern war mir von verschiedenen Seiten zugetragen worden. Ich konnte mich anfänglich des Eindrucks nicht erwehren, Peter Simonis werde zu einem höchst willkommenen Feindbild stilisiert. Man brauchte ihn, um sich selbst wiederum pharisäerhaft im Kreise gleich gesinnter „Freunde” des eigenen Wertes und der eigenen Integrität bewusst zu sein. Er wurde zu einem Objekt negativer Identifikation. Eine besonders raffinierte Form paradoxer Psychologie: Ist schließlich nicht der ein Freund, der die gleichen Feinde hat, wie man selbst?
Andererseits, so warnte man mich, könne Simonis, wann immer es ihm diene, einen kumpelhaften Charme entwickeln, der selbst auf hartgesottene Gemüter eine frappante Wirkung ausübe und sie augenblicklich so einnehme, dass sich das distanzierende und schützende „Sie” nur allzu bald zum verbrüdernden, jegliche Schufterei verzeihenden „Du” verselbständige. Wenn er einem auch noch auf die Schulter klopfe, dürfe das allerdings niemals als Ausdruck von Vertraulichkeit interpretiert werden. Er teste, so charakterisierte man ihn mir, sinnbildlich dabei nur die Härte des Rückgrates und suche die Stelle der Verwundbarkeit – wie es dereinst Hagen bei Siegfried tat. Habe er einem dann unvermittelt und überraschend das Messer in den Rücken gestoßen, so geschehe auch das mit einem Ausdruck kindlicher Unschuld und gipfelte in dem Ausruf: „Haltet den Dieb, der hat mein Messer im Rücken”. Das Verblüffende dabei sei, dass diese miese Masche in der Regel funktioniere.
Nun bin ich wahrhaftig nicht der Typ, der sich ohne weiteres von den Urteilen anderer beeinflussen lässt. Andererseits weiß ich natürlich auch, dass derartige psychologisch-rhetorische Tricks selten ihre Wirkung verfehlen. Wer es heutzutage in der Politik zu etwas bringen will, weiß, dass diese Techniken so notwendig sind, wie das tägliche Brot. Man denke da nur an die Unschuldsmiene und den unschuldigen Tonfall unseres ehemaligen Arbeitsministers Norbert Blüm, wenn er in seinem südhessischem Idiom behauptete: „Die Rende is sischer!” Vier Wörter – ein Programm für 16 Jahre!
Nein, so blauäugig bin ich nicht, aber was ging mich der Kollege Simonis an? Er hatte mir bisher nichts getan, es hatte bislang auch noch keine Berührungspunkte gegeben, und so deutete ich die Bemerkungen über ihn zunächst als neidgeborenen Klatsch. Und der war für mich höchstens zur Perfektionierung meiner Menschenkenntnis über die Urheber des Tratsches von Interesse und nicht, um undifferenziert danach zu urteilen.
… Bis zu dem Tag, an dem zwei Dinge zusammenkamen, die ein persönliches Gespräch mit Peter Simonis unumgänglich machten:
Es muss so Mitte August 1989 gewesen sein. Ich hatte nämlich gerade eines dieser typisch langen und „honorarlosen” Telefonate mit einem Mandanten beendet, indem wir etwa eine halbe Stunde über die deutsch-deutsche Entwicklung und die sich anbahnende Aussicht einer Wiedervereinigung mit friedlichen Mitteln spekuliert hatten. (Anlass waren die Montagsdemonstrationen in der DDR und der bemerkenswerte Anstieg der Zahlen von Flüchtlingen, die unbehelligt über die grüne Grenze zwischen Ungarn und Österreich nach Westdeutschland ausreisten.) Jedenfalls, kurz nachdem ich den Hörer aufgelegt hatte und mich endlich wieder meiner Arbeit zuwenden wollte, bei der ich unterbrochen worden war, stand schon die nächste Störung in Person einer Mitarbeiterin an meinem Schreibtisch. Sie betreute einen Mandanten, der kurz zuvor von Simonis – ohne mein Dazutun, aus freien Stücken, wie ich ausdrücklich betonen möchte – zu mir gewechselt war, und informierte mich darüber, dass ein der Sparkasse zugesagter Termin für den Jahresabschluss dieses Mandanten gefährdet sei, da sich die Unterlagen zur Ermittlung des Bestandes an Halbfertigarbeiten nicht bei den von Simonis übergebenen Akten befänden. Sie hatte deswegen schon mehrmals in seiner Kanzlei angerufen. war dort aber jedes Mal erneut vertröstet worden, und wusste sich nun nicht mehr zu helfen.
Ich versprach ihr, mich noch heute darum zu kümmern und bei Simonis persönlich anzurufen. Ich dachte damals noch, dass er bestimmt nichts von dieser Schlamperei wusste und sogar froh darüber sein würde, durch mich über einen Mangel aufgeklärt zu werden, bevor er sich für ihn schädlich auswirken konnte. Schließlich gibt es in unserem Berufsstand gewisse Regeln und Normen, die wir alleine schon im Interesse der uns anvertrauten Mandate einhalten sollten.
Ich wollte gerade den Hörer in die Hand nehmen, als Frau Gerbes, ebenfalls eine Mitarbeiterin, in mein Büro kam. Sie druckste herum, dass „die Petra” doch gerade wegen Steuerberater Simonis bei mir gewesen sei und sie da ein persönliches Problem habe und ob ich ihr auch nicht böse sei, weil es sich um einen Kollegen handle, und sie wisse auch gar nicht, ob sie darüber mit mir reden solle und …
In einem Anflug chauvinistischer Gehässigkeit wartete ich nur noch darauf, dass sie mit der bei Frauen so beliebten Killerphrase „und überhaupt” käme. Das wollte ich ihr und vor allem mir nicht antun. Deshalb unterbrach ich sie, wobei ich mich bemühte, meine Ungeduld zu zügeln: „Frau Gerbes, bitte, Sie können und sollen über alles mit mir reden. Was macht Sie denn so befangen?”
„Na ja, Sie sind immer so souverän und machen nie was falsch!”
Ich musste schmunzeln.
„Verwechseln Sie da nicht Souveränität mit der Gelassenheit des Alters?”
Verdammt, da kokettierte ich doch tatsächlich schon mit meinem Alter. Eigentlich sollte ich mir mit diesen spätpubertären Signalen noch etwas Zeit lassen. Ich sah Beatrice, mit der ich damals noch in ungetrübter Eintracht verheiratet war, vor mir, wie sie mit kraus gezogener Stirn und vorwurfsvoll geschürzten Lippen den Kopf schüttelte. Schnell das Thema wechseln!
„Von wegen, nie etwas falsch machen, Frau Gerbes, Unfehlbarkeit mag vielleicht ein Anspruch einer unserer Kirchen sein, aber nicht der meine. Auch ich mache natürlich Fehler. Vielleicht sollte ich sie Ihnen immer mal wieder beichten, um Ihnen Ihre Verzagtheit zu nehmen? Also, raus mit der Sprache! Wo kann ich helfen?”
„Ja also”, sie schluckte und setzte erneut an, „also, das war vor ein paar Wochen. Ich hatte mich mit einer Kollegin, die ich noch von der Berufsschule her kenne, zum Abendessen beim Griechen in der Hospitalstraße getroffen. Und da kam ihr Chef rein – Herr Simonis. Er setzte sich dazu, gab einen Retsina aus und unterhielt sich mit uns. Er machte einen sehr sympathischen Eindruck. Bevor er dann an einen anderen Tisch ging, wo er schon erwartet wurde, drückte er mir seine Karte in die Hand und sagte, dass er für solche Mitarbeiterinnen wie mich immer einen Platz in seiner Kanzlei hätte. Ich habe den Vorfall bald wieder vergessen, bis er gestern Abend bei mir zu Hause anrief.”
Dabei betonte sie das Wort zu Hause, als würde sie es mit einem unsittlichen Antrag verbinden.
„Ich weiß gar nicht, wo der meine Telefonnummer her hat”, brüskierte sie sich kopfschüttelnd.
„Na, da gibt es zum Beispiel Telefonbücher … oder die Auskunft und auch Ihre Bekannte, die bei ihm arbeitet”, spielte ich ihr des Rätsels Lösung zu.
Entweder war die Ironie dezent genug oder sie hatte meinen sanften Tonfall absichtlich überhört. Sie fuhr jedenfalls unvermittelt fort: „Da fragte der mich doch glatt, ob ich nicht bei ihm arbeiten möchte. Er hätte gerade eine Stelle frei und würde mir sofort 500 Mark mehr bezahlen, als ich bei Ihnen bekäme. Das ist doch eindeutig Abwerbung. Darf der denn das überhaupt?”
„Hat jemand bei Ihnen zu Hause dieses Telefonat mitgehört?”, forschte ich nach, ohne erst einmal auf ihre Frage einzugehen.
„Nein, ich war alleine.”
„Wären Sie bereit, das, was sie mir eben erzählt haben, vor einem Vertreter der Steuerberaterkammer auszusagen?”
„Nun, ich weiß nicht … das ja nicht gerade”, zierte sie sich.
„Sehen Sie” (ich unterstrich meine Antwort mit einem Schulterzucken) „dann darf der das. Sie wissen doch: Wo kein Kläger, da kein Richter. Aber”, lenkte ich mit freundlichem Blick ein, „ich finde es toll, dass Sie mir das gesagt haben. Danke für Ihr Vertrauen. Darf ich wenigstens Herrn Simonis darauf ansprechen?”
„Ja”, kam es zögerlich. Und dann verließ sie doch sichtlich erleichtert mein Büro.
Ich war schon immer für klare Verhältnisse. Also wartete ich nicht lange ab, sondern packte den Stier bei den Hörnern und wählte Simonis Kanzleinummer. An der ersten Dame kam ich problemlos vorbei. Die Nennung meines Namens mit Titel schien ihren Zweck nicht zu verfehlen – dachte ich. Sie vermittelte mich weiter, allerdings zu einem Herrn Kramer, der sich als Büroleiter vorstellte und mich fragte, worum es denn gehe.
„Eine Angelegenheit zwischen Kollegen”, versuchte ich mein Glück mit der Autorität meines Berufsstandes.
Es half nichts. Er verlangte Genaueres zu erfahren und in mir begann es langsam zu kochen. ’Nun gut’, dachte ich, ’gib dem Affen seinen Zucker.’
„Es gibt da Probleme mit einem Ihrer ehemaligen Mandanten und zudem muss ich mich wegen eines merkwürdigen Telefonats mit ihm unterhalten. Genügt das jetzt!?”
„Einen Moment, bitte.”
Für etwa 10 Sekunden hörte ich gar nichts mehr, bis ich endlich verbunden wurde. Es meldete sich … nein, nicht der „ersehnte” Kollege, sondern eine Frauenstimme, mit diesem sinnlich-dunklen Timbre, das einen halbwegs empfindsamen Mann selbst bei bester Gesundheit in lebensbedrohliche Atemnot stürzen konnte.
„Ulmer, guten Tag, Herr Schäfer, sie wollen Herrn Simonis sprechen? In welcher Angelegenheit denn bitte?”
Jetzt platzte mir doch der Kragen. Daran änderten auch die freundlichen Phrasen und die betörende Klangfarbe dieser Stimme nichts.
„Sind Sie in der Lage, mir ohne Ausflüchte, wahrheitsgemäß und in allgemein verständlichem Deutsch eine Frage zu beantworten?”, blaffte ich.
„Aber natürlich.”
Sie war weiterhin freundlich, was ich diesem Moment als geschmacklos empfand. Wenn ich wütend sein wollte, hatte sie mir nicht mit ihrer penetrant ekelhaften Freundlichkeit den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ich kam mir vor wie bei einem Rollenspiel in einem Konfliktbewältigungs-Seminar.
„Als Juristin und Geschäftspartnerin von Herrn Simonis sollte ich dazu durchaus in der Lage sein – fragen Sie!”
Paff! Das hätte eigentlich sitzen sollen. Jedoch, anstatt heilfroh zu sein, ihr in diesem Moment nicht – mit beiden Füßen im Fettnapf – persönlich gegenüberstehen zu müssen, zog ich meine Masche ungerührt durch.
„Ist Herr Simonis im Büro?”
„Ja. War das die ganze Frage?”
„Ist er in einer halben Stunde auch noch da?”
„Wenn nichts dazwischenkommt, ja.”
„Dann werde ich in etwa dreißig Minuten bei Ihnen in der Kanzlei sein und ich will ihn sprechen. Persönlich, ohne Bodyguard. Sagen Sie ihm das.” Ich hängte ohne Gruß auf und … ärgerte mich. Was machte mich so zornig? Ich wusste es nicht – noch nicht.
Simonis wohnte in einem Bungalow unweit der Landesnervenklinik und des Rheinhessen-Einkaufscenters. Er hatte ihn sich vor etwa 20 Jahren in dem damals üblichen Baustil auf dem hinteren Teil eines über 2.000 Quadratmeter großen Grundstückes errichten lassen. Wuchtige Bäume, ein künstlicher Bachlauf und der obligatorische Pool vor der riesigen Terrasse – natürlich mit Hollywoodschaukel – vermittelten einen zwar üppigen, aber auch protzigen Eindruck. Das Areal hatte er, laut Hörensagen, mitsamt ehemaligem Wohngebäude und Kanzlei seinem Vorgänger, dem Steuerbevollmächtigten Albrecht Comenius, für einen Spottpreis abgekauft. Er soll den älteren Kollegen, der zwar bereits 79 Jahre alt, aber geistig und körperlich noch topfit war und der endlich seinen Ruhestand hatte genießen wollen, mit allerhand Versprechungen, die er aber nie eingehalten hatte, ziemlich unverschämt über den Tisch gezogen haben. Simonis soll damals über Comenius’ Tochter, die mit ihrem Mann irgendwo am Niederrhein lebte, Einfluss auf ihn genommen haben – gegen „angemessene Beteiligung” selbstredend. Soweit berichtete es zumindest die Gerüchteküche, und dass Comenius ziemlich plötzlich wenige Monate nach Übergabe gestorben war.
Das ehemalige zweigeschossige Wohnhaus von Simonis’ Vorgänger war bedarfsgemäß umgebaut worden und beherbergte nun die Kanzlei. Davor hatte man einen zweistreifigen Parkplatz angelegt. Links parkten offensichtlich, wie an den Marken und Größen der Wagen zu erkennen war, die Angehörigen der Kanzleileitung, rechts die Mitarbeiter. Ich stellte meinen vom Ackerstaub verschmutzen VW Variant zwischen einem silbergrauen, blitzenden S-Klasse-Mercedes und ein ebenso sauberes schwarzes BMW Cabriolet ab. Zum Glück hatte ich mich noch nie über die Größe meines Autos definiert, sonst hätte mein Selbstbewusstsein jetzt wohl einen Knacks bekommen.
Auf mein Klingeln hin ertönte schnarrend der Türöffner. Ich trat in einen modern eingerichteten, klimatisierten Vorraum ein, der mich in seiner sterilen Nüchternheit woran erinnerte? An eine Arztpraxis, eine Bankschalterhalle? Was es auch gewesen sein mag, es nahm gleichermaßen gefangen, wie es befangen machte. Wie konnte man in einer solchen Atmosphäre nur arbeiten? Keine Bilder an den Wänden, keine Pflanzen. Kaltes Neonlicht wurde von den überdimensionierten, grellweiß glänzenden Fliesen reflektiert, dass es in den Augen schmerzte. Der älteren Dame, die Mühe hatte, ihren Kopf über eine tresenähnliche Balustrade zu heben, verlieh die schonungslose Beleuchtung eine ungesunde Hautfarbe.
„Guten Tag, Sie sind Herr Schäfer?”, stellte sie unsicher fest.
Mein telefonischer Auftritt war also nicht unbeachtet geblieben.
„Korrekt”, versuchte ich freundlich, aber bestimmt meine Position bereits im Vorfeld zu festigen. Nur keine Verbindlichkeit zeigen, auch nicht hier am Empfang.
„Ich sage Herrn Simonis sofort …”, weiter kam sie nicht, denn aus dem hinteren Teil des Flures schallte mir eine freundliche Stimme entgegen:
„Kollege Schäfer, seien Sie herzlich willkommen in meiner bescheidenen Kanzlei.” Das konnte nur Simonis sein, der mit diesen Worten auf mich zukam. Ich musste mich konzentrieren, um sein Äußeres, das, was er sagte, wie er es sagte und was er tatsächlich meinte in einen möglichst von jeder Missinterpretation freien Zusammenhang zu bringen. Ein extrem schwieriges Unterfangen, welches meine Reagibilität auf ein für mich unangenehmes Minimum reduzierte. Mit anderen Worten, ich war total verunsichert, durfte mir aber nichts anmerken lassen.
Da streckte mir ein kleiner, drahtiger Mann – ich schätzte ihn auf Ende vierzig, einen Meter fünfundsechzig groß und circa 60 Kilo schwer –, von dem ich bisher nur Schlechtes gehört hatte, mit einer herzlichen Geste beide Hände mit nach oben geöffneten Handflächen entgegen.
Die Hand, die ich zum Gruß ergriff, war feucht, seine in einem dreckigen Braun nachgefärbten Haare glänzten, wie bei einem Gigolo der dreißiger Jahre. Ob gegelt oder nur ungepflegt fettig, konnte ich nicht beurteilen. Schweiß, der sogar hinter den Gläsern seiner schwarzen Hornbrille perlte, die ihm ein strenges Aussehen verlieh, komplettierte das irritierende Bild. Meine Objektivität wurde bei diesem Wechselbad an ersten Eindrücken auf eine unerwartet harte Probe gestellt.
„Es tut mir Leid”, plapperte er mit augenfälliger Lebhaftigkeit, „dass man Sie am Telefon anscheinend missverstanden hat. Natürlich hätte man Sie sofort zu mir durchstellen sollen. Na ja, Sie wissen ja, wie das heute mit den Mitarbeitern so ist.”
„Eigentlich nicht, meine Mitarbeiter …”, versuchte ich entgegenzuhalten – sinnlos, er schwatzte weiter, als hätte ich bestätigend genickt.
„Ich freue mich, Sie kennen zu lernen. Ich weiß natürlich, dass sich ein neuer Konkurrent in meinen Pfründen eingenistet hat.” Die Ausdrücke „Konkurrent” und „Pfründe” begleitete er mit einem meckernden Gelächter, womit er wohl verdeutlichen wollte, dass es sich um scherzhafte Bemerkungen handelte.
„Aber”, fuhr er unbeirrt fort, „Platz ist in der kleinsten Hütte, sag’ ich immer. Wir haben doch alle genug Arbeit, da braucht der eine dem anderen nichts zu neiden. Und außerdem”, inzwischen hatte er mich zutraulich beim Arm gefasst und zog mich den Gang, aus dem er kurz zuvor aufgetaucht war, „werden wir alle nicht jünger. In unserem Alter muss man anfangen etwas kürzer zu treten. Wenn die Kerzen auf der Geburtstagstorte teurer sind, als die Torte selbst, sag’ ich immer, wird es Zeit, an sich selbst zu denken.” Dabei bekam sein Gesicht kurzfristig einen derart abwesenden und verklärten Ausdruck, dass ich in diesem Moment geneigt war, ihm abzunehmen, dass er glaubte, was er sagte. Doch diese Anwandlung sollte sehr schnell auch wieder verfliegen.
Wir waren in seinem Büro angekommen. Büro? Ein Tanzsaal von mindestens 60 Quadratmetern stellte einen eklatanten Kontrast zu Vorraum und Flur dar. Die Gigantomanie dieser innenarchitektonischen Entgleisung drohte mich zu erschlagen. Riesiger Schreibtisch, riesiger Besprechungstisch mit zehn Stühlen und riesig vergrößerte Aufnahmen an den Wänden. Simonis mit Helmut Kohl, Simonis mit Bernhard Vogel, Simonis mit Hans-Otto Wilhelm. Weitere unzählige, Fotos in Postkartengröße bedeckten die Wände: Simonis auf seiner Segelyacht, vor seinem Haus auf Malta (die Besitzverhältnisse wurden dem Betrachter durch in Bronzeschildchen gepresste Hinweise erklärt). Aber auch Simonis mit Landräten, Präsidenten des Landwirtschafts- und Weinbauverbandes, mit Roberto Blanco, Mary Roos, Mario Adorf, Heinz Schenk, Hans-Dieter Hüsch, mit Franz Beckenbauer beim Golfturnier, mit Margit Sponheimer und Ernst Neger bei einer Fernsehsitzung und so vielen anderen Sternen und Sternchen, dass ein flüchtiger Blick zur Verinnerlichung dieser Galerie nicht genügte. So viel aber sagte dieses Sammelsurium aus: Simonis war nicht gerade zimperlich und anspruchsvoll, wenn es darum ging, sich mit der Reputation anderer zu schmücken, wobei er dem Motto zu folgen schien: Qualität schadet nichts, aber Quantität nützt mehr.
Daneben hingen die Leitlinien des Lions Clubs als hölzerne Intarsienarbeit, die Ehrenurkunde für 25-jährige Mitgliedschaft beim HSV Alzey und andere Auszeichnungen – alles sichtbare Beweise, für die bedeutende Rolle, die Simonis spielen wollte, und seine weit reichenden Verbindungen.
Ich bemühte mich, mir nicht anmerken zu lassen, dass mich diese geballte Ladung Public Relation nicht unberührt ließ. Und er war bemüht, sich nicht anmerken zu lassen, dass ihm meine gespielte Gleichgültigkeit nicht entging.
„Käffchen?”, fragte er, nachdem wir uns auf seine einladende Geste hin am Schreibtisch einander gegenüber platziert hatten. „Cappuccino, Espresso, Latte Macchiato? Alles da.” Er deutete auf einen chromblitzenden, natürlich ebenfalls überdimensionalen Kaffeeautomaten.
„Ach wissen Sie was, wir trinken zur Feier des Tages einen Napoleon – Spitzencognac, garantiert 20 Jahre alt, habe da so meine Quellen. Direktimport, Sie verstehen? Wenn sie mal was brauchen, Peter Simonis hilft gerne aus.”
Dabei drückte er die Taste zu einer archaisch anmutenden Rufanlage und forderte ohne weitere Einleitung: „Bienchen, bringen Sie uns mal zwei Ladungen vom feinen Gebrannten, Sie wissen schon.”
Es gehörte bis dahin zu meinen unumstößlichen Prinzipien, während der Arbeitszeit keinen Alkohol zu trinken. Ja, einmal ein Glas Sekt, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin Geburtstag hatte. Außerdem mochte ich keinen französischen Cognac. Meine Geschmackspapillen schienen selbst beim Genuss der erhabensten Vertreter dieser Weinbrandspezies derart missverständliche Signale an mein Gehirn zu leiten, dass es auf diese offensichtlich mit dem Fehlalarm: „Achtung, Seifenlauge!” reagierte.
Die überschwängliche Art von Simonis nahm mich jedoch so gefangen, dass ich nicht im Geringsten an Abwehr dachte. Es war nicht so, dass er mich positiv einnahm, eher paralysierte mich seine faszinierende Exzentrik.
„Ich habe ja sonst so gar keinen Kontakt zu den Kollegen hier. Weiß auch nicht, was die gegen mich haben. Ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht in Verbindung bleiben würden. Man muss doch ab und zu mal jemanden zum Quatschen haben, der die gleiche Sprache spricht. Ich vermisse das immer mehr. Können Sie das verstehen?”
Und wieder veränderte sich seine Mimik für den Bruchteil einer Sekunde. Die zuvor gezeigte Munterkeit und Souveränität verschwanden auf einen Schlag. Er sah kurz nach unten auf seine Fingernägel, seufzte und richtete dann wieder seinen Blick auf mich.
Während ich noch überlegte, ob er eine Antwort erwartete, und wenn ja, was ich sagen sollte, wurde die Tür ohne vorheriges Anklopfen geöffnet. Ein Tablett mit zwei gefüllten Cognacschwenkern wurde hereingetragen von … Mirielle Mathieu, als sie noch um die 30 war. Die gleiche Körpergröße, auffällig passend zu Simonis, die schwarzen Haare zum charakteristischen Pagenkopf geschnitten, ein schwarz-weißes Kostüm, welches aus der Kollektion einer Mary Quant (oder war es Courege?) hätte stammen können und dessen Rock kurz über den Knien ihrer sportlich gebräunten, wohlgeformten Beine endete.
„Ich möchte, dass sie meine Rechtsanwältin kennen lernen, Sabine Ulmer”, stellte Simonis die Erscheinung aus den Siebzigerjahren vor, und fügte dann völlig unmotiviert hinzu, „einen Luxus, den ich mir leiste. Aber man gönnt sich ja sonst nichts, sag’ ich immer.” Und wieder dieses Meckern, mit dem er das Feudalistische seiner letzten Bemerkung mildern wollte. Dann zeigte er mit einer fast theatralischen Handbewegung auf mich. „Und das ist …”
„Herr Schäfer, ich weiß. Wir hatten bereits das Vergnügen”, unterbrach sie ihn, lächelte mich dabei aber so freundlich an, dass ihrer Erklärung jeder Anflug einer Doppeldeutigkeit genommen war. Am Telefon hatte der Klang ihrer Stimme etwas ausnehmend Erotisches, aber in Verbindung mit ihrer Erscheinung wirkte er geradezu drollig, wenn nicht sogar grotesk. Sie stellte die Gläser vor uns ab, wobei ich ihre prunkvolle Damenrolex bewundern konnte, die sie am linken Handgelenk trug.
„Na, Bienchen, dann wieder ab an die Arbeit”, schäkerte Simonis und unterstrich seine launische Bemerkung mit einem schwungvollen Klaps auf ihr Hinterteil. Ich hatte einen scharfen Protest gegen diese Aufdringlichkeit erwartet, die umso beleidigender war, als sie in meinem Beisein stattfand; aber sie kicherte stattdessen wie ein kleines Mädchen und verschwand durch die Tür, nicht ohne mir noch ein „Tschüs” zuzuwinken.
„Mein Büroleiter hat sie mir empfohlen”, nickte Simonis Bienchen hinterher, „und als ich sie dann sah, konnte ich einfach nicht nein sagen. Außerdem, dachte ich mir, ist ihr juristisches Staatsexamen gut für das Renommee. Macht sich gut im Briefkopf. Aber, wie sagten schon die alten Römer? Honit soit qui mal y pense. Doch nun, Herr Kollege” – endlich kam er zur Sache – „was führt Sie so quasi aus dem Stegreif zu mir?” Dabei hob er den Cognacschwenker, prostete mir zu, kippte den Weinbrand mit einem Schluck hinunter und schmatzte mehrmals genüsslich. Es fehlte nur noch das befreite „Aaahhhhh”, wie man es von durstigen Pilstrinkern in den Vorstadtkneipen kennt.
Ich setzte mein Glas, ohne davon getrunken zu haben, mit einer übertrieben langsamen Bewegung ab, lehnte mich zurück und faltete die Hände vor meinem Bauch. Jetzt war ich dran, das war mein Auftritt.
„Sie wissen, dass wir das Mandat Krüger von Ihnen übernommen haben. Da fehlen noch Unterlagen, die sich in Ihrer Kanzlei befinden müssen. Meine Mitarbeiterin hat mehrmals vergeblich …”
„Larifari!”, unterbrach er mich mit einer unwirschen Handbewegung. Seine Augen begannen auf einmal hin und her zu wandern, so als ob die Kontrolle über sie verloren hätte. Peter Simonis hatte sich seiner höflichen, ja, fast liebenswürdigen Maske von einer auf die nächste Sekunde entledigt. Was dabei heraus kam war die Bestätigung des Bildes, das man mir von ihm schon so oft gezeichnet hatte.
Ich hatte es erwartet, darauf gelauert und wollte doch eigentlich gar nicht, dass es geschah. Oder hatte ich es unbewusst provoziert, um mir meine unterschwellig vorhandene, schlechte Meinung bestätigen zu lassen? Jetzt verstand ich auch auf einmal, weshalb mich bereits am Telefon die ganze Angelegenheit so zornig gemacht hatte: Ich hatte – zu Recht – befürchtet, dass die beharrlichen Einflüsterungen auch bei mir, dem ach so toleranten, objektiven Darius Schäfer, ihre Wirkung nicht verfehlt hatten.
„Was war das andere, was Sie von mir wollten. Sagen Sie schon, ich habe meine Zeit nicht gestohlen, also raus mit der Sprache”, bellte er, wobei er ich besonders betonte und dadurch, so ganz nebenbei, eine Gehässigkeit abfeuerte.
„Sie haben versucht, eine Mitarbeiterin von mir abzuwerben, das kann …” und wieder fiel er mir ins Wort.
„Versucht? Mein lieber Herr Kollege, versucht? Wenn ich wen will, bekomme ich ihn auch. Einem Peter Simonis entzieht man sich nicht! Haben Sie das verstanden? Aber mal der Reihe nach.
Wie Sie es geschafft haben, mir das Mandat Krüger abspenstig zu machen, will ich gar nicht wissen. Ich sage nur eines: Noch einmal machen Sie das nicht! Dann werde ich Ihnen eine Anzeige bei der Kammer hinhängen, die sich gewaschen hat. Ich habe meine Connections”, dabei zeigte er mit einer raumgreifenden Handbewegung auf die Bildergalerie, „und die werde ich erbarmungslos einsetzen. Also, Vorsicht!
Im Übrigen gibt es bei mir keine Unterlagen mehr. Es wurde alles ordnungsgemäß an Sie überstellt. Ich kenne meine Pflichten!” Und wieder die Betonung auf ich. „Wenn tatsächlich etwas fehlt, kann es nur bei Ihnen verschlampt worden sein. Bei mir herrscht Ordnung.”
Einer derartigen Impertinenz war ich einfach nicht gewachsen. Ich sah ihn mit ungläubigen Augen an. Das war doch ein böser Traum, oder? Doch der Albtraum, der keiner war, ging weiter.
„Und nun noch einmal zu der angeblichen Abwerbung. Ich kann mich an nichts Derartiges erinnern. Würde ich ja auch nie tun. Oder haben Sie etwa Beweise?”
Ich zuckte mit den Schultern.
„Sehen sie”, missverstand er absichtlich meine Geste, „ich glaube ja eher, Sie haben einfach nur Schiss, dass es eine Ihrer Mitarbeiterinnen, die ich zufällig einmal in einem Restaurant kennen gelernt habe, in Ihrem Dorfbüro nicht mehr aushält und endlich in einer niveau- und anspruchvollen Qualitätskanzlei arbeiten möchte. So sieht es für mich aus.”
Dabei hatte er gleichzeitig die Lautstärke und sich erhoben und war, da es ihm aufgrund seiner geringen Größe nicht gelungen wäre, sich bedrohlich über seinen Schreibtisch zu recken, neben meinen Stuhl getreten. Die despotische Geste und das Widersinnige seiner Worte waren für mich das Signal aufzustehen. Dabei überragte ich ihn natürlich auf eine für ihn so unangenehme Art, dass er automatisch einen Schritt zurückwich. Diese Gesprächspause nutzte ich zum Gegenschlag.
„Woher wissen Sie denn, dass es sich um die Mitarbeiterin handelt, die Sie, wie Sie selbst erklärten, bereits kennen gelernt haben? Das habe ich doch mit keinem Ton erwähnt.”
Kurzfristig hatte ich ihn aus dem Tritt gebracht und in die Ecke gedrängt. Mit zusammengekniffenen Lippen sah er, meinem Blick ausweichend, irritiert zu Boden, als suche er dort die Antwort. Sie kam schnell, rücksichtslos und routiniert, wie bei einem gestandenen Industrie- oder Gewerkschaftsboss, dem unwiderlegbar Verfehlungen und dunkle Machenschaften nachgewiesen worden waren: Seine Körperhaltung straffte sich, der Größenwahn hatte ihn wieder im Griff. Er stützte sich mit der Rechten auf seinen Schreibtisch und wies mit einer ausladenden Geste der ausgestreckten Linken zur Bürotür.
„Jetzt aber raus hier. Ich brauche mich doch nicht in meinem eigenen Büro verleumden zu lassen! Und dann noch mit solch üblen, manipulativen Tricks. Schleicht sich hier ein, macht einen auf Kollege und jetzt das! Gestapomethoden nenne ich das, jawohl, Gestapomethoden oder meinetwegen auch Stasimethoden, Sie können sich’s aussuchen. Und jetzt raus, aber sofort!”
Ich setzte zwar noch einmal zu einer Erwiderung an, verkniff sie mir aber, schüttelte stattdessen den Kopf und verließ, vorbei an der konsternierten Dame am Empfang, die Kanzlei. Draußen schlug mir die brutale Hitze dieses Sommertages entgegen, aber ich konnte endlich wieder aufatmen. Auf der Rückfahrt nach Bernheim kramte ich mein Gedächtnis durch, nach allem, was ich jemals über Paranoia und Schizophrenie gehört oder gelesen hatte. Die Beschimpfungen, mit denen ich ihn jetzt in seiner Abwesenheit zur Erleichterung meines malträtieren Egos bedachte, waren auch nicht ohne! Da wusste ich jedoch noch nicht, dass ich eines Tages mit dem Anblick seines leblosen Körpers, seines von entsetzlichen Qualen verzerrten Gesichts konfrontiert werden würde Und ich wusste auch noch nicht, dass ich mich einmal für meine Verwünschungen schämen würde.
Seitdem habe ich Peter Simonis nie mehr getroffen. Auf eine Mitteilung an die Steuerberaterkammer hatte ich übrigens verzichtet. Die Sache war mir einfach zu dumm. Außerdem, so meine hässlichen Vorurteile, hatte der dafür zuständige Justitiar bestimmt Bedeutungsvolleres zu tun, als seine mit meinem Pflichtbeitrag subventionierte Zeit mit derart „belanglosen Dingen” zu verschwenden. Er beschäftigte sich lieber mit der Abmahnung von Kollegen, deren Kanzleischild ein paar Zentimeter größer war, als die damals gültige Fassung unseres „Standesrechtes”, als dessen auserwählter und wehrhafter Gralshüter er sich verstand, es gestattete.
Wir fertigten die fehlenden Unterlagen so gut es ging mit Hilfe der Handaufzeichnungen des Mandanten nach und ich machte einen diesbezüglichen Einschränkungsvermerk in der Abschlussbescheinigung.
Kriminalhauptkommissar Koman hatte im Gebäude der Polizeiinspektion Alzey ein anderes Büro am Ende eines Flures im zweiten Obergeschoss bezogen. Es war nicht nur größer als das, in dem ich ihn das letzte Mal besucht hatte, es war sogar merklich besser ausgestattet. Das zweiflügelige Fenster bot einen beruhigenden Blick auf den Hof einer gegenüberliegenden Schule, von dem Pausenlärm durch das geöffnete Fenster drang.
Die rachitischen Möbel von dem letzten Jahr waren durch einen funktional geschnittenen Schreibtisch ersetzt worden, der sowohl für Besprechungen geeignet war als auch einem neuen PC Platz bot, von dem man allerdings nur Bildschirm, Tastatur und eine Funk(!)maus sah – der Rest war wohl unter dem Tisch verborgen. Sogar seine Akten, die in mehreren Stößen unterschiedlicher Höhe aufgetürmt waren und die Koman nach einem – für nicht Eingeweihte zwar mysteriösen – auf blitzschnellen Zugriff zugeschnittenen System geordnet hatte, ließen noch Platz für spontan geforderte Bewegungsfreiräume.
Für drei Besucher gab es bequeme Stühle, und Koman fühlte sich in seinem ergonomisch geformten Chefsessel sichtlich wohl; zumindest ließ sein zufriedenes Grinsen, mit dem er mich begrüßte, keinen anderen Rückschluss zu. Freilich, nicht alles war neu. Seine alte IBM-Kugelkopfmaschine hatte zwar ausgedient, aber einen Ehrenplatz auf einem Beistelltisch erhalten, wo ihr immer noch frisches IBM-Mattrot in Konkurrenz mit dem Glanzgrau eines nagelneuen Saecco-Espressoautomaten trat.
Mit kindlich anmutendem Stolz fragte er: „Na, wie gefällt Ihnen mein neues Reich?”, und fügte, bevor ich noch antworten konnte, hinzu: „Um es gleich vorwegzunehmen, die Espressomaschine habe ich selbst bezahlt, kein Cent Steuergelder steckt da drin, Herr Paragraphenreiter.”
„Und den Kaffee”, frozzelte ich zurück, „bringen sie den auch von zu Hause mit? Wahrscheinlich klammheimlich, damit Ihre Frau nichts merkt.”
Ich schien, ohne es zu wollen, einen schmerzhaften Schlag gelandet zu haben. Koman nahm seine Brille ab und schloss die Augen. Mit Daumen und Zeigefinger fuhr er unter kräftigem Druck zwei, drei Mal von der Nasenwurzel bis zur Nasenspitze. Dann wuchtete er seine 1,95 Meter große, hagere Gestalt mit einer müden Bewegung aus seinem Stuhl und baute sich, ohne ein Wort zu sagen, mit dem Rücken zu mir vor der Espressomaschine auf. Geistesabwesend pickte er ein paar Kaffeekrümel aus der Tropfschale, bevor er sich mit einer heftigen Bewegung zu mir umdrehte.
„Für den Kaffe”, begann er schleppend, „da haben wir tatsächlich ein Budget. Der gehört bei uns zum Geschäft, gewissermaßen. Unterstützt den Aufbau einer erlaubenden Atmosphäre. Lockert Blockaden bei Vernehmungen und Protokollierungen. Dafür gibt es sogar ein Kontingent Zigaretten. Hilft natürlich nicht bei jedem. Und ist auch nicht typisch für jede Dienststelle, aber wir handhaben das so. Betrieblich notwendige Verbrauchsgüter könnte Ihr Fachbegriff dafür lauten.”
Es war weder eine Frage, noch eine wichtige Feststellung, also korrigierte ich ihn nicht, sondern nickte ihm nur aufmerksam zu. Da musste doch noch etwas kommen – und es kam:
„Und was das zu Hause betrifft. Das war einmal. Ich wohne seit drei Monaten in einem 1-Zimmer-Appartement. Tja, lieber Herr Schäfer, da sind wir wohl Schicksalsgenossen. Nur, dass wir keine Kinder haben. Aber glauben Sie nicht, dass es deswegen leichter ist. Auch meine Frau wollte oder konnte mich nicht mit meinem Beruf teilen. Zu viele Überstunden, zu viele plötzliche Einsätze. Vor allem aber zu viel Angst. Wir dienen ja nur noch als Blitzableiter für die aufgestauten Aggressionen eines Teiles unserer Gesellschaft, der die jahrzehntelang verschleppten Strukturreformen auszubaden hat, aber letztlich nicht kriminell wird.
Und dann sind da die anderen in unserer an sich begrüßenswerten, multikulturellen Gesellschaft. Diejenigen, die unseren glatzköpfigen und rassistischen Neonazis als willkommene Argumente für ihre dumpfen nationalistischen Parolen haargenau ins Konzept passen. Ihre Gewaltbereitschaft und so selbstverständliche Brutalität, die kaum nachvollziehbar ist, erreichen ungeahnte Dimensionen. Der Begriff Bulle wird zwar als Schimpfwort geahndet und die Verwendung mit einer Geldstrafe belegt, aber der Mensch Bulle ist für sie Freiwild, Zielscheibe. Die haben sich hemmungslos und ungehindert mit Waffen aufgerüstet. Dealer, Waffenschieber, Mädchenhändler, Autoschieber, Einbrecher, die keine Hemmschwelle kennen und kaltschnäuzig zur Waffe greifen, wenn sie ertappt werden.
Und dann werden sie, kaum, dass wir sie unter Einsatz unseres Lebens, nach akribischen Recherchen – immer einen Fuß in einer Dienstaufsichtsbeschwerde, die eine Beförderung hemmt – endlich dingfest gemacht haben, innerhalb kürzester Zeit wieder auf freien Fuß gesetzt. Manche erwischen wir in einer Woche gleich mehrmals. Mafiöse Strukturen werden verleugnet, nach dem Motto, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Da kann man doch nach dem Dienst nicht nach Hause gehen und alles ablegen! Das bleibt doch in den Klamotten stecken! Sagen Sie mir, lieber Schäfer, welche Frau ist so bekloppt, oder sagen wir besser, so überirdisch stark, das auf Dauer mitzumachen? Meine zumindest war es nicht, und ich kann es ihr auch nicht verübeln.”
Nach diesem Wortschwall war ich für einen Moment perplex. Ich vergaß immer wieder nur zu gerne, dass nicht nur wir Steuerberater uns mit anscheinend unüberbrückbaren Konflikten zwischen Familie und Beruf zu arrangieren hatten und nicht die Einzigen unter der Sonne waren, die unter den Verstrickungen der Gesetzgebung und dem Ausbleiben einer längst überfälligen Revidierung zu leiden hatten, und dafür, weil die wahren „Täter” nicht haftbar gemacht werden konnten, zur Verantwortung gezogen, ja sogar angegriffen wurden. Und nun musste ich erkennen: Es gab noch andere arme Würstchen! Was sollte ich sagen?
Am besten das: „Tja, was soll ich da sagen?”
„Nichts. Wie lange haben Sie Zeit?”
„Na, so bis gegen drei Uhr.”
„Gut, wie wäre es dann mit einem Mittagessen beim Italiener um die Ecke?”
Dafür war ich immer zu haben, zumal Koman sogar die Begleichung der Rechnung auf „Staatskosten” in Aussicht stellte.
Wir fanden einen freien Tisch in einer kleinen Nische und beschäftigten uns stillschweigend mit den gereichten Speisekarten.
„Spaghetti al la Casa”, fragte ich den Kellner, „was ist das?”
„Isse, Spesialität vonne unsere Seffe de Kutschina. Isse prima.” Er küsste dabei mit einer ausladenden Geste das Rund, das er mit Zeigefinger und Daumen seiner rechten Hand geformt hatte, wobei er die restlichen drei Finger geziert abspreizte. Eben die typische Gebärde, die man von einem normalen Italiener erwarten durfte.
„Smegge so ähnlis, wie Pasta Diavolo”, fügte er hinzu. Und da er an meinem Gesichtausdruck erkennen konnte, dass seine Erklärung immer noch nicht den erwünschten Erfolg hatte, beendete er seine Empfehlung mit der gut gemeinten Warnung: „Isse sarf, wie Sau! Scusi, icke wolle sage, isse sehr wurzig.”
Immerhin bemühte er sich um eine Sprache, die ihm wohl noch Probleme bereitete, daher verkniff ich mir auch nur den Ansatz eines Grinsens. Ich wollte schon bestellen, da mischte sich Koman ein, der den Kellner die ganze Zeit über mit hochgezogenen Augenbrauen fixiert hatte:
„Sebastiano, lass den Scheiß, bei dem brauchst du nicht die Schau zu machen”.
„Aach guud”, kam es im breitesten Rheinhessisch, „ei mer waas ja nedd, manche wolle halt so e Gebabbel. Ich bin zwar Idalliener, abber hier uffgewachse. Iss wechem Ambiende.”
„Unn wechem Dringgeld, odder”, forschte Koman im gleichen Idiom nach.
„Dess aach”, gab Sebastiano feixend zu. „Also, was wollener hunn?”
Wir bestellten beide die wurzige Pasta-Sarf-Wie-Sau. (Das Gericht hatte für alle Zeiten seinen Namen bei uns weg.)
Dann begann Koman übergangslos zu erzählen, weshalb er mich eigentlich angerufen hatte.
„Es geht, wie ich ja schon erwähnt habe um einen Ihrer Kollegen hier in Alzey, Peter Simonis. Er …”
„Was hat er denn ausgefressen?”, unterbrach ich ihn mit unverhohlener Neugier.
„Wie … ausgefressen …, das klingt ja fast so, als warten Sie nur darauf. Kennen Sie ihn näher?”
„Was heißt näher, wie gut kann man einen Menschen überhaupt kennen lernen?”
„Es geht jetzt weniger um philosophische Betrachtungen, sondern um greifbare Fakten. Ich glaube, es ist hilfreich, wenn Sie mir kurz erzählen, was Sie über ihn wissen. Wie lebt er, was für ein Mensch ist er, wie läuft seine Kanzlei, welche Stärken und vor allem Schwächen hat er und so weiter.”
Ich schilderte Koman meine bisherigen Erlebnisse mit Simonis, so auch den Abwerbungsversuch bei Frau Gerbes (die übrigens immer noch bei mir arbeitete), seine Versuche, mir Mandanten abspenstig zu machen und auch mich selbst bei jeder sich bietenden Gelegenheit in Misskredit zu bringen, wie mir immer wieder berichtet wurde. Dabei sparte ich auch nicht aus, was ich lediglich von Dritten über ihn erfahren hatte, trennte dies jedoch ausdrücklich von meinen persönlichen Erfahrungen. Trotzdem konnte ich mir ein paar abfällige Bemerkungen über die Person Simonis’ nicht verkneifen. Der Frust, dass ich ihn ungeschoren aus unserem damaligen Zusammentreffen hatte gehen lassen müssen, saß doch zu tief. Hätte ich gewusst, dass Simonis zu diesem Zeitpunkt gerade noch fünf Wochen zu leben hatte, hätte ich mir diese Bissigkeiten wohl verkniffen. Ja, fünf Wochen standen uns zur Verfügung, um …, aber wir wussten ja nichts – gar nichts.
Koman machte sich ein paar Notizen, hörte aber ansonsten aufmerksam und ohne Unterbrechung zu.
Als ich fertig war konnte er sich eine Boshaftigkeit nicht verkneifen: „Na das ist ja mal ein Herzchen. Ist diese Pappnase ein typischer Vertreter Ihres Berufsstandes?”
Ich überlegte kurz, was ich schon so alles über korrupte oder prügelnde Polizisten gelesen hatte, fand es aber dann doch unangemessen, ihn mit dieser Retourkutsche aufzuziehen.
„Nein, garantiert nicht. Die überwiegende Mehrheit besteht aus absolut integren und vertrauenswürdigen Menschen. So, wie Simonis sich aufführt, ist er eine der Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Natürlich gibt es bei uns genauso dubiose Typen – wie in allen anderen Branchen – die ihr Geschäft jenseits jeglicher Ethik, Moral und Rechtsgrundlage auf mehr als fragwürdige Art und Weise betreiben. Die haben dann aber auch die entsprechende Klientel, sodass da selten etwas ans Licht der Öffentlichkeit kommt. Es wird in eingeweihten Kreisen darüber gesprochen, selbst unsere Aufsichtsbehörde kennt Namen und Fakten ohne handeln zu können oder zu wollen, aber … lassen wir das.”
Koman blickte mich prüfend an, bevor er ohne weiteren Kommentar fortfuhr: „Jetzt geht es an Interna, Sie wissen, was das bedeutet!”
„Als Steuerberater weiß ich, was …”, er unterbrach mich mit einer ungeduldigen Handbewegung.
„Ich spreche jetzt zu Darius Schäfer, dem ich als Person vertrauen will, nicht mit dem Steuerbrater, dem ich Kraft Vereidigung vertrauen muss. Und, bitte nicht mehr unterbrechen.
Vor einem halben Jahr etwa ging das los. Da hat Simonis den ersten anonymen Schrieb erhalten und ist auch gleich, mit gestrichen voller Hose, heulend zu einem seiner Spezeln beim LKA – das ist die Abkürzung für Landeskriminalamt – in Mainz gelaufen. (Liebend gerne hätte ich ihn darüber aufgeklärt, dass ich schon wusste, was LKA heißt, aber ich sollte ihn ja nicht unterbrechen.) Ich glaube, es war der Leiter der Abteilung 4, Deliktsorientierter Einsatz, na, ist ja egal. Von dort ging es über den informellen Dienstweg an die Polizeidirektion Worms zu meinem Chef, Polizeidirektor Karsten Wehmut – nomen est omen. Ich war durch Zufall in seinem Büro. Das Erste, was er tat – in meinem Beisein auch noch! – er griff zum Telefon und brabbelte Simonis etwas vor von: Warum er denn nicht direkt zu ihm gekommen sei … man pflege doch schließlich seit Jahren eine gute Freundschaft … und die vielen schönen gemeinsamen Stunden … und er, also mein Chef, wisse doch, was man ihm, also Simonis, einem der honorigsten und wichtigsten Bürger der Stadt, schuldig sei … und er solle doch bitte schnellstens mit dem Corpus delicti vorbeikommen … seinen besten Mann, Hauptkommissar Koman, werde er persönlich auf die Sache ansetzen und ihm für einen schnellen Erfolg geradestehen.
Ich war entgeistert, ich traute meinen Ohren nicht und dachte, ich sei im falschen Film. Ich sah kaiserlich-preußisches Untertanendenken und Kadavergehorsam wieder fröhlich Urständ in unserer Inspektion feiern. Nachdem mein Chef das Telefonat beendet hatte, fand ich meine Sprache wieder.”
„Und wie ging es aus?”, grinste ich ahnungsvoll.
„Ich entging haarscharf einem Disziplinarverfahren in Einheit mit einer Zivilklage wegen Beleidigung und machte zähneknirschend mit Simonis für den nächsten Tag einen Termin aus. Na ja, ich will die Sache abkürzen. Seitdem nervt mich mein Chef, und Simonis ruft immer mal wieder an – stinkfreundlich übrigens – und die Angelegenheit gammelt bei mir auf dem Tisch. Ich arbeite nach Prioritäten, immer das Wichtigste zuerst, Dienst nach Vorschrift sozusagen. Wissen Sie”, jetzt war ihm der Groll anzusehen und auch anzuhören, sodass ich mit einer Handbewegung seine Lautstärke dämpfte, was er dankbar nickend quittierte. „Wenn eine Frau bei uns anruft und aufgeregt und total verängstigt ins Telefon flüstert, dass ihr Ehemann sie wieder einmal verprügelt hätte, ihr das letzte Geld abgenommen und in die Kneipe gegangen sei, mit der Bemerkung: Wenn ich heimkomme, mach’ ich dich kalt, wissen Sie, was wir dann tun? … Nichts tun wir dann. Protokollieren, das ja! Erst wenn’s zu spät ist, dürfen wir uns einschalten. So ist das. Und dann haben wir sogar noch solche chauvinistischen Arschl… in unseren Reihen, die ungestraft die Meinung rausblöken können, die ‚Alte‘ wird’s halt verdient haben. Aber bei einem Simonis, da wird mit anderem Maß gemessen.”
„Ja kann ihr Vorgesetzter Sie denn dann überhaupt anweisen, in solchen Fällen aktiv zu werden?”
„Eigentlich nicht, da gibt es klare Gesetze und Regelungen. Aber wer soll denn der Katze die Schelle umhängen? Ich etwa? Nicht nur, dass Wehmut für meine weitere Beförderung zuständig ist, ich bekomme zum Dank für meine korrekte Einstellung von den lieben Kollegen noch ein Paket mit einem abgehackten Schweinskopf auf den Tisch gestellt.”
„Was soll das denn?”
„Das ist mittelalterliches Mobbing. Das ist die zum Kugeln komische Art, jemandem anonym und feige zu verstehen zu geben, dass er ein Kameradenschwein ist.”
„Geschieht das oft?”
„Nee, es gibt ja kaum welche unter uns, die unabhängig und stark genug sind, die immer wieder angemahnte und eingeforderte Zivilcourage zu beweisen.”
„Aber, wenn es doch herauskommt, dass Ihre Zeit nur aufgrund persönlicher Netzwerke für unsinnige Nachforschungen verschwendet wird und dafür andere, wichtigere Fälle unbearbeitet liegen bleiben? Wenn zum Beispiel die Presse davon Wind bekommt?”
„Dann gibt es kurz einen Sturm im Wasserglas, Schuldzuweisungen und Exkulpationen werden sich die Waage halten und irgendwer nimmt seinen Hut. Tatsächliche Konsequenzen werden keine gezogen, so ist das heute halt.”
„Früher”, sinnierte ich, „haben sich die alten Römer nach einer Niederlage in ihr Schwert gestürzt.”
„Na, und heute”, Koman nippte an seinem, mit Wasser verdünnten Pinot Grigio, den Sebastiano gerade mit meinem „Edelminerealwasser” San Pellegrino serviert hatte, „heute geht man in den gut bezahlten Vorruhestand. Aber, lassen Sie mich Ihnen weiter den Fall Simonis darlegen, sonst vergeht mir der Appetit noch vor dem Essen.”
Er grinste und war von einem auf den anderen Moment wieder der eher nüchterne Kriminaler.
„Also, Simonis zitierte mich dann jedes Mal, wenn er wieder einen Drohbrief erhalten hatte, zu sich. Wie an den Datumsangaben zu sehen war, sofort. Von Mal zu Mal war er aufgeregter und sah sich schon vergiftet, mit einer Kugel im Kopf, erdrosselt und erschlagen, aus einem Hochhausfenster gestürzt und dann von einem Auto überfahren mit dem Gesicht nach unten leblos im Rhein in Richtung Mainz treiben.”
„Ja, haben Sie die Angelegenheit denn nie ernst genommen und wenigstens oberflächlich recherchiert?”
Irgendwie hatte das doch getroffen.
„Ja uns nein”, quälte er heraus, „am Anfang klang das doch irgendwie … na ja … spaßig ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Aber es waren halt … Morddrohungen, ja – aber immer nur Sprüche. Alle paar Wochen fand er ähnliche Episteln. Mal im Briefkasten, mal unter den Scheibenwischer seines Autos geklemmt. Einmal sogar in seiner Manteltasche nach einem Lokalbesuch. Das Originellste war, als einer dieser Briefe, um einen Stein gewickelt, durch das offene Toilettenfenster seines Privathauses flog, als er gerade einem Ruf der Natur folgte.”
Ich konnte das Bild vor mir sehen, plastisch und in Farbe: Simonis, zu Tode erschrocken, hilf- und sprachlos, mit runtergelassener Hose auf cremefarbenem Villeroy & Boch sitzend, den Consultant oder die NWB, die er als Lektüre ausgewählt hatte, in verkrampften, zitternden Händen haltend und ungläubig auf den papierumwickelten Stein vor sich starrend. Welch ein Bild, wie schön! Vor allem, wie schön unfair, lass das Junge!, schalt ich mich. Aber wenn mich die Fantasie einmal gepackt hatte … Mir fiel blitzartig (blitzartig ist gut), der Zornesausbruch eines Bauern ein, als er einen Mann in seinem Weinberg beim Massendiebstahl von Weinblättern überraschte: „Ei, disch soll doch de Blitz beim Scheiße treffe!”
„Ich habe mich dann hin und wieder umgehört, auch einmal Kontakt mit der Steuerberaterkammer aufgenommen, um zu erfahren, ob da irgendetwas an, na sagen wir mal, Merkwürdigkeiten über ihn vorliegt, also, anhängig ist”, hörte ich Koman wie aus dem Off meiner gedanklichen Szene. „Ich hatte dabei schon den Eindruck, dass Simonis einen zweifelhaften Ruf besitzt, der über ein eigentlich akzeptables Maß hinausgeht. Man war sehr freundlich, aber null Information. Aus Datenschutzgründen. Ich wollte zum damaligen Zeitpunkt nicht weiter nachbohren, sonst hätte ich denen ihren Datenschutz um die Ohren geschlagen. Ich nehme ja immer noch an, dass es sich um ein banales Insiderproblem handelt. Kollegenintrigen, Neid. Es kann auch grober Unfug sein, ist ja bisher nichts passiert.”
„Immerhin Morddrohung, wie Sie eben sagten.” Jetzt war ich wieder bei der Sache. „Gibt es denn irgendetwas Konkretes?”
„Da”, sagte er und reichte mehrere zusammengefaltete, lindgrüne Blätter Papier über den Tisch, die er aus seiner Brusttasche gezogen hatte.
„Sie möchten, dass ich das lese?”, fragte ich, „jetzt, hier?”
„Nein, ich möchte, dass Sie daraus Papierflieger basteln, jetzt und hier! Entschuldigung, natürlich sollen Sie es lesen, ich bitte darum.”
„Ach, hören Sie doch auf, sich zu entschuldigen, was frage ich auch so blöde.”
Ich entfaltete die Blätter und überflog deren Inhalte erst einmal. Es waren Kopien, aber, wie mir Koman erklärte, auf dem gleichen grünen Papier, wie die Originale. Jedes Blatt war sowohl mit dem Tagesdatum versehen, an dem Simonis jeweils die Botschaft gefunden hatte, als auch mit dem Datum, an dem er es der Polizei übergeben hatte. Es waren immer nur wenige Zeilen darauf gedruckt; alle in 12-Punkt Arialschrift.
Zwei weitere Dinge waren stets gleich: Die Anrede Euer teuflische Pestilentia und der „Unterzeichnende” Eure segensreiche Medica. Dieses sprachliche Ritual bezog sich offensichtlich auf den ersten Drohbrief. Er lautete:
IHR SEID DIE TEUFLISCHE PESTILENTIA
UND ICH WERDE DIE WELT VON EUCH,
DIESEM ÜBEL, BEFREIEN!
ICH, EURE SEGENSREICHE MEDICA
„Klingt ja recht bizarr”, war mein erster Kommentar.
„Na, lesen Sie erst einmal alle.”
Ich las den zweiten Brief:
EUER TEUFLISCHE PESTILENTIA,
EIN GUTER TEIL DER LEBENSFREUDE BESTEHT AUCH
DARIN, DASS MAN NICHT TOT IST, SAGT MAN.
EURE LEBENSFREUDE WIRD EUCH BALD VERGEHEN.
UND DAFÜR WERDE ICH SORGEN, MIT TÖTLICHER
SICHERHEIT.
EURE SEGENSREICHE MEDICA
„Was für ein Unsinn!”, schüttelte ich den Kopf.
„Weiterlesen!”. Koman war unbarmherzig.
EUER TEUFLISCHE PESTILENTIA,
DAS LEBEN IST SCHÖN,
NUR KOMMT MAN LEIDER NICHT LEBEND RAUS,
SAGT MAN.
UND DAS WERDET IHR SCHNELLER ERLEBEN,
ALS IHR GLAUBT.
EURE SEGENSREICHE MEDICA
Ich musste kurz auflachen: „Das kann man doch nicht ernst nehmen, da hat doch jemand einen mehr als bloß dezenten Dachschaden.”
Koman schwieg und deutete nur auf die restlichen zwei Blätter.
„Ja, doch! Ich lese ja schon.”
EUER TEUFLISCHE PESTILENTIA,
DER TOD IST DAS EINZIGE DEMOKRATISCHE MITTEL,
SAGT MAN.
UND MANCHE MUSS MAN ZUR PRAKTIZIERTEN
DEMOKRATIE ZWINGEN.
EURE SEGENSREICHE MEDICA
Der letzte lautete:
EUER TEUFLISCHE PESTILENTIA,
ICH SAH EUCH KÜRZLICH WIEDER EINMAL ZORNIG,
MIT HOCHROTEM KOPF. ES MACHT MICH SO SCHARF,
WENN IHR WÜTEND SEID. DANN FÜHLE ICH MICH DER
TESTAMENTERÖFFNUNG GLEICH VIEL NÄHER.
UND DA ERWARTE ICH EINEN FETTEN HAPPEN,
SAG’ ICH IMMER.
EURE SEGENSREICHE MEDICA
Ich reichte Koman die Blätter wieder zurück.
„Und?”, fragte er herausfordernd?
„Das Essen kommt!”, meldete ich erleichtert, als ich Sebastiano mit zwei überdimensionalen Pastatellern auf unseren Tisch zusteuern sah.
„Mhh”, kaute Koman seine erste Gabelladung, „nicht schlecht. Aber bitte, was halten Sie davon? Geben Sie mir eine Kostprobe Ihrer analytischen Intelligenz.”
Aufmerksam und mit kleinlicher Präzision drehte ich ein saucengetränktes Nudelnest auf meine Gabel, schob es bedächtig in den Mund, kaute und schaute Koman dabei selbstzufrieden an. „Also. Es geht aus dem Inhalt nicht hervor …”, ich nahm einen Schluck Wasser,” … nicht hervor, ob es sich bei dem Verfasser um eine Sie oder einen Er handelt. Richtig?”
„Aber die Unterschrift oder wie man das nennen soll, heißt doch Eure und Medica ist doch ein Femininum. Deutet das nicht auf einen weiblichen Absender hin?”
„Erst einmal könnte das ein Ablenkungsmanöver sein, damit man genau das denkt. Wesentlicher ist, dass es sich bei Medica um den lateinischen Begriff für Medizin handelt, also die Medizin. Im Lateinischen kennzeichnet die Endsilbe a, auch ohne Artikel, dass Medica grammatikalisch als weiblich einzuordnen ist. Eure Medica heißt also lediglich: Eure Medizin und nicht etwa Eure Medizinerin.”
„Also kennt sich die gesuchte Person mit der lateinischen Sprache aus”, dachte Koman laut nach.
„Muss nicht. Im Italienischen und im Spanischen gibt es ähnliche Regeln. Es kann auch aus irgendeinem Roman angelesen und übernommen worden sein.”
„Und was soll das mit der Anrede Pestilentia?”
„Ich nehme an, dass Simonis damit auf die gleiche Stufe, wie die Pest gestellt werden soll. Eine Geisel der Menschheit, eine Strafe Gottes. Letztlich natürlich eine zerstörende Kraft, die mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, der Medica, ausgerottet werden muss. Ich interpretiere es als eine Art Legitimation, als Rechtfertigung für den Plan seines gewaltsamen Todes.”
„Weshalb meinen Sie, dass der Schreiber …”
„Oder die Schreiberin!”
„… die Schreiberin, die dritte Person benutzt?”
„Vielleicht ein Hinweis drauf, dass zu Simonis irgendeine Beziehung besteht, die eigentlich das vertrauliche Du einschließt, man will dieses aber bewusst oder auch unbewusst vermeiden. Simonis steht ja mit Gott und der Welt auf Duzfuß. Aber wir wollten die Angelegenheit aus meiner Sicht betrachten, richtig?”
Koman setzte zu einer Antwort an, die ich ihm jedoch vorwegnahm.
„Richtig! Also weiter. Der Verfasser oder die Verfasserin besitzt, neben einer gewissen literarischen Neigung oder Fertigkeit, einen Hang zum Spott, zur Ironie. Zudem sind der betreffenden Person nicht nur die Örtlichkeiten des Anwesens von Simonis vertraut, sondern sie muss sich wenigstens ab und zu in seiner näheren Umgebung aufhalten. Ob Simonis das jeweils mitbekommt, ist allerdings fraglich.”
„Wie meinen Sie das?”
„Ganz einfach, er hat einen großen Freundeskreis, was man halt so ‚Freunde‘ nennt. Man trifft sich hier auf einem Fest, einem Empfang, mal dort auf einer Party. Da kann man ihn aus der Anonymität der Menge heraus beobachten und auf das Genaueste studieren, ohne dass er etwas davon mitbekommt. Selbst Fotos lassen sich mit diesen winzigen Digitalkameras bei fast jeder Beleuchtung machen, ohne dass es auffällt. Da kennt der Anonymus das Toilettenfenster, weiß sogar, wann Simonis die Örtlichkeit aufsucht und”, ich blickte ihn überlegend an, „diese Person kennt seine sprachlichen Besonderheiten. Ist Ihnen das aufgefallen?”
„Welche sprachlichen Besonderheiten?”
„Sagt man und sag’ ich immer. Das ist O-Ton Simonis! Wenn er diese Minipamphlete nicht selbst verfasst, um sich wichtig zu machen, äfft ihn jemand nach!”
„Bis jetzt decken sich unsere Gedankengänge, aber das Letzte ist neu. Sind Sie sicher?”
Ich nickte mit vollem Mund und wandte mich konzentriert der akribischen Fertigstellung einer neuen Pastarolle zu.
„Das war alles?”, missverstand Koman die Pause und legte die Gabel zur Seite.
„Gemach, erst wieder ein paar Kalorien zuführen, nur in einem gesunden Körper wohnt schließlich ein gesunder Geist!”, zügelte ich die Ungeduld meines Gegenübers und führte die nächste Portion zum Mund. „Essen Sie doch auch weiter!”
Er schüttelte den Kopf und schob seinen Teller demonstrativ zur Seite, winkte aber dann Sebastiano herbei, um zwei doppelte Espresso zu bestellen. „Sie doch auch?”, vergewisserte er sich – mehr rhetorisch.
„Ja, gerne. Aber, um auf unser Thema zurückzukommen: Ich meine, bisher kann das, was wir den Schreiben entnehmen können, auf die verschiedensten Personenkreise hinweisen, natürlich auch auf Kollegen. Ich kann nur beim besten Willen keinen Hinweis auf irgendeine besondere Gruppe erkennen.”
„Vielleicht sagt uns ein mögliches Motiv etwas mehr?”
„Mein Gott, Herr Koman, da gibt es keinerlei Forderungen. Weder Geld, noch sonst irgendetwas. Mir drängen sich nur Begriffe auf, wie: abgrundtiefer Hass, Bestrafung, Angst und Unsicherheit schüren, Simonis zu Kurzschlussreaktionen verleiten oder ihn von irgendetwas abhalten wollen … Da gibt es zig ähnlich gelagerte Möglichkeiten und bestimmt auch genauso viele potenzielle Verdächtige, aus allen möglichen Kreisen. Das können so genannte Freunde sein, Mitarbeiter, Mandanten, eine oder mehrere verprellte Liebschaften. Menschen halt, die er irgendwann einmal über den Löffel barbiert hat …”
„Ja, und genau diese Verdächtigen benötige ich. Ich brauche Gesichter mit Namen und mögliche Motive. Daher wollte ich Sie fragen, ob Sie mit den Ihnen zur Verfügung stehenden Kontakten und persönlichen Fertigkeiten Nachforschungen anstellen könnten.”
Das Grinsen, mit dem meine persönlichen Fertigkeiten unterstrich, war die fleischgewordene Impertinenz und würde jeden Freispruch wegen Körperverletzung im Affekt rechtfertigen.
Er beeilte sich noch hinzuzufügen: „Aber absolut diskret und natürlich inoffiziell, auf rein privater Basis. Na, was sagen Sie?”
„Wo ist das Tonband?”
„Welches Tonband?”
„Das, welches sich selbsttätig vernichtet und jetzt gleich in Rauch aufgeht. Ach nein, Sie sind ja anstelle des Tonbandes da. Gehen Sie jetzt in Rauch auf?”
Koman starrte mich verständnislos an.
„Sind wir nicht in der Fernsehkultserie Cobra übernehmen Sie? Oder handelt es sich gar um Vorsicht Kamera?” Ich blickte mich suchend um, als ob ich die Kameras aufspüren wollte.
„Bitte, ich wäre Ihnen sehr dankbar.”
„O.k. Bevor ich mich jedoch entscheide, habe ich mehrere Fragen: Erstens, falls doch irgendetwas bei meinen Recherchen auffliegt, stehen Sie dann zu mir oder verleugnen Sie mich?”
„Ich würde mich so verhalten, wie Sie es an meiner Stelle tun würden.” Aus seiner Stimme klang eine ungeheuere Festigkeit und Sicherheit.
„Wie würde ich mich denn ihrer Meinung nach verhalten?”
„Sie würden ohne Rücksicht auf die Folgen zu dem stehen, was sie angeleiert haben!”
Ich nickte zufrieden, das hatte ich hören wollen „Und nun, als Zweites, wüsste ich gerne, wie Sie sich meine ‚Ermittlungen‘ vorstellen.”
„Sprechen Sie Ihre Kollegen auf deren konkreten Erfahrungen mit Simonis an. Lassen Sie sich irgendeine Begründung einfallen, die in Ihren Kreisen derartige Fragen rechtfertigt. Zum Beispiel, dass Sie den Verdacht hegen, dass er Mandanten und Mitarbeiter abwirbt. Zum einen scheint das ja zu seinen Spezialitäten zu gehören, insofern fällt diese Behauptung nicht auf, und außerdem bestehen offensichtlich keine persönlichen Kontakte zu ihm, sodass ihm keiner Ihre Nachfragen stecken wird. Dann könnte doch Ihre Mitarbeiterin, wie hieß Sie noch mal, Frau Gerber? …”
„Gerbes.”
„Dann könnte Frau Gerbes doch einmal ihrer Kollegin, die bei Simonis arbeitet oder gearbeitet hat, auf den Zahn fühlen.”
„Ich kenne einige seiner Mandanten und Bekannten, mit denen ich durch deren Geschäfte Kontakt habe. Carlo Dornhagen, meine Sozietätspartner, war früher hier bei der Betriebsprüfungsstelle und kennt von daher bestimmt den einen oder anderen Mandanten von Simonis; mit ihm könnte ich auch einmal sprechen.”
„Also, sind Sie im Boot?”
„Nicht so schnell”, wiegelte ich ab, „ich habe noch eine Frage, die letzte: Verraten Sie mir, weshalb Sie jetzt auf einmal dieser Angelegenheit eine derartige Priorität beimessen?”
„Ungern, weil es jetzt um Dinge geht, die einer anderen Form der Geheimhaltung unterliegen. Ich kann Ihnen nicht alles erzählen. Einiges nehmen Sie bitte einfach als gegeben, ja?”
Ich signalisierte mit einem leichten Kopfnicken zwar keine Zustimmung, aber doch Verständnis.
„Gestern Nachmittag rief mich ein früherer Kollege an. Wir waren zur Grundausbildung in der gleichen Polizeikaserne und teilten eine Stube.”
Wie Horst und ich, meldete sich die Erinnerung. Es schmerzte immer noch, den besten Freund verloren zu haben.
„Dieter Erb heißt er. Er ist schon seit mehreren Jahren beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden in einer Sondereinheit im Bereich Organisierte Kriminalität tätig. Dieter bat mich, abseits des Dienstweges, um Unterstützung.”
„Geht denn bei euch überhaupt noch etwas seinen normalen Gang?”
„Klar, wenn man Schnecken- oder Schildkrötenrennen aufregend findet. Diese Hilfeersuchen quer durch die Hierarchien haben nichts mit mangelnder Disziplin oder Ungehorsam zu tun. Es ist einfach Notwehr. Das BKA arbeitet ja ansonsten auch mit anderen deutschen Sicherheitsbehörden zusammen. Zum Beispiel in gemeinsamen Ermittlungsgruppen im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Rauschgiften, aber in der Regel nicht direkt mit Inspektionen wie der unseren. Zu den Ermittlungsmethoden der Kollegen gehört auch die, der so genannten heimlichen Informationsbeschaffung, also der Einsatz von verdeckten Ermittlern, geheime Bild- und Tonaufzeichnungen oder Eingriffe in das Post- oder Fernmeldegeheimnis. Per Saldo tun wir damit also nichts Ungesetzliches, wir agieren nur schneller. Jedenfalls, ich schulde Dieter noch einen Gefallen. Bei einem unserer Pflichtseminare, das er als Referent leitete, hatte ich mich etwas abseits der Norm bewegt. Wenn das aufgeflogen wäre, hätte das meine Ablösung und damit zumindest eine Laufbahnsperre nach sich gezogen. Aber das tut hier eigentlich nichts zur Sache. Es ist ja auch schon so lange her.”
Ich blickte ihn fragend an.
„Sie wollen es anscheinend unbedingt wissen. Also, gut, bevor Sie sich in wüsten Spekulationen ergehen …”, seufzte Koman. „Die bewusste Fortbildungsveranstaltung fand vor etwa 20 Jahren irgendwann um die Herbstzeit an der Landespolizeischule Rheinland-Pfalz auf dem Hahn statt. Da wir nicht kaserniert waren, konnten wir uns in der Freizeit ohne Einschränkung bewegen. Im Hunsrück veranstaltete zu dieser Jahreszeit gerade jedes Kaff seine Kirmes, und dabei lernte ich ein Mädchen kennen. Die junge Dame war zwar bildhübsch, aber etwas einfach gestrickt. Ich hatte schon Pullover, die waren intelligenter als sie, jedoch bei ihrem faszinierenden Lächeln und dem hübschen kleinen Beinahe-Nichts, das Sie damals anhatte, schaltete meine Verstand auf Reserve. Um ihr zu imponieren, ließ ich sie mit meiner Dienstpistole in einem Steinbruch auf leere Flaschen schießen. Und diese Dorfschönheit hatte nichts Besseres zu tun, als das zu Hause brühwarm zu erzählen, woraufhin ihr Vater sich telefonisch beschwerte. Dieter Erb sorgte dafür, dass die Sache nicht an die große Glocke gehängt wurde.
Er rief nun gestern an und bat mich, ihm allgemeine Informationen über Simonis zukommen zu lassen. Genau das, worum ich Sie auch gebeten habe.”
„Was will denn das BKA von Simonis?”
Koman wand sich sichtlich: „Das dürfte selbst ich nicht wissen, noch weniger dürfte ich das Wenige, das ich Dieter entlocken konnte, an Sie weitergeben.”
„Wir hatten heute doch schon einmal Wilhelm Busch. Was sagt der zum Thema Vertrauen?: Wer andren gar zu wenig traut, hat Angst an allen Ecken.”
„Das nenne ich Zitatenfälschung!”, erwiderte Koman, „funktioniert aber nicht, denn auch ich habe meinen Buschband zu Hause im Schrank und lese ihn sogar. Ihr Zitat ist nicht komplett, lieber Schäfer! Busch sagt nämlich weiter: Wer gar zu viel auf andre baut, erwacht mit Schrecken. Es trennt sie nur ein leichter Zaun, die beiden Sorgenbrüder; zu wenig und zu viel Vertrauen sind Nachbarskinder. Und jetzt reimt es sich auch”, fügte er mit sichtlichem Stolz hinzu, bevor er in der Sache fortfuhr.
„Also gut! Ich erzähle Ihnen einmal, was die Kollegen vom BKA so alles an Fällen auf dem Tisch haben, ohne damit irgendeinen Bezug zu Simonis herstellen zu wollen. Davon, dass Sie das unter Umständen für sich selbst tun, kann ich Sie ja schließlich nicht abhalten. Über solche überregionalen Straftatermittlungen wird ja auch immer wieder im Fernsehen berichte, in stern TV, im focus Magazin oder Monitor. Die Kollegen ermitteln da zum Beispiel … mhmm, ja, in groß angelegten Diebstählen von Luxusautos, die ohne offensichtliche Gewalteinwirkung gestohlen werden. Homejacking ist das Schlagwort.”
„Homejacking?”
„Ja, das ist ein absoluter Renner seit ein paar Jahren. Gerade letzte Woche wurde in Ludwigshafen nachts bei einem Ehepaar mit drei Kindern eingebrochen. Die Einbrecher gingen so leise und routiniert vor, dass Bewohner nichts mitbekamen. Als sie am nächsten Morgen aufwachten, waren die Diebe mit Schmuck und Bargeld verschwunden. Und auch den Porsche nahmen sie mit, mitsamt Papieren und natürlich den Originalschlüsseln.”
„Aber was hat das mit Simo…, mit unserem Gespräch zu tun?”
Koman reckte sich kurz, bevor er fortfuhr: „Da entdeckt man vielleicht durch Zufall ein paar gestohlene Autos säuberlich in Ersatzteile zerlegt auf einem polnischen ‚Automarkt‘. Und dann könnte man sich vorstellen, dass in Zusammenarbeit mit den polnischen Behörden ermittelt und eine konkrete Spur aufgenommen wird.”
„Und was kommt bei einer solchen Spur zum Beispiel ans Tageslicht?”, ging ich weiter auf das Spiel ein.
„Man überprüft dann bei Serienstraftaten unter anderem, ob und was die Opfer an Gemeinsamkeiten aufweisen. Gleiche Altersgruppe, Geschlecht, Nationalität, Zugehörigkeit zu Religionen oder Vereinen. Es gab aber auch schon Fälle, da hatten die Opfer die gleichen Lieferanten, den gleichen Hausarzt oder ließen sich vom gleichen Anwaltsbüro beraten. Dann recherchiert man natürlich, zuerst verdeckt, weiter bei dem Hausarzt oder dem Rechtsanwalt. Könnte ja auch einmal ein Steuerberater sein, wie Sie.”
„Was hätte denn so ein Hauarzt, Rechtsanwalt oder meinetwegen auch Steuerberater mit solchen Verbrechen zu tun?”
„Meistens handelt es sich bei den Tätern um Mitglieder von mehr oder weniger gut organisierten Banden, mit klaren Strukturen und Aufgabenteilungen. Wie in einem normalen Wirtschaftsunternehmen, oft sogar noch bedeutend effizienter. Die wollen vor einem Coup die Ertragsaussichten und das Risiko checken. Eine Nutzen-/Aufwandsanalyse sozusagen. Und ein Hausarzt, ein Rechtsanwalt oder auch ein Steuerberater weiß nun einmal sehr viel von und über seine Kundschaft. Wann diese sich im Urlaub befindet, ob sie mit oder ohne Auto verreist, wie es um den Schutz des Hauses – durch eine Alarmanlage oder einen Hund – bestellt ist, wie risikobereit ein potenzielles Opfer ist – ein Familienvater, dessen Kinder im Hause sind, wird zum Beispiel leichter einzuschüchtern sein als eine Einzelperson. Und dann sind ihnen oft auch die Vermögensverhältnisse bekannt. Bei einem Steuerberater trifft das natürlich eher zu, als bei dem Hausarzt. Aber, das sind ja nur Hypothesen, gelt?”
„Sicher, sicher. Das heißt aber doch, dass wir es nun mit einem weiteren Kreis an möglichen Drohbriefschreibern zu tun haben.”
„Genau. Und dadurch erscheint die Angelegenheit in einem anderen Licht. Jetzt muss ich tatsächlich davon ausgehen, dass Simonis ernsthaft bedroht ist. Andererseits kann ich ihn wohl kaum dazu befragen, geschweige denn Schutzmaßnahmen mit ihm absprechen, weil ich sonst die verdeckte Ermittlung gefährden würde. Alles, was wir tun, muss absolut unauffällig und mit äußerster Vorsicht geschehen.”
Ich lehnte mich zurück, starrte an die Decke und gab mich den boshaften Einflüsterungen eines Teufelchens namens „Rachegelüste” hin. Das wäre ja ein Ding: Simonis, der mich so erniedrigt hatte und, was ja viele wichtiger war, der eine Schande für unseren Berufsstand darstellte, als Drahtzieher einer Homejacking-Bande. Ich sah schon die Schlagzeilen vor mir: „Altruistischer Steuerberater überführt kriminellen Kollegen.” Ob das für unseren Berufsstand wirklich förderlich war? Ach was, dachte ich trotzig, meine Kollegen und ich werden bei der Öffentlichkeitsarbeit hinsichtlich dessen, was wir wirklich für unsere Mandanten tun und bewirken können, so erbärmlich unprofessionell und inkonsequent von unseren Standesorganisationen unterstützt, dass jede Schlagzeile nach dem Motto: Only bad news are good news, nur hilfreich sein kann.
Ich weiß nicht, welcher Teufel mich in diesem Moment tatsächlich ritt, jedenfalls habe ich meine Entscheidung später mehrmals bereut. Aber das Kind im Manne war geweckt. Unsere Praxis lief dank Carlo Dornhagen, unserer Mitarbeiter und einer fortschrittlichen, systematisch funktionierenden Kanzleiorganisation für einige Wochen auch ohne mich. Was hatte ich also zu verlieren? An mein Leben dachte ich dabei allerdings nicht, obwohl ich es seit meinem letzten Ausflug in die praktische Welt der Kriminalistik hätte besser wissen müssen.
„Koman”, erklärte ich daher ebenso pathetisch wie naiv, „ich bin dabei!”
„Ich wusste es, besser gesagt, ich hatte es inständig gehofft. Wie gedenken Sie nun vorzugehen?”
„Wenn ich es recht verstehe, geht es um zwei Ziele: Erstens soll der Urheber oder die Urheberin der Drohbriefe ermittelt und damit ein möglicherweise geplanter Mord verhindert werden. Und zweitens soll, bei großzügiger und freier Auslegung Ihrer BKA-Story, eine etwaige Verbindung zu einer Tätergruppe aufgedeckt werden, die sich auf Homejacking spezialisiert hat.”
„Die gleichen Fragen, um zu zwei unterschiedlichen Zielen zu gelangen, korrekt. Man könnte auch sagen, zwei Fliegen mit einer Klappe. Kümmern Sie sich bitte ausschließlich um das Kanzleiumfeld, Mitarbeiter, Mandanten, Kollegen. Somit nur um den Personenkreis, mit dem er aufgrund seiner Tätigkeit zu tun hat und mit dem Sie auch unter normalen, typischen Arbeitsbedingungen Kontakt aufnehmen könnten. Am ergiebigsten wäre es, wenn Sie dabei auf Personen treffen, die auf Simonis nicht gut zu sprechen sind. Aber”, Koman beugte sich nach vorn und fixierte mich mit leicht zusammengekniffenen Augen, „lassen Sie um Gottes Willen die Finger von allen anderen, die sie nicht einordnen können. Die fallen ausschließlich in mein Ressort, das lässt sich ja auch gut trennen.”
In diesem Moment glaubte ich das auch noch, aber schon wenige Wochen später sollten sich diese Gruppen überschneiden, ohne, dass wir es zu diesem Zeitpunkt ahnen konnten.
„Wir treffen uns sporadisch in meinem Büro und tauschen aus, was wir erfahren haben. Sie zu einhundert Prozent und ich, das, was ich vertreten kann und was für Sie wichtig ist. Informieren Sie mich umgehend, wenn Ihnen irgendetwas suspekt vorkommt! Ganz gleich um welche Uhrzeit, bei Tag und Nacht.” Dabei reichte er mir seine Visitenkarte mit der Büro- und der Handynummer über dem Tisch. „Machen Sie außer den besprochenen Recherchen nichts auf eigene Faust!”
Um es nicht zu vergessen, speicherte ich seine Telefonnummern sofort in meinem Handy ab und setzte sie außerdem für die Kurzwahl auf eine Zahlentaste.
Irgendwie kam etwas wie eine Verschwörerstimmung auf, die wir zum Abschluss mit einem Ramazotti würdigten. Dieser denkwürdige Moment, der dazu angetan schien, in die Analen der deutschen Kriminalgeschichte einzugehen, rechtfertigte die Ausnahme von der Regel und den minimalen Alkoholabusus vor 18.00 Uhr.
Noch am Nachmittag des gleichen Tages informierte ich Carlo Dornhagen, soweit ich es für richtig hielt, über meine Unternehmung. Der kleine, etwas dicklich geratene, Mann, mit dem mich inzwischen ein wunderbares Vertrauensverhältnis verband, saß aufrecht und in gespannter Haltung in seinem Stuhl und hörte meinen Schilderungen stillschweigend zu.
Still? Schweigend? Carlo besitzt die besondere Begabung alle Register der Körpersprache so einzusetzen, dass er in seinen Reaktionen und Meinungen einfach nicht missverstanden werden kann. Da wird das „Stillschweigen” zur Qual!
Wortlos und damit ohne mir eine Chance der Korrektur oder Verteidigung zu geben, bedeutete er mir mit Gestik, Mimik und Körperhaltung: Klar, mach du nur. Wenn es dem Esel zu wohl wird … Mensch Darius, du bist einer aus dem letzten Jahrhundert, such dir lieber eine Frau, wenn du nach Aufregung suchst, das macht bestimmt mehr Spaß … Hält uns Eichel nicht genug in Trab? … Aber bitte: Fall du nur wieder auf die Schnauze. Hast eben nichts gelernt beim letzten Mal. … Aber, du lässt dich eh nicht zurückhalten!
Was er wortwörtlich von sich gab, reduzierte sich auf die Frage: „Wie kann ich dir dabei helfen?”
Carlo erhielt von mir eine Liste mit den Besprechungsterminen, die keinen Aufschub duldeten und die er für mich wahrnehmen sollte. Die dazu notwendigen Unterlagen würde ich ihm bis Montag vorbereiten.
Außerdem erbat ich mir von ihm eine Aufstellung von Personen, von denen er noch aus seiner Tätigkeit als Betriebsprüfer wusste, dass sie von Simonis vertreten wurden.
„Nur die Namen und den Wohnort, keine weiteren Daten”, erleichterte ich ihm diesen „Verstoß”.
„Selbst das ist eine Gratwanderung. Du weißt, dass ich über das, was mir aufgrund meiner Tätigkeit im Finanzamt zugänglich war, auch nach meinem Ausscheiden zum Stillschweigen verpflichtet bin. Aber gut, in diesem Fall, und mit dieser Einschränkung, kann ich das tun. Du missbrauchst ja diese Datenkenntnis nicht.”
„Vielleicht benötige ich deine Informationen auch gar nicht. Ich werde ohnehin erst einmal bei einem Kollegen anfangen”, beruhigte ich ihn.