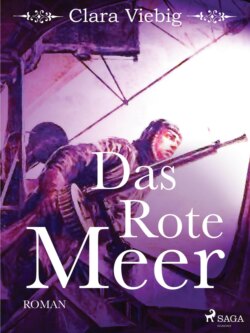Читать книгу Das rote Meer - Clara Viebig - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
ОглавлениеAnnemarie Bertholdi, geborene von Lossberg, stand in ihrem Ankleidezimmer. Sie liess sich ein neues Kleid anprobieren. Man sah es, sie hatte geweint. Am Morgen war ein Brief von Rudolf gekommen. Es musste schrecklich sein am Winterberg. Wenn er so kurz schrieb, so kurz und ernst, dann stand ihm immer Schweres bevor.
Die junge Frau hatte sich die Kriegskarte geholt. Anfangs hatte sie da immer kleine Fähnchen gesteckt — das Vorrücken ging so rasch, man musste die fast jeden Tag ein bisschen weiter herausstecken — nun aber blieben sie schon eine lange Weile immer auf derselben Linie. Die Franzosen waren hartnäckig. Ach, ihr armer Rudolf! Annemarie waren die Tränen gekommen. Nun aber blickte ihr Auge voller Interesse auf die Hände des Fräuleins, das vor ihr am Boden kniete und von unten herauf den Saum des duftigen Kleides anblinzelte.
„Wird es mich auch nicht zu stark machen, wenn der Rock noch kürzer ist? Ich möchte ihn ja gern so kurz haben, es ist viel moderner, aber —!“ Die hübsche Frau blickte bedenklich. Seit des Knaben Geburt drohte sie etwas sehr üppig zu werden. Dick, das war ihr ein angstvoller Gedanke.
„Gnädige Frau haben eine prachtvolle Figur,“ versicherte das Fräulein, nahm Nadel um Nadel von dem Kissen, das, gestachelt wie ein Igel, neben ihr am Boden lag, und steckte den Saum noch kürzer um. „Und gnädige Frau haben ein hübsches Füsschen — und dann das elegante Schuhwerk!“ Bewunderung und Neid waren in dem Blick, mit dem die blasse Person das tadellose Schuhwerk der Dame musterte. Sie erhob sich und stand mit verriesterten Schuhen auf schiefgelaufenen Absätzen. „Es ist schrecklich; wenn man auch einen Bezugsschein hat, Schuhe kriegt man darum doch nicht. Und man braucht doch welche. Man zerreisst so viel bei dem ewigen Rumstehen und Laufen.“
Die junge Frau lächelte zerstreut, sie musterte sich im Spiegel; dann vertiefte sie sich mit der Schneiderin in die Vorzüge und Nachteile des kurzen Rocks. —
Annemarie hatte Freude an schönen Kleidern, gerade weil sie als arme Offizierstochter früher immer hatte plundrig gehen müssen. Ihre Fähnchen durften nicht viel kosten. Die Brüder hatten es besser gehabt, die kamen in des Königs Rock, der sah immer nach was aus. Es war jetzt für die junge Frau Bertholdi das grösste Vergnügen, von Laden zu Laden zu ziehen und Sammete und Seiden zu durchmustern. Erstaunlich, was für schöne Stoffe noch vorhanden waren, freilich kosteten sie ein Vermögen. Wollstoffe waren kaum noch aufzutreiben; das war weiter nicht schlimm, dann trug man eben Seide.
Ein Glück für Annemarie, dass heute diese Zerstreuung gekommen war. Der ernste kurze Brief ihres Mannes hatte sie schon verstimmt, ein Brief ihrer Mutter hatte ein übriges getan. Deren Briefe waren immer wenig erfreulich.
Frau Oberst von Lossberg hatte nicht die Absicht, der Tochter zu klagen — sie klagte auch nie über die drückend engen Verhältnisse, in denen sie nach dem Tode ihres Mannes, des Obersten, in dem kleinen Städtchen an der Lahn lebte, — aber sie konnte die Herzensangst nicht verbergen, unter der sie jetzt ständig litt. Nicht den beiden Jüngsten, die bei Annemaries Hochzeit noch Kadetten gewesen, jetzt auch schon an der Front waren, galt diese Angst. Es war ihr selbstverständlich, dass die beiden Jungen bei der langen Dauer des Krieges auch noch drankamen. Frau von Lossbergs Klagen galten dem ältesten Sohne, dem ‚schönen‘ Lossberg, wie er im Regiment hiess. Von seinem Krankenlager in Sofia hatte sich der Leutnant ein Anhängsel mitgebracht, das die Mutter in Kummer und Empörung versetzte: eine Abenteurerin, eine ganz unmögliche Person! Die Krankenschwester, die den Typhuskranken dort gepflegt hatte, war ihm gefolgt; zuerst in die Heimat, wo er sie in seiner Nähe unterbrachte, dann an die flandrische Front. Sie pflegte da in einem Feldlazarett, sie sollte sogar eine ausgezeichnete Pflegerin sein, für Frau von Lossberg blieb sie die Abenteurerin. Dass ein Offizier, ein Lossberg, sich mit solchem Weib kompromittierte! Dann noch lieber Schulden. Diese Person war aus einer Sphäre, die sie an und für sich schon unmöglich machte. Eine Rabbinerstochter aus dem Posenschen. Jochen würde doch um Gottes willen nicht auf den Gedanken kommen, sie zu heiraten?!
Die beiden jüngeren Brüder waren auch empört. Zufällig waren sie vor einiger Zeit in die Nähe des Älteren gekommen; sie fragten sich durch zu ihm, glücklich, ihn zu überraschen. Sie fanden ihn in einem halbzerschossenen Hause, das als Kasino eingerichtet war, in einem Kreis von Offizieren und mit — jener Person. Die sass in ihrer Tracht — schwarzes Kopftuch, weisser Streifen mit rot eingestickten Kreuzen, blauweisses Leinenkleid, weisse, im Rücken gekreuzte Schürze — auf einem Tisch und baumelte mit den Beinen. Die Herren standen lachend um sie herum, sie gab gerade ein paar Schwänke aus ihrem Leben zum besten.
Im heutigen Brief flehte Frau von Lossberg die Tochter an: vielleicht war es ihr, der Schwester, die der ältere Bruder immer sehr geliebt hatte, möglich, ihn von dieser Person abzubringen? ‚Wenn der Vater das wüsste! Er bringt Schimpf und Schande über unsere Familie.‘
Zu dumm von Jochen, der Mutter die ganze Geschichte auf die Nase zu binden! Die junge Frau wurde rot vor Ärger. Erzählt hatte er’s geradeheraus, gelacht, als er das Entsetzen der Mutter sah: was war denn da Schlimmes, man hatte sich lieb, jetzt war Krieg, das Weitere würde sich schon finden. Schneid hatte der Jochen, das musste man ihm lassen, und dass er ein bisschen leichtsinnig war — lieber Gott! Annemarie legte den hübschen Kopf auf die Seite: war das denn so schlimm? Sie sah mit blinzelnden Augen hinaus in den heissen Garten und träumte. Dann gähnte sie. Es war hart, sehr hart, so allein zu sein. Herr Gott, wie langweilig!
Es gab für Annemarie nichts im Hause zu tun. Noch immer waren die gleichen Dienstboten da. Selbst das Hausmädchen, die Emilie, hatte die Schwiegermutter behalten. Emiliens Bräutigam war im Krieg, ihr Kind hatte sie in Pflege gegeben, erst wenn Friede war, würde sie heiraten. Den kleinen Rudi versorgte die Wärterin. Die junge Frau gähnte wieder: ach, wie langweilig! Sie hätte lieber ihr Hauswesen für sich allein gehabt, aber davon wollte Rudolf nichts wissen. Gut aufgehoben war sie ja hier. Sie hatte sich nur längst an all das, was sie als Mädchen, aus bescheidenen Verhältnissen kommend, bejubelt hatte, gewöhnt. Ihre Freundin Lili hatte es viel angenehmer, die war gänzlich ihr eigener Herr. Die war ja auch schon Witwe, hatte mit ihren fünfundzwanzig Jahren bereits etwas hinter sich. Lili hatte ein paar Jahre in Italien gelebt, als Frau des italienischen Leutnants Rossi, und war dann, seit der im ersten Kriegsjahr bei den Kämpfen in Tirol gefallen war, hierher zurückgekommen. Ihre Mutter, die Generalin von Voigt, redete ihr in nichts hinein.
Annemarie runzelte die Stirn: redete man denn ihr in etwas hinein? Selbst wenn sie sich auf ihren Besorgungswegen in der Stadt verspätet hatte und nicht zur Zeit zum Essen da war, verlor der Schwiegervater kein Wort, er, der selber von einer unheimlichen Pünktlichkeit war, besonders bei den Mahlzeiten. Auch die Schwiegermutter sagte nichts weiter, als: „Aber nun iss auch, mein Kind. Wir möchten auch gern bald aufstehen.“ Nun, mochten sie doch aufstehen! Es schmeckte Annemarie genau so vorzüglich, wenn sie allein am Tische sass.
Es ärgerte Annemarie, dass die Schwiegermutter so wenig Interesse für ihre Besorgungen, für schöne Kleider mehr zeigte. Früher war die ganz anders gewesen, eine so elegante Frau! Auch bei Lili Rossi fand Annemarie nicht den gehofften Widerhall. Trotzdem hatten sich die beiden jungen Frauen befreundet. Das war so gegeben, sie würden ja über kurz oder lang Schwägerinnen werden.
Lili von Voigt trug keine Trauerkleider mehr um ihren Mann, den Leutnant Rossi. Wenn sie in ihrem lichten Sommerkleid durch die Gartenstrassen ging, leichten Fusses, ohne Hut, Gesicht und Nacken unbekümmert der deutschen Sonne preisgebend, erkannte man in ihr die Frau nicht mehr, die im Frühjahr fünfzehn heimgekehrt war wie eine Flüchtende. Die dann bald in Trauerkleidern schlich. Jetzt ging sie nicht mehr gesenkten Kopfes, auf stolzem Nacken trug sie ihn aufrecht. Lili von Voigt hatte ganz vergessen, dass sie durch ihre Heirat eigentlich Italienerin war; nur dass sie sich als Ausländerin wöchentlich auf dem Amt melden musste, erinnerte sie schmerzlich daran. Doch auch das wurde ihr bald erlassen. Sie fühlte sich wieder ganz als Deutsche; eine ungeheuere Genugtuung erfüllte sie über Deutschlands Siege und — über Heinz Bertholdi. „Ich bin stolz auf ihn,“ sagte sie ihrer Mutter, „so stolz!“ —
Frau von Voigt hatte nicht an das Herzensgeheimnis der Tochter gerührt, ganz von selber sprach Lili; sie war zu erfüllt davon, ihre Lippen konnten es nicht länger verschliessen. In einer tiefen Bewegung schloss die Mutter sie in die Arme: Gott sei Dank, Lili hatte sich ganz zurückgefunden. Und wenn sie nach dem Kriege dieses Mannes Frau wurde, eines deutschen Mannes, dann konnten die Eltern beruhigt über das Schicksal des einzigen Kindes sein.
Hermine von Voigt fühlte sich jetzt oft seltsam müde. Drei Jahre des Krieges zählen nicht nur doppelt, nein, drei- und vierfach. Besonders für den, der sie erlebte, wie sie sie erlebte. Sie hatte gebangt und gejubelt, angstvoll gezweifelt und stolz wieder geglaubt; in alle Tiefen war sie mit hinabgestürzt, auf alle Höhen mit hinaufgeklommen: ja, sie glaubte an Deutschlands Unsterblichkeit.
Die General-Offensive der Feinde war ermattet; Spätsommer war’s, ein paar Monate noch, und Eis und Schnee legte den Kämpfen Fesseln an. Wer weiss, ob dann das Friedensangebot, das im vorigen Winter schnöde abgewiesen worden war, nicht gern angenommen wurde? Die Generalin teilte die Ansicht ängstlicher Gemüter, dass Amerika der Entente doch noch den Sieg gewinnen würde, nicht. Amerika hatte freilich Hilfsmittel zur Verfügung, wie sie kein anderes Land besass, aber ein Brief ihres Mannes hatte sie beruhigt. ‚Ein Land, das kein stehendes Heer hat wie wir seit Menschengedenken, ist für uns nicht zu fürchten‘, schrieb der General. ‚Ein Heer lässt sich nicht in der Geschwindigkeit heranbilden. Wie will Amerika überdies Truppen in Masse herüberschaffen? Das verhindern unsere Tauchboote‘ — — — —
Heute ging Hermine von Voigt mit einem Lächeln nach der Villa Bertholdi. Sie wollte gratulieren. Gestern abend hatte sie im Heeresbericht gelesen: ‚Leutnant Bertholdi besiegte seinen fünfzehnten Gegner im Luftkampf. Er wurde ausgezeichnet mit dem Pour le mérite.‘
Glückliche Mutter! Wie musste der zumute sein, die einen Helden geboren hatte?! Wieder fühlte Hermine von Voigt den gleichen Taumel, jenes trunkene Glück, das sie bei dem ersten Siege wie auf goldener Wolke erhoben hatte. Lange hatte sie nicht mehr so empfunden. Man war doch stumpf geworden durch die Dauer des Krieges, man weinte nicht mehr so bitterlich, man freute sich nicht mehr so stürmisch, man hasste nicht mehr so glühend. Es war, als ob nicht nur der Seele, nein, auch dem Körper die Kraft dazu genommen wäre. Heute aber war wieder etwas von der alten begeisterten Freudigkeit in der Frau. Oh, wenn sie doch auch solch einen Sohn hätte! Die Hände würde sie ihm unterbreiten, ihrem Helden, ihn mehr lieben, als je ein Sohn auf Erden geliebt wurde. Gott sei Dank, dass Deutschland solche Söhne hatte! Sie waren Gnadengeschenke, helle Sterne in der Finsternis. Waren der Feinde noch so viele, waren sie auch noch so tapfer, deutsches Blut, deutscher Heldenmut stürmte voran. Das Siegesreis in der erhobenen Hand, voran, immer voran. Und bräche am Ziel der Held zusammen, dann nicht klagen. Gibt es denn etwas Höheres? Stolze, glückliche Mutter!
Hermine von Voigt fühlte es wie einen Trost: auch ihr wurde teil an solchem Sohn, wenn sie ihn gleich nicht selber geboren hatte, Heinz Bertholdi wurde Lilis Mann. Bertholdis waren ebenso glücklich über diese Aussicht, wie sie es war. Von einem Verlöbnis war noch nicht die Rede, die beiden hatten noch nichts Bindendes gesprochen, aber es war ein stillschweigendes Übereinkommen. Lili besuchte täglich das Bertholdische Haus, Frau Bertholdi zeigte es deutlich, dass ihr keine Schwiegertochter willkommener sein könnte, und Lili hing mit Zärtlichkeit an der Mutter des geliebten Mannes. Mitten aus dem wilden Meer des Krieges hob sich wie ein seliges Eiland dieses werdende Glück.
Hermine von Voigt sah sich mit leuchtenden Augen um: die Sonne noch so sommerwarm, glanzvoll strahlend. Es war heiss; sogar dürr und heiss, man hatte darunter zu leiden. Nicht nur Mensch und Vieh, auch die Felder. Wie eine Walstatt, zerfetzt und zerstochen von den Strahlenschwertern der roten Sonne, standen die Äcker. Die Blätter der Futterrüben welk, die Kohlköpfe klein und von Ungeziefer grau überlaufen; nichts Saftiges, nichts Frisches. Das Kartoffelkraut braun, dürr vor der Zeit, man konnte es zwischen den Fingern zu Pulver zerreiben. Um Gottes willen, man würde doch nicht wieder einen ganzen langen Winter Kohlrüben essen müssen anstatt der Kartoffeln?! Was den Kartoffeln der vorige Sommer an Nässe zuviel getan, das schadete ihnen jetzt die Trockenheit. Niedrig hatte das Korn gestanden und dünn im Stroh; nirgends eine schwere Ähre. Notreif musste man es einfahren, am liebsten gleich draussen ausdreschen, man hatte es ja so nötig. Zudem, wer Pferde sparen konnte, der sparte sie, schier brachen die alten Mähren zusammen. Was tauglich war, das war an der Front, Pferde wie Menschen.
Aber dem Obst tat dieser Sommer gut. Frau von Voigt sah mit erfreutem Blick die beladenen Bäume rechts und links in den Gärten. Die brachen fast unter ihrer Last. Ein reicher Obstsegen überall. Freilich, ob man viel davon spüren würde? Marmelade, Marmelade, alles zu Marmelade. Die war mit Sacharin gesüsst, das verdarb den Geschmack; Zucker gab’s nicht. Und ob man noch Marmelade reichlich bekommen würde? Immer hiess es: es ist alles da, und doch bekam der einzelne nichts. Wo blieben denn all die Lebensmittel? Fürs Heer, fürs Heer! Für das Heer, für die draussen wollte jeder gern entbehren — aber bekam das Heer denn alles?!
Bei ihrem Amt im Lebensmittelverkauf der Gemeinde hörte Frau von Voigt die Frauen sprechen. Sie drängten sich vor den Verkaufstischen, standen in langen Reihen, und die hinteren glaubten sich unbelauscht. Aber die Stimmen der anfänglich nur Flüsternden wurden oft erregt laut, man konnte die Ohren nicht verschliessen, zu hören.
„Mein Mann schreibt: ‚Seit drei Wochen kaum warmes Essen, oft bloss ’n Salzhering. Und keine Kartoffeln dazu.‘ Keene Kartoffeln, det ist’t Schlimmste.“
„Ja, aber die Offiziere, die schlagen sich ’n Bauch voll. Die wer’n sich bedanken, so zu hungern. Abends Bratkartoffeln, det der schöne Jeruch bis in’n vordersten Iraben zieht.“
„Un da soll einer noch Lust haben, sich dotschiessen zu lassen?“ Eine Blasse mit hungrigen Augen krächzte und hustete. „Ich habe meinen Mann aber ooch jeschrieben: wenn se dir nich jeben, denn nimm dir; un wenn de det nich kannst, denn schmeiss hin. Die Franzosen sind ooch Menschen, un die ha’m noch wat, lauf bei die rüber. Bei die Engländer un Amerikaner jiebt’s erst recht wat Fettes.“
„Aber denn sind se doch gefangen,“ sagte zittrig ein altes Mütterchen. Ihr zahnloser Mund war blass, sie war schwach von dem langen Stehen auf geschwollenen Füssen, eingekeilt in der sich drängenden Menge der Käuferinnen. „Mein Sohn is in Gefangenschaft, das is mir fast schlimmer als tot.“
„Quatsch!“ Eine grosse vierschrötige Person stiess sie in die Seite. „Ha’m Se sich bloss nich so. Uns machen Se doch nischt vor. Wenn man satt hat, so satt, wie wir seit Jahr und Dag nich mehr werden, denn kann et einem janz ejal sein, ob französch oder englisch oder amerikansch. Meinetwejen russisch, oder jelb wie de Affen, die Japanesen.“
„Nein, nein,“ die Alte war hartnäckig, „ich will deutsch bleiben und deutsch sterben.“
Die Vierschrötige lachte auf. „Deutsch sterben?!“ Sie mass die jämmerlich Zusammengeschrumpfte mit spöttischem und zugleich mitleidigem Blick. „Na, det kann Ihnen leicht passieren.“
„Will ich auch,“ murmelte die Greisin. „Was soll ich noch hier? Mein Junge gefangen, wer weiss, ob er je wiederkommt — meine Tochter hat die Schwindsucht, ‚unterernährt,‘ sagt der Doktor. ‚Butter, Eier, Milch —‘ lieber Gott, wo soll man die herkriegen?!“
Ein Murmeln ging um. „Ja, ’n Attest kann man schon kriegen vom Doktor.“
„Kost’ aber jedesmal vier Mark.“
„Un ob man die Milch denn immer kriegt, oder ’n Iries oder die Haferflocken oder ’t weisse Brot, det is noch sehr die Frage.“
„Alles fürs Heer!“ Ein heimliches, aber nicht zu unterdrückendes Gelächter erhob sich.
Oh, es war nicht erfreulich, diese Unterhaltungen mit anzuhören! Frau von Voigts Stirn umdüsterte sich; manches Mal hatte sie sehr darunter gelitten. Aber nein, sich nicht niederziehen lassen von den Erbärmlichkeiten des Alltags! Was bedeutet ein einzelnes Menschendasein gegenüber dem Leben des Vaterlandes? Sie war sich darüber klar, es war schwer, sich nicht umwerfen zu lassen von einer plötzlichen Schwäche. Man durfte eben nicht vergessen, dass nichts erreicht wird ohne Opfer. Jetzt war für alle die Zeit der Opfer. Und es wurden Opfer gebracht, so ungeheure, dass es einem schwindelte: Männer, Söhne, das ganze Familienglück, die eigene Gesundheit, Wohlleben, Behagen, alle Bequemlichkeit.
Die Frau holte Luft, als sei ihr der Atem knapp geworden. Gott sei Dank, dass noch Stunden des Stolzes, der Genugtuung kamen, eine Stunde wie die heutige, in der sie ging, um sich mit der Mutter des jungen Helden zu freuen!
Die hohe Gestalt der Generalin schritt aufrecht dahin. Die Leute grüssten sie; es kannte sie hier fast ein jeder. Es gab welche, die sich über sie ärgerten: ‚militärfromm, königstreu‘ — aber die Achtung versagte ihr keiner. Sie wussten: die hatte trotz allem Verständnis fürs Volk und ein Herz für die Armen. Als die Dombrowski, die hübsche, lebenslustige Frau, damals bei dem Unglück auf dem Bahngeleise, unter die Räder des Fernzuges kam, der in die Arbeiterinnenkolonne hineinfuhr, nahm sich die Generalin der zurückgebliebenen Kinder an. Der Vater war im Feld und kümmerte sich nicht um die, liess gar nichts mehr von sich hören, man wusste nicht, war er tot oder gefangen. Die Kinder sollten in das Waisenhaus, aber das kleine Mädchen, das noch um die Mutter jammerte, klammerte sich an den Bruder und schrie sich heiser. Da hatte sich denn die Generalin erbarmt und die Kinder zu einer Frau Müller in Pflege getan und bezahlte für sie. Dombrowski konnte sich bedanken, wenn er noch mal wiederkommen sollte, der Junge war längst nicht mehr so ein Strolch, das Mädchen wurde immer niedlicher.
Es wäre Hermine von Voigts grösster Wunsch gewesen, Verwundete zu pflegen; aber sie fühlte, dazu war sie nicht jung genug mehr; sie hatte nicht die Kräfte, Tag für Tag in aller Frühe ins Lazarett zu gehen und dort auf den Füssen zu bleiben bis zum Abend. Es war ein schmerzliches Bescheiden. Ach, wer das noch leisten konnte, der war am glücklichsten daran. Blut und Wunden wird man gewöhnt, und haben sich die Pforten des Lazaretts einmal geschlossen, so ist man in einer Welt für sich. Mit dem Stundenschlag geht die Pflichterfüllung, eigene Gedanken sind ausgeschaltet, man hat zu ihnen nicht Zeit. In die hohen Krankensäle mit den dichtgereihten Betten tritt das nicht ein, was das Leben vor den Pforten so schwer macht — alle Angst vor der Zukunft bleibt draussen. Hier ängstigt man sich nur um die nächste Stunde: glückt die Operation? Wie wird der Kranke erwachen? Man fragt nicht: wie wird Deutschlands Schicksal sein? Wird das deutsche Volk auch durchhalten? Hier fragt man nur: wird dieses junge Blut genesen?
Hermine von Voigt konnte es nicht verstehen, dass Lili und Annemarie sich solche Freuden entgehen liessen; die waren doch jung und kräftig genug. Sie hatte es von der Tochter anders erwartet, die aber lächelte träumerisch:
„Ich kann nicht, Mutter. Wenn ich unglücklich wäre, dann ja, dann würde ich gern pflegen. Aber jetzt — ich bin zu glücklich!“ Sie sah rührend schön aus mit dem verklärten Lächeln. „Vielleicht, dass ich auch all meine Kräfte sparen muss, dass ich die alle noch brauche.“
Unter den grossen Linden im Vordergarten stolperte der kleine Rudi Bertholdi an der Hand der Wärterin herum; im Zimmer ging es besser, da lief er schon flink von Stuhl zu Stuhl, hier bohrten sich seine kleinen Fussspitzen ungeschickt in den hohen Kies. Hinter dem hübschen Kind mit den braunen Ringellöckchen ging lachend die hübsche Mutter. Sie hatte sich in den Arm von Lili Rossi gehängt.
Es war wie lauter Heiterkeit: das freundliche Haus, der gepflegte Garten, das Kind im weissen Röckchen, die beiden jungen Frauen in lichten Kleidern. Leute, die am Gatter vorübergingen, staunten: die dadrin merkten noch nichts vom Krieg. Das Kind hatte ja Bäckchen wie ein Apfel; wenn man dagegen die anderen Kinder ansah: alle blass, welk. Wovon sollten die auch dicke Backen haben? Nur die ganz kleinen bekamen noch ihre Milch, für die anderen gab es keine. Und wie fein die Damen angezogen waren!
Annemarie lachte übermütig. Sie war heute fast ausgelassen vergnügt: das war grossartig, Schwager Heinz den Pour le mérite bekommen! Schade, dass Rudolf nicht auch Flieger war, es war da viel leichter, ausgezeichnet zu werden. „Er muss mal ’ne ordentliche Heldentat vollbringen, ich warte immer aufs Kreuz Erster; sonst schäme ich mich ja!“ Ihr klangvolles rheinisches Lachen schallte bis in die Veranda, wo Hedwig und Frau von Voigt am Teetisch sassen.
Die beiden hatten lange und vertrauensvoll miteinander gesprochen; es war das erste Mal, dass sie die Zukunft ihrer Kinder berührten. Hedwig schloss die Augen wie geblendet — Heinz, ihr Sohn, ein so berühmter Flieger? „Es ist mir wie ein Traum. Oft frage ich mich: ist das der Junge, der in der Schule nicht lernen wollte? Er hat mich oft Tränen gekostet. Rudolf nie. Aber er — o weh, die Zensuren! Ich habe manches Mal darüber geweint.“
„Nun haben Sie doppelte Freude an ihm,“ sagte die Generalin herzlich.
Hedwig nickte: „Grosse Freude.“ Sie war den ganzen Tag schon blass vor innerer Erregung. Es war etwas Übermächtiges auf sie eingestürmt, als sie gestern im Abendbericht von der Auszeichnung ihres Sohnes las. „Du bist ordentlich grösser geworden,“ neckte sie ihr Mann. Ach nein, nicht den Kopf zu hoch tragen! Fast ängstlich wehrte Hedwig alle Glückwünsche ab. ‚Bist du aber mal komisch,‘ sagte Annemarie; sie ärgerte sich über die Schwiegermutter: warum sich denn nicht mal so recht freuen?
In Hedwigs Seele war ein Bangen: Heinz hatte zuviel Glück, erst diese Erfolge, und dann —! Ihr zärtlicher Blick flog die Stufen der Veranda hinab in den Garten. Da stand Lili mitten im Licht, um ihr blondes Haupt wob die Sonne einen Strahlenkranz. „Ich hoffe sehr, dass Heinz bald auf Urlaub kommen kann.“
Der Mütter Augen lächelten sich zu. Jede von ihnen spann den Gedanken weiter: wenn er hier wäre! Ja dann, dann würde er schon den richtigen Weg einschlagen, um Lili zu überzeugen, dass sie dem Toten nun lange genug die Treue gehalten hatte.
„Sie liebt Ihren Sohn sehr,“ sagte Frau von Voigt.
Ein glückliches Rot floss über Hedwigs zartes Gesicht. Und wie ihr Heinz die schöne Frau da liebte, das wusste sie auch. Mit dem feinen Instinkt des Mutterherzens ahnte sie: es war nur Lilis wegen gewesen, dass er plötzlich unter die Flieger gegangen war. Lili hatte ihn abgewiesen; er hatte zu früh gefragt. Aber nun konnte er fragen. Sie empfand es fast mit Ungeduld, dass er noch nicht hier war, dass er sich nicht nahm, was sich ihm gern zu eigen geben würde. Da war Rudolf anders gewesen: kommen, sehen, lieben, nehmen. Wie es Rudolf jetzt wohl gehen mochte? Er stand zuletzt in der Gegend von Reims; sie hatten schon eine Weile nichts von ihm gehört. Es berührte die Mutter schier merkwürdig, als sie jetzt seine junge Frau so lachen hörte.
„Glauben Sie, dass es bei Reims sehr schlimm ist?“ fragte sie plötzlich angstvoll. Es war ihr auf einmal, als sei ihr Rudolf, ihr Jüngster, zurückgesetzt vor dem Ältesten; man hatte ihn über dessen Ruhm vergessen. Ihre Liebe wallte auf: gerade um Rudolf, gerade um den sorgte sie ja am allermeisten. „Ich las von starkem Feuer bei Reims.“ Ihre Augen hingen am Gesicht der anderen.
Die Generalin hatte etwas Beruhigendes in der Stimme. „Es scheint rege Artillerietätigkeit. Aber die Infanterie greift bis jetzt nicht ein. Ich glaube, Sie können ganz ruhig sein.“ Ihre warme Hand legte sich auf die kalten nervösen Finger. „Liebste Frau, machen Sie sich doch keine unnützen Gedanken. Wir wollen uns die frohe Stunde nicht trüben. Sie bekommen sicher bald Nachricht.“
„Meinen Sie?“ Die kalten Finger zuckten. Aber dann rüttelte Hedwig sich, als schüttele sie etwas Quälendes von sich ab, es glitt ein Sonnenschein über ihr Gesicht. „Wie wird Rudolf sich freuen, wenn er seinen Jungen wiedersieht! Beim letzten Urlaub war der noch nicht viel mehr als ein kleines Tierchen: essen, trinken, schlafen. Wie hat er sich in den sechs Monaten entwickelt! Er ist schon ein Mensch, ein kleiner glücklicher Mensch. Er lacht den ganzen Tag, weint nie.“ — —
Unter der Linde standen sie jetzt alle zusammen um das Kind herum. Das zeigte, wie gross es war, machte ‚bitte, bitte‘ und spielte ‚Guckguck‘. Annemarie wollte es haschen, da verbarg es mit hellem Aufjubeln sein Köpfchen im Kleid der Grossmutter.
Am Zaun standen zwei Kinder. Sie lugten durch die Gitterstäbe, das Mädchen klemmte gleich den ganzen Kopf durch. „Du,“ sagte Minna Dombrowski zum Bruder, „da drinne is et scheene, wat?“ Ihre Augen leuchteten; sie hatte ganz dieselben dunklen dreisten Funkelaugen, wie ihre verstorbene Mutter, die hübsche Minka Dombrowski, sie gehabt hatte. „Ick wünschte, wir könnten dadrinne ooch mal spielen.“ Immer weiter streckte sie den Kopf vor, nun schlüpfte auch die Hand durch und bog die Zweige des verdeckenden Gebüsches zur Seite.
„Zaungäste!“ Alle blickten hin.
Au weh, da war ja auch die Frau von Voigt! Vor Schreck wagte Minna nicht, sich zurückzuziehen, obgleich der Bruder sie am Kleide zog. Den Kopf durchs Gitter gesteckt, versuchte sie zu knixen.
Die im Garten lachten. „Komm mal herein, Minna,“ sagte die Generalin freundlich.
Da ermannte sich die von Bewunderung und Respekt ganz Erstarrte: „Erich aber ooch!“
Nun standen die Kinder beide auf dem sonnenbeglänzten weissen Kies.
„Sie haben keine Schuhe an, auch keine Strümpfe,“ sagte Annemarie.
Minna sah nieder auf ihre nackten braunen Füsschen; es war ihr noch nie eingefallen, dass man Schuhe und Strümpfe anhaben könnte, ehe es Eis fror. Jetzt war sie verlegen.
Aber Erich sagte: „Schuhe sind zu teuer. Und Strümpe —? jiebt’s ja jar nich. Wenn Vater aus’m Krieg kommt, denn bringt er Leder for uns mit.“
„Sie haben keine Mutter mehr!“ Frau von Voigt legte dem Jungen die Hand auf den Kopf. „Nun, immer brav gewesen?“
Die Kinder zitterten: waren ihre Ohren auch sauber gewaschen? Oh, wenn die Müllern gewusst hätte, dass die Frau General sie sah, dann hätte Minna gewiss eine reine Schürze umbinden dürfen, und Erich hätte ein Taschentuch gekriegt. So musste er immerfort schnüffeln, wenn er nicht Talglichter ziehen wollte.
„Hast du kein Taschentuch?“ Annemarie lachte hell. „Da nimm mal!“ Der Junge stand rot übergossen; sie fuhr ihm mit ihrem duftenden Tüchelchen über die Nase.
Hedwig lächelte: das war doch eigentlich nett von der Schwiegertochter. Dann ging sie zum Teetisch, um den Kindern Kuchen zu holen.
Die staunten: Kuchen?! Den hatten sie nicht mehr gesehen, seit die Mutter tot war. Sie wurden zutraulich. „Komm, spielen,“ sagte Minna und griff nach Rudis Händchen. „Erich, fass du auch an!“ Sie nahmen den Kleinen in die Mitte. „Nu spielen wer im Kreis!“ Minna ordnete geschäftig; sie mussten sich alle anfassen und im Kreise drehen. Der kleine Rudi hob die Beinchen und krähte vor Vergnügen.
„Mariechen, warum weinest du,
weinest du, weinest du — —“
Die Kinder sangen aus Leibeskräften. Annemarie stand in der Mitte. Aber Minna war unzufrieden: „Nee, Sie müssen nich immerzu lachen, Sie müssen sich hinhucken un ’s Jesichte zuhalten, un janz schrecklich weinen.“
„Mariechen, warum weinest du,
weinest du, weinest du — —“
„Wenn ich aber doch nicht kann!“ Annemarie wollte sich totlachen.
„Na, denn:
‚Blauer, blauer Fingerhut,
Hätten wir Jeld, das wär’ wohl jut!‘“
Das hatte Annemarie auch in ihrer Kindheit gespielt, wenn vom Rhein her ein Wehen kam voll von Frische und Feuchte und Tang und Teer. Sie sang kräftig mit. Damals waren ihre langen Zöpfe geflogen, jetzt flatterten ihre duftigen Röcke. Immer rascher drehte sie sich. Minna war zufrieden.
Lili wurde mit fortgerissen; sie fühlte heut ihre Jugend. Heute lastete auf ihrem Herzen keine Bangigkeit, es schlug so hoch, so voll, und rascher in einem Rhythmus stolzester Freude. Sie hob die Füsse geschwinder, höher, sie drehte sich im Wirbel, wie ein Taumel erfasste es sie. Es war ihr, als tanze sie einen Siegestanz: ihm, ihrem Helden zu Ehren.
Sie waren alle fröhlich. Sie hatten es gar nicht acht, dass die Gartentür klinkte. Eine Depeschenbotin ging ins Haus.
Während sie sich draussen noch drehten im harmlosen Singsang, stand Herr Bertholdi an seinem Schreibtisch. Schwer stützte er sich mit beiden Händen auf die Platte. Er hatte eben eine Depesche empfangen. Er hatte sie gelesen.
‚Leutnant Rudolf Bertholdi gestern Brustschuss. Soeben entschlafen.‘ —
Was da noch stand vom ‚Heldentod fürs Vaterland‘, vom ‚Kreuz Erster noch erhalten‘, von ‚aufrichtiger Teilnahme‘, vom ‚Andenken in Ehren‘, das las er nicht mehr. Tot, Rudolf tot! Mit einer verzweifelten Gebärde fasste der Mann sich in das ergraute Haar: wie sollte er’s ihr sagen? Wie es ihr schonend mitteilen? Ihr Jüngster, ihr Liebster! Ein ‚Schonend-mitteilen‘ gab es nicht — — tot, tot! Ihr Rudolf, ihr geliebtestes Kind — arme Hedwig, arme Mutter!
Draussen sangen sie: ‚Blauer, blauer Fingerhut!‘
Wie Bertholdi es ihr gesagt hatte, das wusste er nicht. Er hatte lange gestanden und ratlos vor sich hingestiert, dann nach dem Mädchen geklingelt. „Rufen Sie meine Frau zu mir.“
Was hatte der Herr? In des Mädchens frischem Gesicht erstarb plötzlich das Rot. Wie sah der Herr aus, da war etwas nicht in Ordnung! Eine Depesche war gekommen — sicher nichts Gutes — am Ende war Herrn Heinz etwas passiert! An den Jüngeren dachte die Emilie nicht, aller Gedanken hingen ja an dem Flieger. Als sie noch stand und ihn fragend anblickte, wiederholte Bertholdi ungeduldig: „Meine Frau, meine Frau!“ —
Am Schreibtisch standen sie sich gegenüber. Hedwigs Brust atmete rasch, noch waren ihre Wangen rot, sie hatte sich nicht wehren können, die Jugend hatte sie mit in ihren Kreis gezogen. Die Haare hatten sich ihr gelöst, an den Schläfen ringelten ein paar Löckchen, sie sah gar nicht aus wie die Mutter von erwachsenen Söhnen.
Bertholdi sah das alles, sah es heute mit einem schnellen, merkwürdig schnellen Blick — da stand sie vor ihm, wieder ganz das Mädchen, das er einst so sehr geliebt, so sehr begehrt hatte. Liebte er sie denn jetzt nicht mehr? Oh, noch viel mehr, heute im Unglück noch mehr. Er, der sonst nicht seine Zärtlichkeit zeigte, breitete beide Arme weit aus: „Hedwig!“
Es musste etwas Seltsames im Ton seiner Stimme mitgeklungen haben, ihr eben noch heller Blick trübte sich, die Farbe schwand aus ihrem Gesicht, sie schien um Jahre älter mit einem Mal. „Was ist?“ Eine jäh aufgeschreckte Unruhe war in ihrer Frage. Und da wusste sie’s auch schon. Sie sah auf dem Tisch das Depeschenblatt, sie sah das Zucken um den Mund ihres Mannes, die Tränen in seinen Augen, und mit einem Ächzen stiess sie heraus: „Heinz!“
„Nein!“
Sie hob das erblasste Gesicht, mit einem wirren, entsetzten Ausdruck starrte sie ihren Mann an, dann schrie sie gellend auf: „Rudolf?!“
Er nickte stumm. Er konnte nicht sprechen.
Sie aber sprach. In wirren, wilden, sich überhastenden Sätzen. Sie hatte das Telegramm an sich gerissen, gelesen. Ach, diese paar kurzen knappen Zeilen, so wenig Worte um ein so geliebtes Leben! Sie knüllte die Depesche zusammen, warf sie zu Boden, hob sie dann wieder auf, glättete sie mit zitternden Fingern, las wieder und wieder.
„Rudolf, mein Rudolf! Weisst du noch, wie er sagte: ‚Ich möchte wohl wissen, was wird, wenn der Krieg zu Ende ist, ich habe Angst davor‘ — nun braucht er keine Angst mehr zu haben — tot!“ Sie schrie in namenlosem Jammer. „Ich bitte dich —“ sie hob die gefalteten Hände gegen ihren Mann, riss sie dann wieder auseinander und umklammerte seinen Arm — „du musst ihn holen — wir wollen ihn herholen — ich will ihn hier haben — hier — bei mir — meinen Rudolf, meinen Jungen!“
Die Frau des Sohnes war ganz vergessen; an sie dachten die Eltern noch nicht. Die Mutter war auf einen Stuhl gesunken, zusammengekrümmt sass sie. Tief, tief neigte sie das Gesicht, bis es fast auf ihren Knien lag. Hinter den vorgepressten Händen wimmerte sie, der Mann konnte es kaum ertragen.
Machtlos, hilflos stand er bei seiner Frau, fast verging ihm der eigene Jammer vor ihrem Jammer. Ach, er hatte ja gewusst, wie sie das treffen würde. Er wagte es, seine Hand auf ihr Haar zu legen.
Sie schrie wild auf: „Was hat er verbrochen? Tausende gehen in den Krieg und kommen wieder. Warum er, gerade er? Was habe ich verbrochen?!“ Sie hob den Kopf und starrte ihn mit funkelnden Augen an. Er hatte gerade etwas von Gott gesagt.
Sie lachte schrill auf: „Gott?! Der schläft. Oder es gibt überhaupt keinen. Gäbe es einen, dann wäre dieser Krieg nicht!“ Sie riss die Hände vom Gesicht und ballte sie zu Fäusten: „Fluch über die, die diesen Krieg über uns gebracht haben — Fluch über sie alle, alle! Fürs Vaterland gefallen — Vaterland, was ist mir das?! Rudolf, mein Sohn, mein lieber, lieber Junge!“ Sie steigerte sich immer mehr: „Meinen Sohn, gebt mir meinen Sohn wieder!“
War das Hedwig, seine sanfte Frau? Bertholdis Augen blickten in starrem Staunen. Nun sah er zum ersten Mal die Frau, wie sie wirklich war; nicht mehr seine Frau, mit der er fast ein Vierteljahrhundert Seite an Seite gelebt hatte Tag und Nacht. Diese Frau war nur Mutter; und der Sohn, der gefallen war, war ihr einziger Sohn. In seine Erschütterung mischte sich Vorwurf: „Du hast doch noch einen Sohn!“
Sie schrie immer weiter: „Rudolf, Rudolf!“
„Versündige dich nicht.“ Sein schwankender Ton wurde fest, seine Hand lag schwer auf ihrer Schulter. Sie hatte aufspringen wollen, er drückte sie wieder nieder. „Da sind viele, die den Einzigen hingaben. Tausende. In deiner nächsten Nähe. Denk an die Krüger. Du hast doch noch Heinz, deinen Ältesten. Und Rudolfs Sohn, sein liebes Kind. Und —“ er wollte sagen: ‚und mich‘. Aber er sagte es nicht. Wenn sie es denn nicht fühlte!
Doch, als hätte er’s laut ausgesprochen, so sah sie ihn nun an. Jetzt sah sie ihn. Nicht mehr fern wie durch einen Nebel, nein, dicht vor sich, nahe bei sich; sah sein tiefbekümmertes gutes Gesicht. Mit einem schmerzvollen: „Vergib mir,“ griff sie nach seiner Hand.
Er umfasste sie, beugte sich nieder und drückte ihren Kopf an seine Brust. Sie fühlte den Schlag seines Herzens. Immer wieder strich seine Hand zart und zärtlich über ihr verwirrtes Haar.
Ihr Weinen wurde leiser. Was er alles auf sie niederflüsterte, seinen Kopf auf den ihren geneigt, das hörte niemand.
Es war ein grosses Schweigen im Zimmer. Auch die Frau hörte nicht Worte; über des Mannes Lippen kam kein Laut, und doch hörte sie viel, viel. Ihr Herz, das das seine oftmals nicht vernommen hatte, das hörte jetzt. Und verstand.