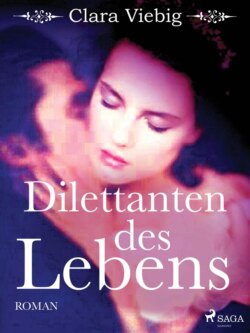Читать книгу Dilettanten des Lebens - Clara Viebig - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II.
ОглавлениеDer Morgen kam herauf. In dem kleinen Zimmer mit dem zerwühlten Bett und dem geöffneten Koffer war fahle Frühbeleuchtung.
Lena trat hin und her, schon in Hut und Mantel; jetzt sah sie sich um. In dem nüchternen Licht erschien ihr alles anders als gestern. Im Dunkel der Nacht war sie sich wie eine Märtyrerin vorgekommen; Hirngespinste, Träume hatten sie umwoben — und jetzt —?! Was würde die Mutter sagen? Zu Tode erschrecken musste sie über ihre plötzliche Heimkehr. Und Fritz?! ‚Bleibe mir zulieb‘, hatte er gesagt. Er würde böse sein. Sinnend blieb Lena stehen. — Aber Amalie?
„Nein, ich reise ab!“ Der eigensinnige Zug um Lenas Mundwinkel trat deutlicher hervor, mit einem Ruck warf sie den Kofferdeckel zu und setzte sich darauf; das Schloss schnappte ein.
Nebenan in der Mägdekammer rührte sich’s, jetzt klappte die Tür. Lena öffnete rasch die ihre: „Marie, hören Sie! Wenn der Herr fragt, sagen Sie, ich wäre abgereist. Ich muss abreisen; sofort!“ Sie vermied den Blick der Magd. „Ich will niemanden stören. Vom Bahnhof schicke ich einen Dienstmann, geben Sie ihm meinen Koffer. Adieu!“ Schon war sie die Treppe hinunter, und Marie sah ihr kopfschüttelnd nach. Allzu verwundert war die Marie nicht.
Draussen war’s noch menschenleer; in der Allee, zwischen den Villen und Gärten, begegnete der Eilenden niemand. Überall waren die grünen Jalousien geschlossen; hinter den Eisengittern die Blumen taubesprengt. Und drüben, jenseits der Mosel, die Berge in wunderbarem Duft; um die Spitze der Mariensäule das erste Gleissen der hervorbrechenden Sonne.
Lena sah nicht hin, sie rannte wie auf der Flucht; jetzt mässigte sie ihren Schritt — die ersten Menschen! Durchs alte römische Stadttor, in die innere Stadt hinein, zogen die Marktleute, Wagen knarrten, Hunde bellten; Lena empfand das Quietschen der Räder schneidend bis ins Mark. Sie fröstelte; sie war übernächtig, die Augen brannten, der Kopf schmerzte.
Jetzt war sie am Bahnhof. Wenige Kofferträger lungerten umher; einen derselben schickte sie ab, und dann setzte sie sich in den Wartesaal. Es war so lange Zeit, über eine Stunde noch. Sie bestellte sich Kaffee und mochte ihn doch nicht trinken, ein übles Gefühl sass ihr in der Kehle; es war ihr alles zuwider. Sie fühlte sich grenzenlos elend; verstört schweifte ihr Blick an den Wänden auf und nieder. Da die Bilder einiger Potentaten, in Reih und Glied aufgehängt; in der Mitte die Büste des Kaisers, sie war neugegipst, der Eichenkranz sass schief. Und da das Büfett mit der unvermeidlichen dicken Mamsell, dem verschlafenen Kellner und den vertrockneten Brötchen unter Glasglocken.
Ab und zu klappte die Tür; übermodern gekleidete Handlungsreisende mit Musterkoffern stürmten herein und riefen gähnend nach einer Tasse Kaffee. Endlos dehnten sich die Minuten. Lena stützte den schmerzenden Kopf in die Hand. Nie im Leben glaubte sie unglücklicher gewesen zu sein, nie unglücklicher sein zu können; der öde Bahnhof, die herbe Morgenfrühe, hier ihr einsamer Winkel, die nüchterne Leere in ihrem eignen Innern, alles stimmte zueinander. Kein Mensch kümmerte sich um sie.
Und er liess sie ungehindert aus seinem Hause gehen. Wie eine, die etwas verbrochen, hatte sie fliehen müssen!
Sie stöhnte und biss sich dann auf die Lippen; sie hätte in heisse Tränen ausbrechen mögen, aber nein, nicht weinen! Der Stolz verbot es ihr. Sie versuchte nun doch den Kaffee, langsam, Löffelchen um Löffelchen, und dazwischen blickte sie nach der Tür; ob der Kofferträger bald kam? Auf der Uhr dort über dem Büfett rückten die Zeiger allmählich vor.
Da — sie liess den Löffel aus der Hand fallen, dass er auf die Untertasse klirrte. Die Tür hatte sich geöffnet; vor dem Dienstmann her drängte sich eine wohlbekannte Gestalt, den Überzieher nicht zugeknöpft, den Schlips ungebunden, lose herunterhängend.
Lena sah’s in einem Augenblick und musste lächeln in aller Betrübnis — ihr ordentlicher Bruder, dem konnte das passieren? Ja, er liebte sie doch!
„Lena, Lena!“ Landgerichtsrat Langen trat atemlos an den Tisch. „Was tust du mir an? Marie sagte mir eben, du seist fort, und gerade kommt auch der Dienstmann und will deinen Koffer holen. Ich bitte dich, Lena, mach’ keinen Eklat! Bleib, Lena!“ Er suchte ihren Blick.
Eine heimliche Freude durchzuckte sie, aber sie bezwang sich. „Haben Sie den Koffer?“ fragte sie den Träger.
„Jawohl, Madam!“
„Kommen Sie mit an den Schalter, ich habe noch kein Billett.“ Und sich flüchtig zum Bruder wendend: „Ich bin gleich wieder hier.“
„Lena, Lena!“
Sie zögerte. Sein Ton durchschauerte sie; blass und rot flog es über ihr Gesicht, unschlüssig senkte sie den Kopf.
„Lena, wenn ich dich nun bitte?! Amalie hat mir versprochen, liebenswürdig zu sein, sie lässt dich grüssen und bittet dich, zurückzukommen, sie — zucke nicht so mit dem Mund! — sie ist wirklich verständiger als du!“
„So?“ Lena zuckte zusammen, es traf sie wie ein Schlag ins Gesicht. „Ich — ich — kommen Sie,“ sagte sie hart zu dem Dienstmann.
„Lena, du bist eigensinnig, trotzig!“
Sie hörte ihn nicht mehr, sie war schon hinaus. Oh, dieses Mädchen! Unwirsch, mit raschen Schritten, ging Langen vor dem Tisch hin und her. Er kannte diese Falte zwischen ihren Brauen, diesen Zug um den aufgeworfenen Mund. Eine tiefe Bekümmernis stieg in seiner Seele auf; wie würde sie im Leben noch anlaufen! Die Mutter war viel zu schwach, er selbst konnte nicht immer bei ihr sein — und wenn auch, folgte sie denn? Sie war liebevoll und schmiegsam, aber nur bis zu einer gewissen Grenze; da stand ihr eigner Wille, machte sich breit und liess nichts anderes passieren. Nach wieviel Kämpfen hatte sie’s durchgesetzt, Musik zu studieren. Sängerin werden! Sie hatten’s ihr alle gesagt, ihr Körper sei nicht stark, ihre Stimme schwach — vergebens! Die Mutter musste nach Berlin ziehen, pekuniäre Opfer wurden gebracht, seit Jahren wurde nun studiert; sie musste eben mit dem Kopf durch die Wand.
Ärgerlich riss Langen an seinem Schnurrbart. Da trat sie wieder in den Saal, schlank und schmächtig im langen Reisemantel, den Schleier zurückgeschlagen von dem blassen, aufgeregten Gesicht; ihre grossen Augen blickten trüb. Nein, er konnte ihr nicht böse sein! Eine grosse Zärtlichkeit wallte in ihm auf.
„Lena,“ sagte er weich, „meine Schwester!“
Sie war auf einen anderen Ton gefasst gewesen; überrascht sah sie ihn an. Es war, als wollte sie sich an ihn schmiegen; sie ergriff seine Hand. „Es ist nett von dir, dass du noch gekommen bist; ich danke dir!“
„Böses Mädchen!“ Er versuchte zu lächeln, aber es war ihm nicht danach. „Was wird die Mutter sagen? Und was du für einen harten Kopf hast!“
„Krause Haare, krauser Sinn!“ Sie lachte wirklich, hell auf.
Es berührte ihn fast unangenehm; wie konnte sie nur jetzt lachen? „Lena, gestern sagtest du noch, du wüsstest, ich brauchte dich — heut gehst du von mir, und es tut dir gar nicht leid?“
„O doch, o doch!“ Ihr Lachen war verschwunden, sie presste seine Finger in ihren beiden Händen, und dann, rasch sich umblickend, ob auch niemand herschaue, drückte sie ihren Mund auf seine Hand. „Grüss’ Lora und auch Walter. Du musst mir nicht böse sein. Ich kann, ich kann nicht anders! Sie hat mich beleidigt, ich kann nicht vergessen!“
„Aber vergeben!“ Er sah sie ernsthaft an. „Du wirst es lernen müssen im Leben.“
„Vergeben?“ murmelte sie, „nein, ich“ — sie stockte, der Portier riss die Tür auf.
„Einsteigen in der Richtung nach Gerolstein, Euskirchen, Köln!“
„Du musst umsteigen in Köln,“ sagte Langen hastig, „du hast anderthalb Stunden Aufenthalt dort. Schreib mir eine Karte vom Bahnhof, wie es dir geht.“
„Ja, ja!“ Ihre Stimme klang gepresst, eine unnennbare Angst vor der langen einsamen Reise überfiel sie; und heute, gerade heute, hatte sie so das Bedürfnis, sich anzulehnen! Im Hinausgehen presste sie des Bruders Arm. „Fritz, lieber Fritz!“ Sie weinte.
„Meine Schwester!“ Er half ihr in das Kupee, kein anderer Reisender stieg ein, und dann schwang er sich noch einmal zu ihr hinauf. „Leb wohl, Lena!“
Sie schluchzte laut und presste ihren Kopf an seine Schulter.
„Lena, was machst du uns für Kummer, dir und mir! Ich bin traurig.“
Es wallte in ihr auf, trotzig wollte sie erwidern: ‚Ich? Nicht ich, deine Frau macht dir Kummer,‘ aber sie sah sein Gesicht. „Du hast ja Lora,“ sagte sie aus einer merkwürdigen Ideenverbindung heraus.
Er nickte. „Sie ist mein einziges — mein grösstes Glück,“ verbesserte er sich rasch.
„Fertig!“ Der Schaffner warf die Türen zu.
„Leb’ wohl, Lena, komm gut nach Haus!“
Noch ein hastiger Kuss. Langen sprang auf den Perron zurück. Lenas blasses verweintes Gesicht nickte zum Fenster heraus.
*
Station auf Station. Die Eifelberge guckten rechts und links ins Fenster. Lena sah nicht hinaus. Den wüsten Kopf an das Seitenpolster gedrückt, sass sie mit geschlossenen Augen. Sie fuhr wie aus einem Traum auf, wenn der Zug an einer Station hielt; dann duselte sie weiter. Der Wagen wurde hin und her geworfen, immer das gleiche Rrrrrr —, das eintönige Rattern der Räder. So sass ihr ein Rad im Kopf, das drehte sich unaufhörlich um die gleiche knarrende Achse.
Gekränkt! Eine andere vorgezogen! So war’s beim Bruder gegangen, er hatte sie lieb und hielt doch zu der anderen; so war’s bei dem gegangen, um dessentwillen sie aus Berlin geflohen war! Wie hatte er ihr die Cour gemacht im vergangenen Winter! Sie hatten sich oft bei einer befreundeten Familie getroffen, zu oft; er hatte ihren Gesang bewundert, ihr glühend die Hand geküsst, dann kam das Frühjahr — aus! Er hatte auch eine andere vorgezogen.
Hatte sie ihn geliebt? Lena presste die Augen fester zu, eine Röte stieg ihr jäh ins Gesicht; wenn sie das nur wüsste! Sie hatte schon oft zu lieben geglaubt; immer war aus den Trümmern einer alten Liebe das Morgenrot einer neuen gestiegen. ‚Das muss so sein,‘ sagte der berühmte Gesangsprofessor, ‚immer verliebt! Wo soll denn eine sonst den Ausdruck herkriegen?‘
Aber nun glaubte Lena nicht mehr an eine neue Liebe. Die rechte würde doch nicht kommen, nie, nie! Alles ging unter in dem Gefühl der erlittenen Kränkung, in dem neuen grossen Unglücklichsein. Sie wollte nun nichts mehr von den Menschen, nein, nur die Kunst, die Kunst! Sich an die mit allen Fasern klammern, immer ihr nach, ohne nach rechts und links zu blicken! Eine stürmische Sehnsucht fasste plötzlich Lenas Herz; ein unwiderstehlicher Drang trieb ihr Tränen in die Augen, ihre Wangen glühten.
„Gerolstein!“
Sie fuhr auf; sie war erschrocken. Draussen Laufen auf dem Perron, Schlagen von Türen, Rufen — jetzt wurde ihr Kupee aufgerissen.
„Steigen Sie ein, Herr, hier ist Platz,“ sagte die rauhe Stimme des Schaffners.
Wie unangenehm! Lena zog sich ganz in ihre Ecke zurück, sie hatte jetzt nicht Lust auf Gesellschaft; sie schämte sich der Tränen, die noch verräterisch in ihren Augen glänzten, und ihrer heissen Wangen.
„Sie gestatten,“ sagte der Fremde, fasste an den Hut, brachte sein Gepäck unter — Lena sah Malutensilien, Farbkasten, Staffelei, Leinwandschirm, Feldstuhl — und warf sich dann auf den Sitz, die Beine von sich streckend.
Der Zug rasselte weiter.
Eine halbe Stunde war vergangen; nach und nach wurde die Landschaft draussen flacher, die pittoresken Formen der Eifelberge verschwanden, die schwermütig nackten Kuppen mit ihrer kahlen Einsamkeit machten sanften Abdachungen, Äckern und Dörfern Platz. Schon tauchten Fabrikschornsteine auf.
Lena fröstelte, die ganze Poesie war dahin; und dabei musste sie gähnen, eine schreckliche Leere in ihrem Magen quälte sie. Sie hatte Hunger. Sie schämte sich vor sich selber; wie konnte man so unglücklich sein und doch Hunger haben? Bis Köln würde sie’s noch aushalten müssen. Unruhig glitt ihr Blick umher.
Ihr Gegenüber zog jetzt ein weisses Papierpaketchen aus der Handtasche; ein paar appetitliche Butterbrote waren darin, und zwischen Blättern auch Früchte. Das Wasser lief ihr im Mund zusammen, sie neigte sich vor und machte grosse Augen.
Als ob er’s geahnt hätte, so sah er jetzt auf; ihre Blicke begegneten sich, sie wurde über und über rot, wie ein ertapptes Kind. Ein leichtes Lächeln hob seine Oberlippe, man sah die schönen weissen Zähne; auf der flachen Hand hielt er ihr das Papier hin. „Darf ich Ihnen etwas Obst anbieten? Auf den primitiven Bahnhöfen, die wir passieren, gibt’s nichts Geniessbares. Verzeihen Sie, ich wollte nicht unbescheiden sein!“
Lena hatte sich auf die Lippen gebissen und war in ihre Ecke zurückgefahren — was dem einfiel?! Es wurmte sie, aber gleich darauf kam ihr alles so komisch vor, sie musste lachen. „Sehe ich so hungrig aus?“ Und dann streckte sie die Hand aus und nahm eine Frucht und dann, zögernd, ein Butterbrot. „Ich bin auch hungrig! Es ist gewiss komisch, dass ich —“ sie brach verlegen ab.
„O gar nicht!“ Er hatte eine famose Art, ihr über die Befangenheit wegzuhelfen. „Reisegefährten sind ja für eine Weile Lebensgefährten — warum also nicht?“ Er langte wieder in die Tasche und entkorkte eine Flasche. „Da, bitte trinken Sie!“ Er hielt ihr einen Becher mit Wein hin.
Ohne Zögern tat sie einen tiefen Zug, und noch einen. Der Wein war stark, die Schatten unter ihren Augen verschwanden, ihre Lippen wurden feucht und rot. „Ich fühle mich jetzt ganz anders,“ murmelte sie, „so viel frischer, ich danke sehr!“ Ihre Augen glänzten.
Er fand sie hübsch, viel hübscher, als er anfänglich gedacht hatte. Diese schmale Stirn mit den Lockenringeln, der eigentlich zu grosse Mund mit der charakteristischen kurzen Oberlippe waren pikant. Ein Mund, der viel Amüsantes plaudern konnte, den es lockend war, zu küssen.
„Mein Fräulein?“ Es klang wie eine Frage.
Sie nickte.
„Also, mein Fräulein, erlauben Sie, dass ich mich Ihnen vorstelle: Bredenhofer, Richard Bredenhofer, Dilettant in allen Künsten — und sonst nichts!“
„Oh!“ Sie schielte nach den Malergerätschaften, die oben im Netz schaukelten.
„Nein, nein,“ er lachte halb spöttisch, halb leichtsinnig, „wirklich nur ein Dilettant, auch hierin. Aber man gibt die Hoffnung im Leben nicht auf. Einmal muss es doch kommen, das, nach dem man Durst hat, das“ — er schloss die Hand und öffnete sie wieder — „das — ich weiss nicht, wie ich’s nennen soll!“
„Ach,“ sie wurde zutraulich, „geht’s Ihnen so wie mir? Ich hatte nicht bloss Hunger auf Ihr Butterbrot. Sind Sie auch nie satt? Ich meine geistig. Einen Tag ist man so voll und könnte die Welt stürmen, und den anderen ist man dann wieder so erbärmlich und klein und hat gar keine Courage zu was. Es ist greulich!“ Sie legte die Hände ineinander und sah wehmütig drein. „Ob grosse Leute, wie Schiller und Goethe und Beethoven und Mozart, auch so gefühlt haben?“
„Diese führenden Geister? Sie greifen gleich sehr hoch!“
„Hoch oder gar nicht!“ Sie warf den Kopf hintenüber.
„Das sage ich auch!“ Seine Augen blitzten. „Wer will es uns wehren, nach den Sternen zu greifen? Hallo!“ Er sprang auf, die Früchte rollten ihm unbeachtet vom Schoss auf den staubigen Kupeeboden. „Sie sind Künstlerin, gnädiges Fräulein?“
„Ich möchte gern.“ Ein banger Ausdruck trat in ihr Gesicht. „Wenn’s mir nur gelingt!“
„Es wird, es wird!“ Er sah sie an.
Sie blickte geradeaus, ihre Augen waren tief geworden, ihr schmales weiches Gesicht erschien bedeutender.
„Ich muss etwas erreichen,“ sagte sie wie für sich. „Ja“ — sie sagte es mit Vehemenz, alle ihre Enttäuschungen, besonders der letzte Kummer fielen ihr wieder ein. „Alles andre ist doch nichts! Ich möchte eine grosse Sängerin werden. Wissen Sie“ — nun klang ihr Ton gemässigter —, „wir hatten in unserem Garten in der kleinen Stadt, wo mein Vater Landrat war, einen Birnbaum, einen sehr grossen Birnbaum; unten hingen immer Birnen genug, die mochte ich aber nicht. Oben an den Ästen, die, auf welche die Sonne prall schien, die der Wind schaukelte, die wollte ich. Xmal bin ich als Kind hinaufgeklettert, oft heruntergefallen, und wenn ich nicht ’ran konnte, weinte ich. Es geht mir immer noch so.“
„So?“ Er fuhr sich mit gespreizten Fingern durch die Haare, und dann sagte er zerstreut nochmals: „So, so.“ Jetzt lachte er kurz auf und strich sich wieder durch die Haare mit der gleichen nervösen Bewegung. „Ja, die Früchte, die sitzen verdammt hoch, aber man muss nur den Glauben an sich selbst nicht verlieren — äh!“ Er zuckte mit den Schultern und griff dann mit rascher Bewegung nach dem Becher. Er füllte ihn aufs neue. „Prost, gnädiges Fräulein, prost! Es lebe die Kunst!“
Sie nickte ihm zu. Das Fenster war geöffnet, ein rascher Wind fächelte herein und hob spielend die braunen Lockenringel auf der Mädchenstirn. Lena fühlte keinen Kopfschmerz mehr, sie dachte augenblicklich herzlich wenig an den letzten schweren Kummer. Es plauderte sich gut mit dem Reisegefährten. Er war hübsch; was er sagte, schien klug. Er hatte etwas — wie sollte man’s nennen? — etwas Nachlässiges im Reden, leichtlebig Freies, und doch zuweilen einen schwermütigen Augenaufschlag. Er war entschieden ein Künstler.
Der Zug raste dahin, die Zeit verging rasch. Lena hatte eine unangenehme Empfindung im Herzen, als es hiess: Köln. Nun musste man sich trennen — schade!
Aber nein, er fragte: „Reisen Sie auch weiter nach Berlin?“
„Natürlich!“ Sie lachte fröhlich auf, sie war auf einmal so vergnügt. Also aus derselben Stadt — wie konnte es auch anders sein?! Sie waren plötzlich wie alte Bekannte.
Auf dem weiten Perron, vor dem in einer Art von maurischem Stil gehaltenen Bahnhofsgebäude, wogten die Reisenden hin und her. Es war ein sehr internationales Publikum mit Wagenladungen ungeheurer Koffer; schon auf zehn Schritt roch man das Chyper der Engländerinnen und das Patschuli der Französinnen.
Die Kölner Gepäckträger mit ihrer breiten faulen Sprache machten sich Platz: „Aufjepa—a—asst!“
„Kelnische Zei—i—tung! Kladderrrrra—a—dattsch!“ Ein Zeitungsjunge schrie mit gellender Stimme.
„Fatal!“ Bredenhofer fuhr sich mit beiden Händen an die Ohren. „Äh, ich kann den Lärm nicht ertragen; grässlich! Wir haben Zeit genug, gehen wir in den Dom!“ —
Und nun standen sie auf dem Domplatz; ungeheuer, wie ein steinerner Berg, dessen Spitzen in den Himmel ragen, hob sich der Dom vor ihnen. Die Kreuzblumen der Türme von blauem Äther umflossen; goldener Sonnenschein verklärte den grauen Koloss.
Lena kannte Köln, sie kannte den Dom; so schön wie heute war er ihr noch nie erschienen, das lebhafte Entzücken ihres Begleiters steckte sie an.
Bredenhofer war ganz aufgeregt. Mit allen möglichen technischen Ausdrücken erklärte er ihr dieses und jenes — sie war erstaunt, was er alles wusste —, und wo ihm ein Ausdruck mangelte, half er sich durch einen Witz. Mit einem aus Heiterkeit und Andacht gemischten Gefühl trat sie ins Portal.
Drinnen heiligste Dämmerung, durchschossen vom wunderbar mystischen Licht der bunten Glasfenster. Unterm Kreuzgewölbe eine schwebende Luft von Weihrauch und geschmolzenem Wachs; vor den Seitenaltären flackernde Kerzen und steife Heiligengestalten, die gekrümmten Finger segnend ausgestreckt. Es zwang einen zum Flüstern; wer hätte hier ein lautes Wort gewagt?
Lena war blass geworden; die kühle Dämmerung durchschauerte sie und daneben eine scheue Ahnung der grossen hohen Poesie. Ihre Brust hob und senkte sich, ihr Atem zitterte, verstohlen sah sie ihren Begleiter an. Er hatte den Hut abgenommen, seine Stirn leuchtete merkwürdig weiss, wie die eines Mädchens; er starrte geradeaus und bewegte die Lippen.
Nun fühlte er ihren Blick, er fasste nach ihrer Hand und hielt sie mit leisem Druck; sie wagte nicht, ihre Finger wegzuziehen. Auf den Zehenspitzen schlichen sie an den geschnitzten Beichtstühlen entlang; wie schön musste es sein, sich hinter den grünseidenen, sanftrauschenden Gardinchen all seiner Kümmernisse zu entledigen! Lena fühlte ihr Herz klopfen, sie bedauerte fast, dass sie nicht katholisch war.
Jetzt waren sie in der Seitennische, vor dem kleinen Altar des wundertätigen Marienbildes; das Triptychon war geöffnet, das süsse Madonnenantlitz mit dem sich anschmiegenden heiligen Kinde lächelte vom Goldgrund auf sie nieder. Unwiderstehlich fühlte sich Lena niedergezogen — es war Bredenhofers Hand, die sie zwang, auf dem schmalen roten Bänkchen zu knien, sein warmer Atem streifte ihre Wange.
Halb gesungen, halb geflüstert klang es ihr ins Ohr:
„Im Dom, da steht ein Bildnis,
auf goldenem Grunde gemalt;
in meines Lebens Wildnis
hat’s freundlich hineingestrahlt —“
Er hielt noch immer ihre Hand, jetzt — jetzt — der Druck! Sie erschrak bis ins innerste Herz.
„Die Augen, die Lippen, die Wänglein,
die gleichen der Liebsten genau!“
Sie war gemeint, sie fühlte es, und sie errötete über und über. Sie hob die Lider nicht.
Jetzt gab er ihre Finger frei. Ohne Wort, stumm nebeneinander herwandelnd, durchschritten sie die andere Seite der Kirche. Jetzt kam das Portal. Sie waren wieder draussen.
Das laute Gewühl des Marktes schlug ihnen entgegen, Droschken jagten zum nahen Bahnhof, Lastfuhrwerke ratterten hinunter zur Schiffbrücke; es war wieder Tag, nüchterner Tag, greller Sonnenschein fiel aufs Pflaster. Lena blinzelte, sie schloss für einen Augenblick die Augen.
„Nehmen Sie meinen Arm,“ sagte Bredenhofer, und sie tat’s ohne Ziererei. Arm in Arm schlenderten sie an den Läden der Hochstrasse entlang. Wer kannte sie beide hier in der fremden Stadt? Menschen im Geschäftsschritt hasteten vorüber, bunt gekleidete Kölnerinnen mit auffallenden Hüten machten ihre Einkäufe in den Läden; die beiden wanderten zwischen allen durch, aus einer ganz anderen Welt kommend, sich gegenseitig fremd und doch einander so merkwürdig nah. Es fiel Lena gar nicht ein, dass sie Unschickliches tat; harmlos vergnügt hatte sie den Schleier zurückgeschlagen und den weiten Mantel aufgeknöpft, man sah ihre schmale, zarte Gestalt und die angedeuteten Grübchen in ihren Wangen.
Sie traten in ein Restaurant und sassen auf dem tellergrossen Plätzchen vor der Tür, hinter der verstaubten Efeuwand. Münchener Bier schäumte in den gelblichen Steingutseideln; Lena trank, und dann hörte sie wie aus weiter Ferne, wie im Traum den Lärm der Gasse. Sie war so weit weg.
„Was für ein liebes Gesicht,“ dachte Bredenhofer. Er sass ihr gegenüber. Eine dreiste Fliege mit dickem, blauem Leib und blitzenden Flügeln kam und schwirrte um die kleine gerade Mädchennase; die zierlichen Nüstern blähten sich und zitterten. Jetzt kam das Insekt und flog auf das Seidel des Mannes und tunkte den winzigen Saugrüssel in die braune Flüssigkeit. Jetzt schwirrte es berauscht davon.
Aus einem nahen Fenster kam dünnes Klavierspiel — Bachsche Fugen oder so etwas —, aber man merkte es den klimpernden Fingern an, sie waren mehr zu einem Walzer oder einem schwenkenden Rheinländer disponiert. Jetzt klang ein scharfer Misston.
„Ces, ces!“ Der junge Mann fuhr aus seinem Sinnen auf. „Moll, Moll, doch nicht Dur! Heiliger Sebastian Bach“ — er riss die Uhr heraus —, „es ist die höchste Zeit, wir müssen fort!“
Im Sturmschritt durchquerten sie den Domplatz; die Uhr über dem Bahnhofsportal wies nur noch wenige Minuten bis zum Abgang des Zuges. Aber Bredenhofer fand doch noch Zeit; er kaufte dem blassen, spillrigen Ding mit den dreisten Augen dort am Eingang einen Strauss duftiger Herbstveilchen ab und presste sie Lena in den Gürtel.
„Viel Pläsier auf die Hochzeitsreis’!“ schrie das Mädel hinter ihnen drein.
Sie stürmten die hohe Steintreppe hinan, lachend, atemlos — nun sassen sie im Kupee. O weh, noch vier Personen darin! Zwei rundliche Holländerinnen mit Teint wie Milch und Blut und Augen, die nicht von lauter Butter und Käse so blinkten. Ein dicker Phlegmatikus schien der Ehemann der einen. Neben ihm blinzelte ein Geschäftsreisender — man erkannte ihn am Schlips letzter Mode und am Siegelring — nach der anderen Schönen.
„Aaa—chtung!“ Karren rasselten, Türen klappten.
„Kelnische Zei—i—tung! Kladderrrrra—a—dattsch!“
„Bier gefällig?! Bi—er! Bi—er!“
„Kladderrrrra—a—dattsch!“
„Noch glaubt man mit einem Fuss in der Poesie zu stehen, und schon ist man mitten in der Prosa! O weh,“ seufzte Bredenhofer und fuhr sich mit der ihm eigentümlichen nervösen Handbewegung durch das Haar.
Der Zug setzte sich in Fahrt. Bald lag Köln fern; Dom und Hochstrasse, alles der flüchtige Traum einer sonnigen Mittagsstunde.
*
Sie hatten viel geplaudert, halblaut, die Köpfe nah zusammengeneigt. Es hatte einen eigentümlichen Reiz gehabt, so verstohlen miteinander zu sprechen, unverstanden von den übrigen. Dies Flüstern brachte sie sich gegenseitig näher, es richtete eine Mauer um sie auf, über die kein neugieriges Auge schauen konnte.
Es war längst Abend. Draussen vor den Kupeefenstern undurchdringliche Dunkelheit, nur ab und zu huschte eine schwach erleuchtete Station vorüber. Immer weiter von der sonnigen Mittagsstunde fort, immer näher, näher dem grossen Berlin, in dem man untersinkt in Menschenwogen und sich nie mehr begegnet.
Lena hatte geschlafen; sie wachte verwirrt auf. Oben an der Decke, vom blauen Gardinchen verhüllt, der umflorte Schein der Lampe; jenseits das Fenster geöffnet, trotzdem eine warme, matte Luft im Kupee. Lena fasste sich an den Kopf und strich sich die wirren Haare aus den Schläfen; sie hatte geträumt, sie wusste nicht recht, wo sie war — bei Fritz oben im kleinen Stübchen, im grossen Kölner Dom oder zu Hause, drei Treppen hoch, in Berlin?
Verwundert machte sie die Augen weit auf; sie war in der Eisenbahn, aber die Sitze leer, das viele Gepäck verschwunden. Wo waren die dicken Holländerinnen mit dem phlegmatischen Ehemann, wo der Geschäftsreisende? Alle weg; nur ihr gegenüber in der Ecke sass Bredenhofer und sah sie unverwandt an.
„Wo — wo — wo sind sie?“
„Alle ausgestiegen, in Braunschweig, Magdeburg, was weiss ich!“ Er lächelte. „Sie haben lange geschlafen, süss geschlafen; Sie haben nichts gemerkt.“
„Oh!“ Sie zog ihre lässig ausgestreckten Füsse näher an sich und richtete sich stramm auf. Sein unausgesetzter Blick verwirrte sie. „Wie lange dauert’s noch bis Berlin?“
Er zog die Uhr. „Eine Viertelstunde!“
Ein Schreck durchfuhr sie, so plötzlich, so jäh, dass sie über diesen Schreck nun wieder aufs neue erschrak. Warum fürchtete sie sich, wovor? Das Blut stieg ihr zu Kopf, es wirbelte ihr vor den Augen.
„Es tut mir leid,“ hörte sie seine weiche Stimme sagen, „sehr leid; ich wünschte, es wären noch Stunden bis Berlin. Es ist merkwürdig, wie man sich mit jemandem in einer kurzen Spanne Zeit so anfreunden kann! Das macht: gleiches Denken, gleiches Empfinden und der Gott, der uns in der Brust wohnt. Schlagen Sie ein“ — er hielt ihr die Hand hin —, „sagen Sie mir, dass Sie dem Reisegefährten ein freundliches Andenken bewahren werden; ja?“
„Wenn Sie das Gleiche tun,“ antwortete sie zögernd.
„Mein Gott!“ Er lachte, dann sang er mit einer sehr angenehmen Tenorstimme:
„Andre Städtchen kommen freilich,
andre Mädchen zu Gesicht;
ach, wohl sind es andre Mädchen,
doch die eine ist es nicht!“
„Die eine ist es nicht,“ wiederholte er mit zärtlichem Tonfall.
„Sie sind ja auch musikalisch,“ sagte sie ausweichend, „Sie können doch alles!“
Er hielt ihr noch immer die ausgestreckte Hand hin. „Bitte, sagen Sie mir doch, dass Sie mich nicht ganz vergessen werden! Bitte, Fräulein Langen!“
Sie wagte nicht, ihn anzusehen. „O nein,“ brachte sie gepresst hervor. Sie sprang auf und griff nach ihren Sachen; sie stellte sich recht ungeschickt dabei an. Er half ihr. Er hielt ihr den Mantel, beim Hineinschlüpfen fühlte sie, wie er sanft ihren Arm presste; sie bekam ein eigentümliches Beben in den Knien. Und dann drückte sie sich den Hut aufs Haar, zog die Handschuhe an und sass ganz still mit zusammengelegten Fingern.
Er stand am Fenster. „Da — da,“ sagte er plötzlich, „schon das lange Rangiergeleise und die vielen Lichter!“
Rot, blau, grün glitt es vorüber, der Zug fuhr langsamer.
„Jetzt — jetzt sind wir gleich da!“
Kritsch, kratsch! Das Quietschen der Räder ging durch alle Nerven.
Lena sprach nichts; sie sass da und senkte den Kopf auf die Brust und schielte doch von unten herauf immer nach den vorübergleitenden Lichtern und fühlte, dass ihr das Herz schlug bis in den Hals. Er trat unruhig von einem Fuss auf den andern, das Fenster lief an unter seinem Hauch. Es war so warm, so beklommen im Kupee und so still.
„Da —,“ sagte er noch einmal, „wir sind da!“
Der Zug donnerte in die Bahnhofshalle, es wurde blendend, betäubend hell.
„Leben Sie wohl!“
Sie fühlte eine Hand unter ihrem gesenkten Kinn, warme Lippen legten sich auf die ihren — einen Augenblick, eine kurze einzige Sekunde — — —
Sie stiess ihn nicht zurück, sie konnte nicht dafür, ihr Mund zuckte unter dem seinen, einen Augenblick, eine kurze einzige Sekunde, dann —
„Berlin! Alles aussteigen!“ Die Tür wurde aufgerissen.
Gewirr, Geschrei, Gewoge. Lena sah alles und sah doch auch wieder nichts — ein hastig geflüstertes, scheues Adieu — jetzt stand er schon unten auf dem Perron — jetzt rollte sich ein dunkler Knäuel der Ausgangstreppe zu, darunter war er — ah, jetzt war er verschwunden!
Sie würde ihn nie wiedersehen! —
Lena folgte mechanisch dem Gepäckträger; sie fühlte auf einmal wieder ihren ganzen Kummer.