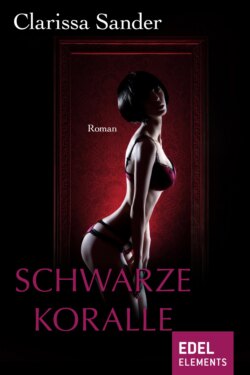Читать книгу Schwarze Koralle - Clarissa Sander - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1
Sie hatte alles: einen vielseitigen, gut bezahlten Job, einen gutaussehenden, erfolgreichen Mann, schicke Kleider, eine luxuriöse Wohnung, Freunde, einen hübschen Kleinwagen. Sie sah attraktiv aus, konnte sich teure Kosmetika leisten. Sie führte ein geselliges, bewegtes Leben, und sie hatte Orgasmen. Es mußte ihr einfach gut gehen.
Sagte sich Maren Hofstetter, als sie eines Montagmorgens im zerknitterten Seidenpyjama vor dem Spiegel stand und sich lustlos ins Gesicht blickte. Diese Aufzählung war unentbehrlich für sie geworden. Sie leierte sie häufig tonlos vor sich hin, und manchmal gelang es ihr tatsächlich, damit eine Stimmungsverbesserung zu erzeugen. Sie hatte auch eine ausführliche Version davon, bei der sie in Einzelheiten ging, die interessanten Abende, die Erfolgserlebnisse im Sender, ihre neuesten Anschaffungen zusammenzählte, die Party bei Katharina und Michael, die Reportage über weiblichen Sex-Tourismus, die beim leitenden Redakteur bestens angekommen war, das lang ersehnte Escada-Kostüm. Das Problem war nur, daß in den letzten Wochen keine der beiden Varianten der Litanei mehr Wirkung zeigte. Sie fühlte sich einfach trostlos. Sie trug ihre schönen farbigen Kleider und wäre am liebsten in Schwarz gegangen. Sie war ständig müde, fand alles langweilig und sinnlos. Sie hatte auf nichts mehr Lust. Und das Schlimmste war: Sie wußte nicht, warum.
Sicher, es war November. Natürlich, sie hatte seit zwei Jahren keinen längeren Urlaub mehr gemacht. Frank und sie waren sich darin einig, daß sie sich beide erst einmal auf ihre neue Arbeit konzentrieren wollten. Außerdem arbeiteten die Kollegen auch ununterbrochen, und sie gaben ihr zu verstehen, daß sie gebraucht wurde. Was schließlich auch ein gutes Gefühl war.
Machten sie und Frank etwas falsch? Ihr fiel nichts ein. Erst neulich hatte er sie ins »Tavola« ausgeführt, sie hatten sich angeregt unterhalten, danach hatte er ihr zu Hause die neuen Dessous vom Leib gestreift, und sie hatten sich heftig geliebt. Das sah doch nach einer guten Ehe aus, oder? Vielleicht hätte Irina ihr einen Rat geben können, aber das war ja wohl nun vorbei. Irina. Maren tauchte ihr Gesicht in zwei Hände voll lauwarmen Wassers. Sie quetschte einen grünen Wurm Zahnpasta auf die Bürste und schrubbte sich heftig die Zähne. Sie massierte ihre Tagescreme in ihre noch schläfrige Haut. Dann kletterte sie aus ihrem Pyjama und stieg unter die Dusche. Ihr war kalt, obwohl das Badezimmer ausreichend beheizt war.
Sie drehte den heißen Strahl auf, ließ ihn auf den Bauch, auf die Schenkel prasseln. Irina. Sie fehlte ihr. Seit einem Jahr hatten sie nicht mehr miteinander gesprochen. Seit der Hochzeit. Zur Trauung selbst war sie nicht gekommen, weil sie angeblich nicht früher weggekonnt hatte. Lächerlich. Franks Schwester war dann ihre Trauzeugin gewesen. Beim Fest war Irina dagewesen, aber ohne Hagen, ihren Freund, und sie hatte gezwungen, gekünstelt gewirkt. Und als Maren atemlos von einem Tanz zurückgekommen war, hatte Irina gesagt: »Und du bist sicher, daß es das Richtige für dich ist?« Wobei sie natürlich »der Richtige« gemeint hatte. Maren hatte ihr das nie verziehen. Irina wußte es. Sie war kurz darauf mit Hagen nach Köln gezogen, weil er dort einen guten Job in einem Museum bekommen hatte, mit dem er seine Malerei finanzieren konnte. Und Irina hatte ihre hervorragende Stellung in der Leitung der Sprachenschule aufgegeben und war einfach mitgegangen. Aus Liebe. Maren fand das unsinnig und unmodern. Diese Entscheidung hatte zu ihrer Entfremdung beigetragen.
Aber Maren vermißte die Freundin. Ihr lautes Lachen, ihre blitzenden Augen, die wilden Locken, den breiten, lachenden Mund. Ihre unkonventionelle, zupackende Art. Irina scherte sich einen Dreck um die Meinung der Leute. Sie waren innerlich und äußerlich grundverschieden, aber sie kannten sich seit ihrer Kindheit, und sie wußten fast alles voneinander. Nur mit Frank war Irina nie zurechtgekommen, die beiden waren wie Katz und Maus gewesen.
Maren trocknete sich ab, rieb sich mit ihrer Chanel-Bodylotion ein. Sie machte alles automatisch, spürte nicht, was sie tat. Irgend etwas in ihrem Kopf begann zu brodeln. So konnte es einfach nicht weitergehen. Seit Wochen schleppte sie sich durch die Gegend wie ein Kartoffelsack, schwer, stumpf, mit sich uneins. Sie reagierte gereizt auf Frank und die Kollegen, konnte schlecht einschlafen.
Vielleicht konnte sie mit Eberhard darüber reden. Der machte immer so einen überlegenen, ausgeglichenen Eindruck. In ihren ersten Monaten beim Sender hatte er ihr häufig geholfen, ihr gut zugeredet, wenn sie zitternd vor dem Computer gesessen und nicht gewußt hatte, wie sie in einer halben Stunde einen Beitrag schreiben sollte, hatte wohlmeinend ihre Fehler korrigiert, ihr Anregungen für neue Ideen gegeben und ihre Position bei den anderen Kollegen gestärkt. Eberhard war ein echter Freund.
Glücklicherweise fand sie ihn völlig unerotisch mit seiner eckigen schwarzen Brille, seiner Halbglatze und seinem Bäuchlein; damit waren ihnen amouröse Verwicklungen erspart geblieben. Ob er das allerdings auch so empfand, war ihr nie klar geworden. Sie wollte es auch nicht wissen. Sie brauchte Eberhard. Er stand über den Dingen.
Eberhard biß in ein Gummibrötchen und musterte sie mit einem nachdenklichen Blick aus seinen klugen grauen Augen, genau wie Maren es sich erhofft hatte. Sie rührte nervös in einer Tasse Kaffee und würgte ab und zu einen Bissen von einem trockenen Stück Streuselkuchen hinunter. In der Kantine des Senders roch es wie immer widerlich nach Gulaschsuppe. Gestreßte Kollegen hetzten vorbei und grüßten flüchtig, andere rauchten Kette und ereiferten sich über Entscheidungen des Programmdirektors. Zum ersten Mal fiel ihr auf, wie angespannt und ungesund die meisten aussahen.
»Es ist – ich hab’ einfach an nichts mehr Spaß«, sagte Maren mit gesenktem Kopf.
Eberhard kaute. Dann schluckte er das Stück Brötchen hinunter und sagte: »Willst du dir mal meine Sendung über Gregory Isaacs anhören?«
Sie nickte, achselzuckend. »Ja, schon.« Was so viel hieß wie: Sag mir doch bitte, was ich tun soll.
Eberhard tat ihr den Gefallen. »Du solltest mal raus aus allem«, sagte er. »Fahr nach Jamaika. Das ist ein Land mit Heilkraft. Und fahr allein. Zwischen dir und deinem Kerl stimmt was nicht.«
Maren stieg das Blut ins Gesicht. »Wie meinst du das?« fragte sie wütend. Sie würgte an dem Wissen, daß er womöglich recht haben könnte.
Eberhard zuckte leicht die Achseln. »Ich kann’s dir nicht erklären«, sagte er. »Es ist was, das man spürt. Du hältst etwas zurück. Du lebst nur auf halber Flamme. Warum, weiß ich nicht. Aber ich glaube, daß es dir deshalb jetzt schlecht geht.« Er verspeiste den Rest des Brötchens, fragte: »Willst du den Kuchen noch essen?«, und als sie wortlos den Kopf schüttelte, scham- und wutrot, daß er sie quasi als Lügnerin hatte entlarven können, sagte er: »Komm, wir hören uns die Sendung an« und stand auf.
Sie erhob sich auch, widerstrebend jetzt, und sie marschierten eine Weile stumm nebeneinander her durch die gesichtslosen grauen Flure mit dem schleimgrünen Linoleumboden.
»Ich weiß, daß du jetzt gekränkt bist«, brach Eberhard irgendwann das Schweigen, »aber du hast mich gefragt. Außerdem beobachte ich schon seit einer Weile, daß du immer verschlossener wirst. Das steht dir überhaupt nicht. Ist doch ein Jammer um so ein nettes Mädchen.« Er grinste entwaffnend und hielt ihr die Tür zu seinem Büro auf.
Wider Willen mußte sie ein bißchen lachen, dann tief seufzen. Er hatte wahrscheinlich recht. Aber es war erschreckend, darüber nachzudenken. Nach vier Jahren Beziehung, einem Jahr Ehe am Ende? Und das scheinbar ohne Grund?
Aber während sie auf dem Besucherstuhl saß, Eberhard in seinen Regalen nach dem Band kramte, schossen Erinnerungen wie Schocktorpedos durch ihr Hirn: wie sie schon in der Frühzeit ihrer Beziehung Eigenarten von Frank als extrem störend empfunden, aber nicht darüber gesprochen hatte, aus Feigheit, wie ihr jetzt klar wurde; wie ihre Stimme im Laufe der Jahre immer härter geworden war, wenn sie mit Frank sprach – sie wußte auch immer, was kommen würde von ihm, sie war nie mehr überrascht oder neugierig; wie sie deshalb insgeheim eine gewisse Verachtung empfand, und da er das sicher wußte, hatte er begonnen, sie auf seine Weise zu piesacken, sie als hysterisch zu brandmarken, wo es ging; wie endlich auch ihr Körper sich bei ihm nur noch die nötige Entspannung verschaffte. Sie war nie mehr bereit für Abenteuer, auch hier wußte sie, wie es passieren würde, und sie hatte sich eingeredet, befriedigt zu sein. Höhenflüge gab es keine, und plötzlich spürte sie die lange verhohlene Sehnsucht danach, nach der ganzen Kraft, der ganzen Lebendigkeit, der ganzen Fähigkeit zur Lust. Sie war niemals dort angekommen, wo sie immer hingewollt hatte, aber weil Frank und sie so gut zusammenzupassen schienen, hatte sie sich etwas vorgemacht. So ein hübsches Paar, hatten sie immer wieder gehört: beide groß, schlank, Frank breitschultrig, mit einem klassisch gutaussehenden Gesicht, sie dunkelblond, langbeinig, mit großen Augen, einer geraden Nase, einem Mund, den sie selbst aber immer etwas zu schmal fand. Überhaupt fand sie sich zu eckig, zu knochig, zu unfeminin. Ihre Kolleginnen beneideten sie um ihre Figur, aber ihr waren ihre Brüste zu klein, ihre Hüften zu schmal, ihr ganzer Körper zu fest. Sie wäre lieber ausladend, üppig, offensichtlich sinnlich gewesen. Wie Irina.
Sie spürte plötzlich, daß ihre Schultern schmerzten von der vielen Schreibtischarbeit, daß ihr Magen wehtat, daß sie sich unendlich müde fühlte.
»Love me or leave me, girl«, drang eine schmeichelnde, seltsam süße und doch männliche Stimme an ihr Ohr. Der Damm brach.
»Einer seiner besten Songs ist ›Everything’s gonna be allright‹«, sagte Eberhard und reichte ihr ein Tempotaschentuch.
Sie quälte sich durch die nächsten Tage, schwer von dem schwelenden, gärenden Wissen, daß sie eine Entscheidung treffen mußte. Sie saß mit Frank beim Frühstück, löffelte ihr Kraftmüsli, das ihr nicht schmeckte — sie aß überhaupt nichts mehr gern, alles schmeckte strohig und künstlich -, und versuchte ein Gespräch aufrechtzuerhalten. Frank spürte, daß etwas nicht in Ordnung war, aber er fragte nicht nach. Er wußte nicht, wie man so etwas machte.
Abends sagte sie, sie sei müde, und drehte sich auf die Seite. Am dritten Abend hatte sie nicht mehr die Kraft dazu und fügte sich in einen lieblosen Geschlechtsakt; ihr war dabei zumute, als sei sie aus Zement und habe die verdammungswürdigste aller schwarzen Seelen. Sie war ein Unmensch. Sie log und betrog, aber sie hatte auch solche Angst vor dem Alleinsein und solche Angst vor Franks Reaktion. Andererseits: Sollte sie den Rest ihres Lebens vor sich hinvegetieren, in einem hart gewordenen Körper, mit einem ummauerten Geist, bis an ihr Lebensende?
Am nächsten Morgen wartete sie, bis Frank zur Arbeit gegangen war, dann legte sie eine Peter-Tosh-Scheibe auf, die sie schon immer geliebt hatte, und hörte »Buckingham Palace«, einen Song voll wilder Sehnsucht, und rebellischer Energie. Danach rief sie Irina an. »Irina, hier ist Maren«, sagte sie in die leere Leitung hinein, nachdem die Freundin sich gemeldet hatte.
»Maren«, sagte Irina. Sie klang überrascht, nachdenklich und leicht alarmiert. Sie spürte, daß die Lage ernst war. Das Verständnis zwischen ihnen funktionierte, ganz wie früher. »Was ist los?«
»Ich brauche deinen Rat«, sagte Maren und erzählte, wie ihr schien: wirr und unzusammenhängend, von den letzten Wochen.
Sie sprach eine halbe Stunde mit Irina. Dann legte sie auf, vervollständigte ihr Make-up und ging zur Arbeit. Sie bearbeitete ein Manuskript für eine bevorstehende Sendung, vergab zwei weitere Themen, tippte ein paar Briefe und machte einen Zeitplan. Was mußte getan werden, wenn sie fünf Wochen wegsein würde? Sie rief Eberhard an und sagte: »Ich werde deinen weisen Rat befolgen. Ich fahre nach Jamaika. Kannst du mir ein paar Tips geben?«
Kurz darauf klappte die Tür. Eberhard kam herein, grüßte charmant die Sekretärinnen im Vorraum, die ihn ungeachtet seines sonderlichen Äußeren — heute trug er wieder ein Paar ausgebeulte braune Cordhosen und ein graues Tweedjackett mit einem blaugelb gemusterten Hemd dazu — geradezu liebten. Seine Brillengläser funkelten. Es konnten aber auch die Augen sein. »Lady«, sagte er und ließ sich auf den Besucherstuhl fallen, »du machst es richtig. Ich hab’ dir was mitgebracht.« Er schob ihr zwei Kassetten über den Tisch. Auf der einen stand »Queen of the Mountain«, auf der anderen »Feeling Irie«. »Wirst du brauchen können«, sagte er. »Burning Spear und der Cool Ruler, wie sie Gregory dort nennen. Hör gut hin, da lernst du was über das Land.«
»Danke«, sagte Maren und schaute auf die Tischplatte, um ihre Rührung zu überspielen.
»Und mach die Jungs da nicht fertig«, grinste Eberhard. »Mit feministischen Anwandlungen haben die nichts am Hut. Da mußt du dich schon darauf einlassen. Jedenfalls«, holte er aus, »ich denke, daß es am besten für dich ist, erst mal nach Negril zu fahren. Du wirst wahrscheinlich in Montego Bay landen. Dann schnappst du dir eine dieser Rostschüsseln, die vor dem Flughafen herumstehen, das sind die Taxis. In einer Stunde bist du am schönsten Sandstrand, den du je gesehen hast, und blickst auf das türkisblaueste Meer, das dir je untergekommen ist. Ich denke«, er kratzte sich am Kopf, »du solltest im ›SamSara‹ wohnen. Das gehört Sara, einer weißen Amerikanerin. Ist so ein bißchen geschützte Atmosphäre, was am Anfang bestimmt für ein zartes Mädchen ganz gut ist. Ich kann Sara anrufen, wenn du möchtest. Von da aus kannst du dir das Land selbst erobern. Wie klingt das?«
»Hervorragend.« Maren stockte. »Danke, Eberhard. Für alles. Mir geht’s schon viel besser.«
»War mir ein Vergnügen. Leidende Kolleginnen setzen mir immer fürchterlich zu. Gib auf dich acht, Kleines«, er zwinkerte, »und genieß es. Ich erwarte die ultimative Coolness bei deiner Rückkehr.« Er hob in einer stoisch-lässigen Geste die Hand und wanderte von dannen, nicht ohne von den Sekretärinnen ein seliges »Wiedersehen, Herr Herzinger« hinterhergezwitschert zu bekommen.
Etwas in Maren jubelte und hüpfte auf und ab vor Freude. Es konnte losgehen. Sie würde neu anfangen. Sie würde Abenteuer erleben. Sie würde erwachsen werden. Sie würde für sich selbst verantwortlich sein. Sie war frei. Nur die Aussprache mit Frank stand noch bevor. Aber sie würde sich nicht beirren lassen, nicht durch ihre Ängste, nicht durch seine Fassungslosigkeit. Und nach der Arbeit würde sie ihr Ticket buchen. Damit es kein Zurück mehr gab.
Montego Bay. Mandeville. Jamaika. Namen, die ihr auf der Zunge zergingen, die Klischeebilder von säuselnden Palmen, strahlenden schwarzen Mädchen, stolzen schwarzen Männern in ihr aufsteigen ließen; Piraten, weißer Sand und eine verträumte Leichtigkeit wie in der Rum-Werbung im Kino. Würde es so sein? Karibik. Sie starrte auf eines dieser lockenden Plakate, während sie im Reisebüro auf ihre Buchung wartete. »Den nächstmöglichen Termin«, hatte sie gesagt. Die junge Frau, die sie bediente, hatte sie kurz gemustert, aber nichts geäußert. Nur später, als entschieden war, daß sie in vier Tagen würde fliegen können, hatte sie gelächelt, ihr viel Spaß gewünscht und gesagt: »Es ist sehr schön dort.«
Der leitende Redakteur hatte zuerst die Augen aufgerissen und dann die Stirn gerunzelt. »Wie stellen Sie sich denn das vor?« hatte er zuerst wissen wollen. Maren hatte ihm kategorisch erklärt, wie sie es sich vorstellte. Und daß sie seit zwei Jahren keinen längeren Urlaub mehr gehabt und der vor kurzem eingestellte Volontär hier eine Möglichkeit habe, sich zu bewähren. Er sei pfiffig und interessiert, hatte sie fest gesagt, und alles andere müsse eben ohne sie gehen. Sie werde alles vorbereiten. Nach der unvermeidlichen Showeinlage vom Anfang hatte er dann geseufzt, ihr gesagt, daß er sie gut verstehen könne, und ihr einen schönen Urlaub gewünscht. Das war das.
Sie nutzte erstmalig ihren Dispo-Kredit. Wozu war das blöde Ding schließlich da? In ihrem Lieblings-Dessous-Laden kaufte sie einen melonenroten, an den Beinen hoch geschnittenen Bikini mit einem Oberteil, das ihre Brüste ein klein wenig hochdrückte und somit üppiger wirken ließ, und denselben noch mal in Azurblau und Meergrün. Dann durchstreifte sie die Boutiquen und die besseren Kaufhäuser und kaufte weiche Safarihosen, bunte Viskoseröcke, zwei Kleider mit schmalen Trägern und weitschwingendem Rock, kurzärmelige Baumwollblusen, Seiden-T-Shirts, geflochtene Gürtel, Sandaletten, Mokassins und ein paar Cowboy-Stiefel aus Leguanleder, und das alles, während um sie herum bleiche Menschen Wintermäntel und Rollkragenpullover anprobierten.
Sie wurde beinahe übermütig. Als sie, mit Plastiktaschen beladen, an einem Waffengeschäft vorbeikam, fiel ihr Blick auf ein riesiges Schweizer Armeemesser im Fenster. Sie blieb stehen und betrachtete es. Eine Lederhülle, die man an den Gürtel schnallen konnte, gehörte dazu. Zig kleine Metallfeilen, -sägen, -scheren ragten aus dem Messer heraus. Sie kaufte es. Das Messer schien ihr unerläßlich, und wenn sie es nur zum Flaschenaufmachen benutzen würde.
Sie trug die Taschen zum Auto, verstaute sie und schloß wieder ab. Nun fehlte ihr nur noch ein Gegenstand zu ihrer Ausrüstung. Auch darauf wollte sie nicht verzichten. Sie hatte schon lange einmal wissen wollen, wie so ein Ding sich anfühlte, und welche junge Frau verreiste heute schon ohne? Das war doch eine Selbstverständlichkeit.
Mulmig war ihr trotzdem. Von Entspanntheit konnte keine Rede sein, als sie durch die Tür des Sex-Shops trat. Sie grüßte freundlich eine alte Frau, die an einem erhöhten Tisch am Eingang saß und gelangweilt ein Magazin durchblätterte. Gott sei Dank, eine Frau. Aber da hinten stand ein Mann, der sie jetzt auch noch musterte! Der Laden war zum Glück relativ übersichtlich, so daß Maren mit kurzem Panikblick die gesuchten Gegenstände in verschiedenen Ausführungen ausmachen konnte. Betont selbstsicher steuerte sie zu dem betreffenden Regal, griff ohne viel Überlegen – die meisten waren ohnehin indiskutabel widerlich, igitt, fleischfarben mit Noppen und naturgetreu gekrümmt! – zu der zierlichen schwarzgoldenen Ausführung »Lady« und marschierte damit zur Kasse. Nun war sie stolze Besitzerin eines Vibrators. Als sie aufatmend auf die Straße trat, sah sie vor ihrem geistigen Auge Irina, wie sie lächelnd den Daumen hochreckte.
Gut gemacht, Mädel.
Es kam, wie es kommen mußte: Eigentlich geschah nicht viel, und ihnen beiden wurde klar, wie sehr sie sich auseinandergelebt hatten, ohne es zu merken. Frank nahm sich einen Cognac, hockte sich in den Sessel und starrte sie an. Maren war einerseits ganz übel von der Anstrengung, den Satz »Wir müssen uns trennen« herausgewürgt zu haben, andererseits war sie unendlich erleichtert, auch weil Frank weder tobte noch in Tränen ausbrach. Er saß einfach nur da und trank den Cognac. Dann erzählte er ihr, daß er vor ein paar Wochen eine Affäre mit einer anderen Frau gehabt habe. Stich in die Magengegend. Aber sie merkte: So schlimm war es gar nicht. Denn auch er hatte stumm gelitten. Nur miteinander hatten sie nicht mehr reden können. Weil sie nichts mehr voneinander wollten. Frank sah unglücklich und elend aus, aber nicht so, als ob er zerbrechen würde an der Situation. Er schien im Gegenteil schon so etwas wie einen Hoffnungsschimmer in den Augen zu haben. Neben Wut, Gekränktheit und Traurigkeit, okay. Aber so leicht fiel es ihr auch nicht. Bis zum letzten Moment vor ihrem Abflug kamen ihr Zweifel, die allerdings immer von einer berauschenden Erleichterung und Neugierde auf das, was vor ihr lag, überdeckt wurden.
Und so marschierte sie beschwingt, mit den neuen Stiefeln an den Füßen und Eberhards Tapes im Handgepäck, ins Flugzeug, fühlte sich zum ersten Mal seit Wochen wieder vollständig, griffig und leicht. Erwartungsvoll. Sie hörte Burning Spear und schaute hinunter auf Alaska, aß mit Begeisterung die Fertigmenüs und schaute Bordkino, las ihren Reiseführer über Jamaika mit den atemraubenden Dschungelbildern, schlief unruhig und starrte schließlich gebannt auf ein aquamarinblaues Meer, über dem der Flieger beidrehte, bevor er schließlich waghalsig auf einem winzigen Flugplatz zum Halten kam.