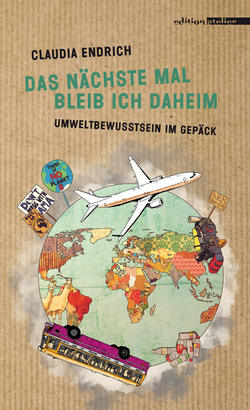Читать книгу Das nächste Mal bleib ich daheim - Claudia Endrich - Страница 10
UNSER NEUES ZUHAUSE
ОглавлениеAls wir uns nach zwei Wochen Andentour von Toms Vater am Flughafen verabschieden und ohne ihn mit dem öffentlichen Bus nach Lima zurückkehren, bin ich nach zweiundzwanzig Stunden Fahrt und nach eineinhalb Monaten des Reisewahnsinns mehr als erleichtert, endlich, endlich in meinem neuen Zuhause anzukommen. Für peruanische Verhältnisse ist die Wohnung ein wahrer Palast, frisch renoviert, mit Balkon und gut abgesichertem Eingangstor. Tom hat sie spärlich, aber sehr liebevoll und völlig ausreichend möbliert, mit einer Mischung aus Ausgeliehenem, Gebrauchtem und Selbstgebasteltem aus Altholz und Gemüsekisten vom Markt. Was bei uns als hip gelten würde, ist hier einfach nur gesunder Menschenverstand. Stolz präsentiert Tom mir den kleinen rosa Handspiegel, den er im ansonsten spiegellosen Badezimmer für mich installiert hat. Wir finden unsere Upcycling-Regale und die schon etwas von Termiten befallenen Schränke großartig und freuen uns allgemein, dass wir in den nächsten Monaten extrem energiesparend leben werden: So wie alle in Peru haben wir einen Gasherd, Heizungen gibt es hier nicht, Warmwasser ebenso nicht. Das kalte Duschen ist etwas gewöhnungsbedürftig, vor allem bei sechzehn Grad Tagestemperatur. Wir entscheiden uns außerdem gegen die Anschaffung eines Kühlschranks – vier Monate werden wir es wohl ohne aushalten. Dafür müssen wir akzeptieren, dass es in Peru praktisch keine Mülltrennung gibt. Mit etwas Mühe und viel Nachfragen erfahren wir nach einigen Wochen, dass es eine Sammlung für Recyclingmüll gibt. Die Abholzeiten der Müllsäcke sowie das vorherrschende Trennungssystem durchschauen wir bis zum Schluss nur schwer. Lima versinkt im Plastik. Jedes Gewürzsäckchen wird nochmals in ein Plastiksäckchen verpackt, sich gegen das Einpacken oder sogar doppelte Einpacken zu wehren, ist oft mühsam oder unmöglich. Die Bea Johnsons der heilen Zero-Waste-Welt behaupten immer, verpackungsfrei einzukaufen sei total einfach. In Ländern, wo alles auf Märkten verkauft wird, noch viel leichter. Ich schäme mich also für meine Inkonsequenz, dass ich zwar versuche, früh genug »Sin bolsa, por favor« zum Verkäufer zu sagen, aber dann nicht protestiere, wenn er aus jahrelanger Gewohnheit zum Plastiksack greift. Tom tröstet mich zwinkernd: »Wir brauchen die sowieso als Müllsäcke.« Ich schaue ihn daraufhin nur strafend an. Manchmal marschiere ich ganz stolz mit einer Tupperdose zum Laden an der Ecke und lasse mir Frischkäse vom großen Laib herunterschneiden, reiche die Dose über den Tresen und bitte die Verkäuferin, den Käse dort hineinzugeben. Als ich die Dose zurückbekomme, liegt der Käse darin – in einer Plastikfolie. Mit der Zeit wird es besser, denn ich kenne die Leute, bei denen ich einkaufe, ihre Gewohnheiten und weiß, wie ich es anstellen muss, damit ich zu meiner verpackungsfreien Ware komme. Und so kapiere ich auch: Am ökologischsten und ressourcenschonendsten ist Routine. Überall, wo ich neu und fremd bin und die Alternativen noch nicht kenne, muss ich das Angebot zuerst so nutzen, wie ich es vorfinde. Nach über einem Monat in Lima erfahren Tom und ich von einem wöchentlichen Biomarkt in unserer Nähe, bei dem wir von da an regelmäßig einkaufen gehen.
Avenida Jirón Libertad Número 683, das ist unsere erste gemeinsame Wohnung. Wir genießen die Zweisamkeit, die wir lange vermisst haben. Trotzdem ist das halbe Jahr, das Tom und ich getrennt voneinander verbracht haben, wie im Flug vergangen. Mir kommt es vor, als hätte ich gerade erst gestern am Flughafen in Ottawa unter tausend Tränen von Tom Abschied genommen, und doch haben wir beide in der Zwischenzeit so vieles erlebt. Es ist meine Idee gewesen, zeitgleich einen Studienaustausch an verschiedenen Orten zu beginnen. Ich fühlte mich durch meine vielen Reisen und einen Vorsprung von zwei Lebensjahren bemüßigt, eine Grundregel aufzustellen: Die Erfahrung, allein in einem fremden Land nur unter fremden Leuten zu sein, die darf auch Tom nicht auslassen. Zu prägend, zu lebensverändernd war das für mich selbst. Der ideale Plan kristallisierte sich nach und nach heraus: Tom würde mit mir nach Kanada fliegen und den ersten Monat mit mir verbringen, um dann nach Peru weiterzureisen. Nach einem Semester würde ich nach Peru kommen und die restliche Zeit dort mit ihm verbringen. Wir dachten an all die Vorteile unseres Reisemanövers: Wir würden das neue Umfeld des jeweils anderen kennenlernen, einander gut verstehen, wenn wir emotional Ähnliches durchleben, und niemand würde sich zu Hause sitzend im Stich gelassen fühlen. Das alles trug wirklich zum Erfolg unserer Fernbeziehung bei, doch der wesentlichste Punkt wurde mir erst bewusst, als ich die wenigen Wochen zwischen Kanada und Peru in Europa verbrachte: Zwischen Ottawa und Lima lag nur eine Stunde Zeitunterschied. Ein halbes Jahr lang erreichten Tom und ich uns praktisch problemlos abends vor dem Schlafengehen auf Skype. Während ich drei Wochen in Österreich war und die Zeitverschiebung plötzlich sechs Stunden betrug, sprachen wir viel seltener miteinander. Oft blieb dann eine Person enttäuscht zurück, wenn das Gespräch abrupt endete, weil der oder die andere noch etwas vorhatte. Da wurde mir klar, was uns außer unserer Liebe durch diese Zeit getragen hat – eine simple Uhrzeit, die es uns ermöglichte, trotzdem gemeinsam durch den Alltag zu gehen.
Tom zeigt mir sein Lima, all das, wovon er mir auf Skype erzählt hat, und ich fühle mich in den ersten Wochen als Besucherin, die diese fremde Stadt besichtigt. Es ist eine Stadt voller Ruß und Dreck, voller Lärm und Lichter, voller Flugzeuge, die man zwar ständig hört, aber vor lauter Smog nicht sieht. Eine Stadt voller Möglichkeiten, die man sich entweder nicht leisten kann oder zu denen man zu spät kommt. Eine Stadt voller Armut und extremem Reichtum, voller Alarmanlagen und Mauern um die Häuser. Ein etwas verrückter Mann lebt in unserem Viertel, er spielt den Straßenartisten, ohne wirklich etwas zu können, hält die Autos auf, tänzelt und lächelt dämlich dabei. Dann winkt er allen lustig zu, und nächstes Mal sehe ich ihn an einer anderen Kreuzung mit einem riesigen Plastikflieger Kunststücke vorführen. Manchmal ist er auch mit einem riesigen Holzkreuz auf der Schulter unterwegs. Mit seinem langen, grauen Bart, den zerrissenen Kleidern und den Sandalen aus alten Autoreifen sieht er tatsächlich aus wie ein kurz vor der Pensionierung stehender Jesus. Die Leute halten ihn für verrückt. In dieser Stadt erscheint er mir ganz normal.
Nach und nach beginne ich, mich hier einzuleben. Die Frau vom Laden unten, der Bäcker gegenüber, der Bettler an der Straßenecke, die Leute kennen mich inzwischen und grüßen. Die Gringa fällt natürlich auf, nicht nur weil sie selten Plastiktaschen annimmt, sondern auch optisch. Alle sind freundlich zu mir. Wenige hier im Viertel dürften so zuverlässige Kunden sein wie ich, die junge weiße Frau, die noch dazu selten einen Preis nachverhandelt. Doch mit der Zeit lerne ich, mich auf dem Markt beim Kauf von Früchten und Gemüse nicht linken zu lassen und, wenn schon nicht den Preis der Einheimischen, dann doch zumindest einen besseren Preis als den üblichen Touristentarif zu bekommen. Als Tom wieder zur Uni muss, habe ich plötzlich wahnsinnig viel freie Zeit, allein. Mir beginnt aufzufallen, dass ich nun seit fast vier Wochen in Lima bin und immer noch kein einziges Mal die Sonne gesehen habe, weil der versmogte Winterhimmel hier konstant grau ist. Es wird Zeit, dass ich mir eine Beschäftigung suche, oder zumindest ein Hobby, einen Sport, Leute, denen ich mich anschließen kann. Auf Studentenpartys von Toms Uni lerne ich nach und nach Leute kennen, mein Spanisch ist dafür gut genug und Schüchternheit schon lange kein Thema mehr. Meine erste Frage, so wie überall, wo ich hinkomme, lautet bald: »Wo kann man hier tanzen gehen?«. Tanzen ist für mich wie atmen, es ist mein Ventil und meine Meditation. In Südamerika sollte es doch hoffentlich leicht möglich sein, andere Tanzbegeisterte zu finden. Doch auch das braucht Zeit, denn die Leute, die mir versprechen, mich in ein paar gute Clubs mitzunehmen, leben nicht nach mitteleuropäischem Terminkalender. Es dauert also ein paar Wochen, bis ich einige Tanzlokale kennenlerne und sie auch gut genug kenne, um notfalls alleine hingehen zu können. Meine neu gewonnenen Freunde nehmen mich außerdem mit zu Akrobatik-Trainings, womit ich bisher kaum etwas zu tun hatte. Auch das macht mir viel Spaß. Was mich aber von Anfang an deprimiert, ist zu wissen, dass das alles nicht lange anhalten wird.
Noch vor einem halben Jahr habe ich mir auf die gleiche Art in Kanada einen Alltag aufgebaut: Sport, Freunde, Partys. Ich war am Ende traurig, das alles zurücklassen zu müssen, ich vermisse manchmal die Orte und Menschen, die ich regelmäßig besucht habe. Zu manchen halte ich Kontakt über Facebook, WhatsApp oder Skype, viele verliere ich schnell wieder aus den Augen. Es sind Vorgänge, die in unserer globalisierten Welt schon normal sind. Wer hält denn heute noch jahrelang Brieffreundschaften à la Jane Austen mit einer Person, der er ein, zwei Mal begegnet ist? Bei manchen Bekanntschaften erwische ich mich aber auch bei dem Gedanken: »Zum Glück haben wir den maximal ein paar Monate am Hals«, und ich erschrecke über meine eigene Abgebrühtheit. Sind Menschen für uns schon so austauschbar geworden wie H&M-Klamotten? Oder will ich mich selbst nur vor dem nächsten Abschiedsschmerz schützen, wenn ich mich auf neue Menschen schon gar nicht mehr richtig einlasse? In Kanada habe ich eine Bekannte aus Wien getroffen, die für ihr Doktorat einige Monate dorthin gezogen ist. Ich fragte sie, wie sie sich eingelebt hat, und sie meinte nur: »Ich hab mir wieder einen Judo-Verein gesucht, die Kollegen in der Arbeit kennengelernt, und dann war’s eh ›Geht schon weiter, normales Leben halt!‹«. Ich war fasziniert. So einfach und unkompliziert sah sie das?! War sie blind oder ich so kompliziert? Ich habe mir auch wieder Möglichkeiten gesucht, um Sport zu treiben und Studienkollegen kennengelernt, aber deshalb führe ich doch nicht gleich wieder das gleiche Leben wie zu Hause – oder? Menschen zu finden, die tatsächlich mit mir auf derselben Wellenlänge sind, denen ich Vertrauen schenke, braucht Zeit. Ich finde den halbjährlichen Wechsel meines Freundeskreises bereits anstrengend. Ich muss an meinen Vater denken, der von jeder seiner Reisen neue Kontakte mitbringt und der an seinem Geburtstag immer ganz stolz aufzählt, aus wie vielen Ländern er bereits Grüße auf Facebook erhalten hat. Dabei weiß ich nur von einer Person, mit der er seither tatsächlich eine feste Freundschaft aufgebaut hat. Und wenn man ihn nach der Zeit des Reisens fragt, dann gibt auch er zu: Viele Abende verbringst du unterwegs trotzdem mit dir selbst. Wie muss es denn jenen gehen, die monate- oder jahrelang permanent ihren Aufenthaltsort wechseln? Reisende sind ständig unter Menschen und doch oft furchtbar allein.