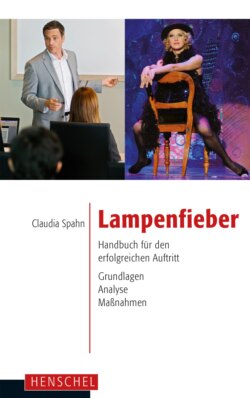Читать книгу Lampenfieber - Claudia Spahn - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеGrundlagen
Was ist Lampenfieber?
Eine der ältesten literarischen Quellen, in der die Aufregung eines Vortragenden zu Beginn einer Rede beschrieben ist, findet sich 55 v. Chr. bei Marcus Tullius Cicero in seiner Schrift »Über den Redner« (»De oratore«). Hier hören wir aus dem Munde des Redners Lucius Licinius Crassus: »Was mich betrifft, so stelle ich gewöhnlich bei euch fest und mache auch an mir selbst sehr oft die Erfahrung, dass ich bei den ersten Worten einer Rede vor Angst erbleiche und von ganzem Herzen und an allen Gliedern bebe …« (Cicero, 2007, S. 58).
Die Situation, sich vor anderen Menschen zu exponieren, löst in uns allen ein ähnliches Programm aus. Wir spüren dies durch eine erhöhte Körperspannung, eine stärkere Konzentration und Aufmerksamkeit sowie durch ein intensiviertes Gefühlserleben. Es handelt sich dabei um einen ganz eigenen, besonderen Zustand, in dem wir uns sonst kaum befinden. Jeder Mensch erlebt diesen im Laufe seines Lebens, denn Präsentationssituationen wie Referate in der Schule oder Reden und Ansprachen bei festlichen Anlässen sind fester Bestandteil unserer Kultur. Darüber hinaus gibt es Berufsgruppen, die sich regelmäßig und in besonderer Weise vor anderen exponieren und deshalb umfangreiche Erfahrungen im Umgang mit Auftrittssituationen erwerben. Zu diesen zählen insbesondere Künstler in den Bereichen Musik, Schauspiel und Tanz, aber auch in Kommunikationsberufen Tätige wie Lehrer, Pfarrer, Journalisten, Manager, Politiker u.a. Entsprechend verschieden können auch die Auftrittsorte sein: vom Besprechungs- und Klassenzimmer über einen Hörsaal oder eine Kirche bis hin zur Bühne eines Konzertsaals oder Theaters. Ähnlich variabel ist die Zahl und Zusammensetzung der Zuschauer und Zuhörer.
Als eigener Begriff für den bereits bei Cicero beschriebenen Zustand tauchte im 19. Jahrhundert der Begriff »Lampenfieber« im deutschen Sprachraum auf. Etymologisch entstand er aus dem Wort »Lampen«, welches im 13. Jahrhundert aus dem französischen Wort lampe für Beleuchtungsmittel entlehnt wurde, und dem Wort »Fieber«, womit eine »fieberhafte Körperreaktion« gemeint war. In der zusammengesetzten Wortbedeutung beschreibt damit »Lampenfieber« den Zustand, der sich unter der Beleuchtung der »Lampen« auf der Bühne einstellt. Im »Etymologischen Wörterbuch« (Kluge, 1989) finden wir den Eintrag: »Aufregung vor dem öffentlichen Auftreten«.
»Lampenfieber« hat sich bis heute in unserem Sprachgebrauch erhalten. Äquivalente Bezeichnungen sind im Spanischen fiebre de candilejas, im Italienischen febbre della ribalta, im Französischen le trac sowie im Anglo-Amerikanischen stage fright. Die spanische Bezeichnung bezieht sich – wie der deutsche Begriff – direkt auf die Bühnenlampen (candilejas), die italienische auf die Bühne bzw. die Rampe selbst (ribalta). Der französische Begriff soll sich vom Verb traquer ableiten, was »jemanden jagen bzw. hetzen« bedeutet; in der Jägersprache heißt es entsprechend traquer un animal, »ein Tier treiben oder umstellen« (Le Corre, 2006). Kurt Tucholsky griff unter seinem Pseudonym Peter Panter in einem Artikel mit dem Titel »Lampenfieber«, den er 1930 für die Weltbühne verfasste, diesen französischen Begriff auf und formulierte: »Lampenfieber heißt ›trac‹ auf französisch. Der kleine zuckende Laut gibt den Peitschenschlag der Nerven gut wieder (…)«. Die englische Bezeichnung stage fright akzentuiert neben dem Begriff der Bühne den Schrecken und die Angst.
In den verschiedenen Ländern begegnet man interessanten Spuren des Lampenfiebers. So zeugt das Schild mit der Aufschrift »salle du trac«, das neben der Tür zum Einspielraum im Conservatoire Supérieur de Paris (CNR) angebracht ist, von der Präsenz des Lampenfiebers im Leben der jungen Musiker (Abb. 1). Dieser »Lampenfieber-Raum« hat schon viele Menschen mit unterschiedlichen Instrumenten gesehen, die sich auf Prüfungen vorbereitet haben. Le trac – Lampenfieber – hatten sie alle. Denn im »salle du trac« spielt man sich ein, bevor die Jury zum Vorspiel in den Konzertsaal bittet.
Auch im englischen Sprachgebrauch gibt es einen solchen Raum, der auf das Phänomen Lampenfieber hinweist, nämlich den sogenannten green room, in dem sich die Künstler hinter der Bühne aufhalten, wenn sie auf den Auftritt warten. In Künstlerkreisen wird gemutmaßt, dass hinter diesem Begriff eine Anspielung auf die grünliche Gesichtsfarbe stehe, die an manchen Künstlern vor dem Auftritt zu beobachten ist. Etymologisch ist dies vermutlich jedoch nicht korrekt, da sich der Begriff wohl eher von der grünen Wandfarbe des hinter der Bühne befindlichen Aufenthaltsraumes eines Londoner Theaters zur Zeit Shakespeares ableitet.
Abb. 1: »salle du trac« im Conservatoire Supérieur de Paris (CNR)
Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Lampenfieber ist heute im deutschen Sprachgebrauch einer gewissen begrifflichen Unschärfe gewichen. Im Alltagsverständnis wird Lampenfieber – sowohl unter Künstlern als auch in anderen Berufen – unterschiedlich interpretiert: Die einen stellen sich etwas Positives darunter vor – im Sinne von »auf etwas hinfiebern« –, andere halten es für eine problematische Erscheinung – im Verständnis des Fiebers als Krankheitszeichen. Selbst in der wissenschaftlichen Literatur wird der Begriff Lampenfieber nicht eindeutig verwendet (Brodsky, 1996; Möller u. Castringius, 2005).
Was passiert bei Lampenfieber?
Die Erscheinungen des Lampenfiebers können bei jedem Menschen verschieden ausgeprägt sein oder wahrgenommen werden. Betrachten wir Lampenfieber in seiner Phänotypie systematisch, so lassen sich über die individuelle Ausprägung hinausgehende Gemeinsamkeiten beschreiben. Hierzu gehört, dass sich Lampenfieber auf verschiedenen Ebenen, nämlich auf der emotionalen und körperlichen Ebene sowie auf den Ebenen des Denkens und Verhaltens äußert. Einen Überblick über die häufigsten Anzeichen von Lampenfieber fasst Tabelle 1 auf der folgenden Seite zusammen.
| Körper | Gefühl | Denken | Verhalten |
| schneller Herzschlag | intensiviertes Gefühlserleben | Konzentrationsstörungen | unkontrollierte Körperhaltungen und -bewegungen |
| schneller und flacher Atem | Angst und Panik | negative Gedanken und Erwarten von Katastrophen | bereits in der Vorbereitung die Konfrontation mit dem Auftritt vermeiden |
| kalte und schweißige Hände | innere Aufregung | ständiges Denken an den Auftritt schon Wochen vorher | aggressives Verhalten gegenüber der Umwelt |
| trockener Mund | Hilflosigkeit | über Publikum mit Angst nachdenken | stereotype Verhaltensweisen |
| Erröten oder Blässe | Ausgeliefertsein | sich selbst unangemessen kleinmachen | Auftrittssituation vermeiden |
| Zittern an Armen und Beinen | Verzweiflung | mit Experten im Publikum beschäftigt sein | Überaktivität und Aufgedrehtsein |
| Übelkeit | sich bedroht fühlen | an schwierige Passagen denken | Flucht in äußere Umstände |
| Kopfschmerzen und Schwindel | Scham | unbegründete negative Selbsteinschätzung | sozialer Rückzug |
| Harndrang oder Durchfall | Unlust aufzutreten | Blackout | Blockaden |
Tabelle 1: Häufige Anzeichen von Lampenfieber, geordnet nach den vier Ebenen Körper – Gefühl – Denken – Verhalten; die Kombination der vier Ebenen muss nicht der Anordnung in den Zeilen folgen.
Körperliche Ebene
Die bekannten körperlichen Anzeichen des Lampenfiebers, wie schnelle Atmung und beschleunigter Herzschlag, Mundtrockenheit, Zittern, kalte und schweißige Hände etc., sind Ausdruck eines durch Angst ausgelösten physiologischen Programms. Im Körper kommt es dabei zu einer Aktivierung des sympathischen Teils des autonomen Nervensystems. Angst – fright – als Warnsignal stößt Körperreaktionen an, die zum Ziel haben, die maximale Konzentration und Muskelkraft für Kampf – fight – oder Flucht – flight – bereitzustellen. Man spricht in diesem Zusammenhang von den »drei großen F«. Dieses Programm ist phylogenetisch, d.h. bezogen auf die Entwicklungsgeschichte der Menschheit, bereits sehr alt und trägt der Tatsache Rechnung, dass der Mensch – als ein hinsichtlich seiner Köperkräfte eher bescheiden ausgestattetes Wesen – in Gefahrensituationen schnell und mit höchster Konzentration entscheiden können musste, ob es klüger sei zu fliehen (häufig die bessere Option) oder zu kämpfen (bei fraglichen Erfolgsaussichten nicht selten die ungünstigere Variante). Im Vergleich zum Menschen zeigen z.B. Nashörner keine sichtbaren Anzeichen von Angst, die sie auf eine Flucht vorbereiten, da sie den allermeisten anderen Tieren kräftemäßig überlegen sind. Im Kampf mit dem Menschen gereicht ihnen dies heute zum Nachteil, denn sie laufen auch nicht weg, wenn sich ihnen ein Jäger mit Gewehr nähert.
Das autonome (vegetative) Nervensystem steuert die inneren Vorgänge unseres Körpers wie z.B. Kreislauf, Atmung, Verdauung, Muskeltonus, die nicht direkt oder nur zum Teil unserer Kontrolle unterliegen und nicht ohne Weiteres willentlich beeinflussbar sind. Es besteht aus zwei antagonistisch wirkenden Schenkeln, dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Der Parasympathikus ist stärker aktiv in der sogenannten »Hängemattensituation«: Wir haben gegessen, wir verdauen, sind müde, können uns ausruhen und müssen unsere Aufmerksamkeit nicht auf eine Aufgabe richten. Der Sympathikus überwiegt in Situationen, in denen wir wach, konzentriert und auf körperliche und geistige Aufgaben ausgerichtet, also handlungsbereit sind. Man könnte auch sagen, dass wir bei überwiegend parasympathischer Aktivität mehr nach innen, auf uns selbst und bei überwiegend sympathischer Aktivität mehr nach außen orientiert sind.
Beim Auftritt ist der Sympathikus stark aktiviert und wir finden daher alle Symptome, die uns in die Lage versetzen, »fit« für die auf uns zukommende Aufgabe zu sein (Abb. 2). Ausgehend von der ursprünglichen Kampf-Flucht-Situation wird Energie im Körper bereitgestellt, welche die großen Muskeln der Oberarme, der Beine und des Rumpfes mit Sauerstoff und Nährstoffen aus dem Blut versorgt. Um genügend Sauerstoff aufnehmen zu können und die Atmungsfunktion zu optimieren, werden die Bronchien in der Lunge erweitert und die Atmung wird beschleunigt. Der Mund wird trocken. Um das Blut schneller durch den Körper zu pumpen, nimmt der Herzschlag zu. Das Blut zentriert sich in den großen Muskeln. Gleichzeitig verengen sich die Blutgefäße in der Peripherie des Körpers, besonders an den Händen, sodass wir kalte Hände bekommen. Der gesamte Muskeltonus erhöht sich, durch Zittern wird zusätzliche Körperwärme erzeugt. Die inneren Augenmuskeln sind stärker angespannt, sodass unsere Pupillen sich weiten. Die sympathische Aktivierung bewirkt eine direkte Verstärkung der Schweißsekretion und führt damit u.a. zu schweißigen Händen. Die Blasenfunktion wird angeregt und wir verspüren Harndrang. Die Verdauung wird angehalten, d.h. Nahrung entleert sich entweder überstürzt (Durchfall) oder bleibt im Magen liegen (Übelkeit, Erbrechen).
Die Steuerung dieser vegetativen Funktionen des Körpers erfolgt im Gehirn durch den Hypothalamus. Von hier aus werden Impulse über Nervenwurzelzellen im Rückenmark und über weiterführende Nerven zu den Organen geleitet. Mittels des Hormons Noradrenalin als Überträgerstoff werden dort die oben beschriebenen Effekte ausgelöst. Das bekannte Hormon Adrenalin wird durch Stimulation aus dem Hypothalamus im Nebennierenmark gebildet und direkt ins Blut ausgeschüttet. Die Katecholamine Adrenalin und Noradrenalin bewirken neben den bereits beschriebenen Effekten, dass gespeicherte Energie mobilisiert und Glucose aus dem Blut in die Zelle aufgenommen werden kann. Damit steht für Muskeltätigkeit ausreichend Energie zur Verfügung. Andererseits werden adrenalinvermittelt im Gehirn Denkvorgänge unterdrückt, weshalb es in Auftrittssituationen zu sogenannten Blackouts kommen kann.
Der Adrenalinanstieg kann vor und während des Auftritts zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgen (vgl. Kap. »Wie verläuft Lampenfieber?«, S. 28). Auch der Abbau von Adrenalin nach einem Auftritt verläuft individuell unterschiedlich. Manche Menschen sind direkt danach müde und haben ein Schlafbedürfnis, andere sind noch Stunden hellwach und können nur sehr langsam zur Ruhe kommen. Künstler, die regelmäßig abends auftreten und am nächsten Morgen bereits wieder eine Probe haben, können durch den resultierenden Schlafmangel maßgeblich belastet sein. Je nach Tätigkeit auf Bühne und Podium können manche körperlichen Erscheinungen des Lampenfiebers mehr oder weniger stören. So sind für Sänger und Sprecher Mundtrockenheit und die beschleunigte Atemfrequenz unangenehm auf der Bühne, während sie für Streich- und Tasteninstrumentalisten oder für Tänzer kaum eine Rolle spielen. Es gibt jedoch keine eindeutigen Hinweise darauf, dass die körperlichen Erscheinungen aus physiologischer Sicht systematisch mit der spezifischen Auftrittstätigkeit in Verbindung stehen. Sänger bekommen demnach nicht vornehmlich einen trockenen Mund und Pianisten nicht vermehrt kaltschweißige Hände. Die Wahrnehmung der körperlichen Reaktionen ist jedoch je nach Bühnentätigkeit häufig genau auf das Symptom fokussiert, welches am meisten stört, sodass der Eindruck entstehen kann, es handle sich um tätigkeitsspezifische Lampenfiebererscheinungen. Eher scheinen die Symptome jedoch einem individuellen Muster zu folgen. Für Instrumentalisten kann es besonders belastend sein, wenn durch die erhöhte Muskelspannung, durch Zittern und Verkrampfungen an Armen und Händen die erforderliche feinmotorische Kontrolle und Schnelligkeit beeinträchtigt sind. Eine eindrucksvolle Schilderung der Lampenfiebererscheinungen bei Flötisten finden wir bei Johann Joachim Quantz in seiner 1752 erschienen Schrift »Versuch einer Anweisung die Flöte traversière zu spielen«:
Abb. 2: Körperliche Erscheinungen des Lampenfiebers
»Die Furcht verursachet eine Wallung des Geblüthes, wodurch die Lunge in ungleiche Bewegung gebracht wird, und die Zunge und Finger ebenfalls in eine Hitze gerathen. Hieraus entsteht nothwendiger Weise ein im Spielen sehr hinderliches Zittern der Glieder: und der Flötenspieler wird also nicht im Stande seyn, weder lange Passagien in einem Athem, noch besondere Schwierigkeiten, so wie bey einer gelassenen Gemüthsverfassung, herauszubringen. Hierzu kömmt auch noch wohl, daß er bey solchen Umständen, absonderlich bey warmem Wetter, am Munde schwitzet; und die Flöte folglich nicht am gehörigen Orte fest liegen bleibt, sondern unterwärts glitschet: wodurch das Mundloch derselben zu viel bedecket, und der Ton, wo er nicht gar außen bleibt, doch zum wenigsten zu schwach wird.« (Quantz, 1997, S. 168)
Emotionale Ebene
Da Lampenfieber mit der Grundemotion Angst verbunden ist, lassen sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Emotionsforschung zur Angst heranziehen.
Wir gehen heute davon aus, dass es neben dem beschriebenen Programm des vegetativen Nervensystems mit Hypothalamus und den Hormonen Adrenalin und Noradrenalin im Gehirn einen zweiten Verschaltungsweg (Abb. 3) gibt, der deutlich langsamer erfolgt und eine bewusstseinsnähere Reaktion darstellt (Altenmüller, 2009). Er beteiligt höhere Gehirnareale und bietet eine genauere Analyse der Auftrittssituation. Aus der Gedächtnisregion des Gehirns werden Gedächtnisinformationen zur emotionalen Bedeutung der Auftrittssituation geliefert. Hieraus ergeben sich wichtige Ansatzpunkte dahingehend, dass Lampenfieber durch die Auseinandersetzung der Betroffenen mit sich selbst und durch die Aufarbeitung früherer Erfahrungen beeinflusst werden kann. Wir wissen auch, dass Lampenfieber eine starke Lernkomponente besitzt. Joseph E. Ledoux konnte in seinen Untersuchungen an Mäusen feststellen, dass situative Angst in Zusammenhang mit entsprechenden Stimuli erlernt wird (Ledoux u. William, 1986).
Abb. 3: Die zentrale Steuerung der Angst bei Lampenfieber (nach Altenmüller, 2009)
Grundsätzlich erleben wir beim Lampenfieber uns selbst und unsere Gefühle intensiver als sonst. Unabhängig davon, wie die Gefühle beim Lampenfieber ausgeprägt sind, spüren wir uns in einer einzigartigen Weise in der Gegenwart und in allen Facetten unseres Seins. Dies ist wahrscheinlich mit ein Grund, warum Bühnenkünstler die Bühne lieben, obwohl ihnen dort Höchstleistungen abverlangt werden. Nicht umsonst spricht Friedrich Schiller 1803 in seinem Gedicht »An die Freunde« von »den Brettern, die die Welt bedeuten«. Auch wenn die Aufregung beim Auftritt nicht immer nur angenehm sein mag, so ist sie doch höchst intensiv und führt zu einem Verlangen, diesen besonderen Zustand immer wieder zu erleben. Hierauf deuten die Biografien vieler Künstler hin, die nach einer erfolgreichen Bühnenkarriere ein Comeback erzwingen wollen, wie es z.B. Maria Callas auf tragische Weise versucht hat.
Die unangenehmen Gefühle des Lampenfiebers äußern sich in übersteigerter Angst, in Gereiztheit, in Gefühlen der Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins sowie des Kontrollverlusts. Bei manchen Menschen stellt sich in Auftrittssituationen auch ein Zustand ein, in dem sie sich selbst wie durch eine zweite Person von außen wahrnehmen und – während sie auf der Bühne sind – gleichzeitig beobachten. Dieses Phänomen bezeichnen wir als Depersonalisation. Es handelt sich um ein Phänomen, welches bei erhaltenem Realitätsbezug per se als nicht pathologisch einzustufen ist.
Denken
Das Spektrum der Gedanken beim Lampenfieber ist sehr individuell und deshalb immens groß. Trotzdem gibt es wiederkehrende, typische Themen und Inhalte. Ein oft geäußerter Gedanke vor dem Auftritt ist dieser: »Warum bin ich jetzt hier und muss gleich auftreten und sitze nicht mit Freunden im Café?« Daneben kreisen die Gedanken häufig um Personen im Publikum, deren Beurteilung aus beruflichen oder persönlichen Gründen wichtig ist. Bezüglich der Erwartungshaltung vor dem Auftritt gibt es zwei unterschiedliche Tendenzen: Die eine führt dazu, das Beste anzunehmen nach dem Motto: »Es wird schon klappen!«, während die andere vom Schlimmsten ausgeht, die Person im Extremfall sogar sicher ist, dass alles in einer Katastrophe enden wird. Die Tendenz zur negativen Annahme ist meist mit weiteren negativen Gedanken verbunden, z.B. Unsicherheiten überzubewerten, sich klein zu machen gegenüber anderen oder belanglose Ereignisse als negative Vorzeichen zu interpretieren etc. Während des Auftritts können die Gedanken abschweifen, indem sie sich mit Personen im Publikum oder anderen, unpassenden Dingen beschäftigen. Das Denken kann auch auf die Erwartung besonderer Schwierigkeiten beim Auftritt gerichtet sein. Die Gedanken nach dem Auftritt gelten häufig Fragen wie: »War ich gut auf der Bühne, wie bin ich angekommen, wie habe ich gewirkt?« Generell sind Gedankeninhalte im Zusammenhang mit dem Auftritt in der Regel wenig sachlich geprägt und nicht lösungsorientiert, sondern Ausdruck der starken Gefühle in der Auftrittssituation.
Verhalten
Auch auf der Ebene des Verhaltens sind auf der Bühne häufig Phänomene zu beobachten, welche die Präsentation maßgeblich mitgestalten. Insbesondere sind hier die Köperhaltung und die Bewegungen zu nennen. Hochgezogene Schultern, ständiges Räuspern und Hüsteln beim Redner, verkrampft angewinkelte Arme oder auch unwillkürliche nicht zur Musik passende Handbewegungen beim Sänger können als Zeichen der Unstimmigkeit vom Publikum wahrgenommen werden. Dies trifft besonders auch auf die Anteile des Verhaltens zu, die durch die eigentliche Bühnenaktion oder Inszenierung nicht festgelegt sind. Die individuellen Verhaltensweisen im Umgang mit dem Auftritt, wie z.B. Rituale, sind in Zusammenhang mit der Persönlichkeit im Kapitel »Analyse« ab S. 38 näher beschrieben. Bevorstehende Auftritte führen normalerweise dazu, dass wir motiviert sind, uns vorzubereiten und all unsere Ressourcen zu aktivieren. Wird die Angst vor dem Auftritt zu stark, so setzt als typische Reaktion Vermeidung ein. Sie kann sich als Lern- oder Spielblockade in der Vorbereitung auf Auftritte äußern oder in dem Versuch, die Auftrittssituation selbst zu umgehen. So wird von der Pianistin Martha Argerich berichtet, dass es sie als Kind furchtbar nervös machte, vor Publikum zu spielen und dass sie dies gerne vermeiden wollte. Ihr Biograf Olivier Bellamy berichtet: »Zwei Tage vor einem Konzert legte sie einmal ihre Schuhe mit nassem Papier aus, um sich eine Erkältung zu holen und auf diese Weise dem grausamen Frondienst zu entgehen.« (Bellamy, 2011, S. 41) Körperlich kann sich Vermeidung als Müdigkeit oder Erschöpfung zeigen oder auch dazu führen, dass wir uns von anderen zurückziehen. Die gegensätzliche Reaktion besteht darin, dass wir in übermäßige Aktivität verfallen, um der Aufregung keinen Raum zu geben. Auch hierdurch kann jedoch die Aufnahme- und Konzentrationsfähigkeit in der Vorbereitung des Auftritts verringert sein.
Zusammenwirken der Ebenen
Die verschiedenen Ebenen, auf denen sich Lampenfieber äußert, beeinflussen sich gegenseitig. Dieselben körperlichen Werte beim Lampenfieber wie z.B. Pulsschlag und Blutdruck können individuell mit unterschiedlichen Gefühlen verbunden sein (Craske u. Craig, 1984; Abel u. Larkin, 1990; Fredrikson u. Gunnarsson, 1992). So kann eine Person mit starken körperlichen Anzeichen des Lampenfiebers sich sehr gut fühlen, während eine andere Person bei geringeren Anzeichen unangenehme Angst empfindet (Spahn, 2010; auf S. 31f. ausführlicher beschrieben). Es wird deshalb vermutet, dass das Gesamterleben des Lampenfiebers davon abhängt, wie die körperlichen Anzeichen individuell gedeutet werden. So verstärkt eine ängstliche Wahrnehmung des körperlichen Befindens die Symptome eher, während eine ruhige Haltung zur Minderung der Symptome beiträgt. Hieraus können sich selbst verstärkende Kreisläufe in beide Richtungen entwickeln. Die Möglichkeit positiver »Neueinordnung« der körperlichen Symptome kann man auch zur Optimierung des Lampenfiebers nutzbar machen, wie im Kapitel »Maßnahmen« auf S. 94f. ausführlich dargestellt wird.
Warum tritt Lampenfieber auf?
Wie oben erläutert, entsteht Lampenfieber durch ein evolutionsbiologisch sehr altes Programm. Die Ausstattung, Gefahrensituationen zu erkennen und diese erfolgreich zu meistern, sicherte dem Homo sapiens das Überleben. Angst als zentrales Gefühl spielte hierbei eine wichtige Rolle, denn sie lieferte das entscheidende Signal dafür, dass im Körper optimale Bedingungen für Kampf oder Flucht hergestellt wurden. In der frühen Menschheitsgeschichte stellten hauptsächlich wilde Tiere, wie z.B. ein Furcht einflößender Tiger, die lebensbedrohlichen Feinde dar (Abb. 4).
Abb. 4: Tippoo’s Tiger, mechanische Orgel, hergestellt um 1793 für Tipu Sultan, Herrscher des Königreichs Mysore in Indien (Victoria und Albert Museum, London)
Heute müssen wir mit solchen Gefahren im Alltag zwar nicht mehr rechnen. Die Situation der Bedrohung durch ein wildes Tier hat sich jedoch in der kulturellen Praxis des Stierkampfs erhalten, über den Hemingway in seinem Roman »Tod am Nachmittag« (1932) so treffend schrieb: »Der Stierkampf ist die einzige Kunstform, in der sich der Künstler in Todesgefahr befindet.« Der Torero durchlebt dabei eine Form des Lampenfiebers, die durch existentielle Angst geprägt ist, wie eindrucksvoll in Günter Schwaigers Dokumentarfilm »Arena« (2010) oder auch von dem berühmten Stierkämpfer José María Manzanares in einem Zeit-Interview dargestellt wurde (Düker, 2011). Zumeist gelingt es den Toreros, diese Angst zu beherrschen und den Kampf anzunehmen. Nur vereinzelt gibt es Berichte, dass ein Stierkämpfer – wie der mexikanische Matador Christian Hernández – dem Kampf nicht standhielt und flüchtete (Spiegel, 2010).
Auch bei manchen zirzensischen und artistischen Vorführungen ist für den Künstler die Angst, körperlich Schaden zu erleiden, als Kern geblieben. Über seine Erfahrungen berichtet der 45-jährige Falko Traber, Hochseilartist aus der berühmten Traber-Familie, in einem Interview mit Gerd Kempf (2005):
»Höhenangst kenne er [Traber] nur vom Hörensagen, doch der Respekt vor der Tiefe ist dem Hochseilartisten trotz aller Routine geblieben. ›Routine macht es gefährlich‹, weiß Falko Traber, der im zarten Alter von fünf Jahren erstmals die Balance auf dem Hochseil gehalten hat und bis heute als Artist noch jedes Mal vom Lampenfieber gepackt wird, bevor er seinen waghalsigen Beruf ausübt. ›Lampenfieber‹, sagt er, ›ist ein gutes Zeichen, dass die Sinne funktionierend.‹ Wie ein Torero, wenn er die Arena betritt, so verwandelt sich der im Privatleben eher nervöse Falko, sobald er im Kostüm auf das Seil steigt und das Lampenfieber ablegt: ›Da ist man dann ein ganz anderer Mensch.‹ 1996 erlebte er in Baden-Baden aber auch das Gegenteil eines Höhenflugs, als er sich auf dem Seil nicht umdrehen konnte, aber gespürt hat, wie sein ihm mit einer Helmkamera folgender Partner Lutz Schreyer aus 29 Metern vom Seil fiel und diesen Sturz nicht überlebte. Falko selbst stand unter Schock und hat es ›wie ein verletztes Tier gerade noch geschafft herunterzukommen‹. Die Füße vom riskanten Beruf lassen, käme für ihn nicht in Frage, dazu ist er zu fest in die Familientradition eingebunden.«
Wir entnehmen diesem Bericht, dass hier Lampenfieber verbunden ist mit der Realangst vor einer lebensgefährlichen Situation. Gleichzeitig wird die Nähe von Höhenrausch und Absturz – beim Hochseilartisten im ganz wörtlichen Sinne – deutlich. Gerade die Verknüpfung von Hochgefühl und Angst übt eine große Anziehungskraft aus. Diese Mischung – alltagssprachlich auch als »Kick« oder »Thrill« bezeichnet – scheinen zunehmend mehr Menschen gerade in den Ländern zu suchen, die durch Zivilisation eine hohe Lebenssicherheit bieten. Viele setzen sich potentiell bedrohlichen Situationen aus oder nehmen passiv daran teil. Besonders bei Auto- oder Skirennen ist die ungeheure Anziehungskraft solcher Veranstaltungen wesentlich dadurch zu erklären, dass für den Zuschauer ein Nervenkitzel besteht, ob die Rennläufer und -fahrer schadlos durch das Rennen kommen oder ob spektakuläre Unfälle zu beobachten sind, die nicht selten für die Sportler eine akute Gefahr für Leib und Leben bedeuten. Auch Sportarten wie Fallschirmspringen oder Gleitschirmfliegen bergen konkrete Risiken, die im schlimmsten Fall für den ausübenden Sportler tödlich enden können. Der Psychoanalytiker Michael Balint hat schon 1959 in seiner Schrift »Angstlust und Regression« analysiert und anschaulich beschrieben, was an diesen Situationen für viele Menschen so spannend ist:
»In allen Lustbarkeiten und Vergnügungen dieser Art lassen sich drei charakteristische Haltungen beobachten: a) ein gewisser Betrag an bewusster Angst, oder doch das Bewusstsein einer wirklichen äußeren Gefahr; b) der Umstand, dass man sich willentlich und absichtlich dieser äußeren Gefahr und der durch sie ausgelösten Furcht aussetzt; c) die Tatsache, dass man in der mehr oder weniger zuversichtlichen Hoffnung, die Furcht werde durchgestanden und beherrscht werden können und die Gefahr werde vorübergehen, darauf vertraut, dass man bald wieder unverletzt zur sicheren Geborgenheit werde zurückkehren dürfen. Diese Mischung von Furcht, Wonne und zuversichtlicher Hoffnung angesichts einer äußeren Gefahr ist das Grundelement aller Angstlust (thrill).« (Balint, 1994, S. 20f.)
Evolutionsbiologisch könnte man die Hypothese aufstellen, dass der Mensch die früher in der Natur vorhandene Gefahrensituation heute bewusst sucht und sich Angst auslösenden Situationen aussetzt, um sich eine stimulierende Erfahrung zu verschaffen. Diese Hypothese wird gestützt durch neurowissenschaftliche Erkenntnisse aus der Angstforschung, welche die Bedeutung der Angst für die Persönlichkeitsentwicklung und das kreative Lernen bestätigen (Hüther, 1998).
Die besondere Mischung von Angst und Hochgefühl findet sich typischerweise auch beim Lampenfieber in sozialkommunikativen und künstlerischen Auftrittssituationen. Der auftretende Künstler oder Redner ist zwar im Gegensatz zum Torero nicht von einer realen körperlichen Gefahr bedroht, im Erleben des Künstlers kann die subjektiv empfundene Gefahr jedoch genauso stark sein wie die echte Bedrohung, zumal in Gehirn und Körper das gleiche Programm abläuft. Noch vor ca. hundert Jahren warf das Publikum mit Tomaten oder es kam zu handgreiflichen Auseinandersetzungen bei Aufführungen, die dem Publikum missfallen hatten, man denke z.B. an die Uraufführung von Igor Strawinskys Ballett »Le sacre du printemps« 1913 in Paris. Heutzutage ist ein »Solist« vor einer Gruppe von Zuhörern entsprechend dem heute geltenden gesellschaftlichen Verhaltenskodex nicht mehr in seiner körperlichen Existenz bedroht. Die Gefahr beim Auftritt wird vom Künstler oder Redner eher in Form der sozialen Bedrohung und in der subjektiv empfundenen Furcht vor Ansehensverlust, der Furcht vor dem Zutagetreten beschämender Seiten der eigenen Person u.a. erlebt. Es handelt sich demnach um eine kulturell überformte, sublimierte Form der ursprünglichen Angst- und Kampfeslust, deren Elemente stärker im Verborgenen liegen als bei körperlichen Gefahrensituationen und die deshalb leichter zu übersehen sind. Der »Tiger von heute« ist für uns eher durch seine psychosozialen als durch seine körperlich bedrohlichen Attribute gefährlich. Was wir empfinden, ist die Furcht vor seelischen und sozialen Wunden, die in ähnlicher Weise wie früher so weit gehen kann, dass wir uns in unserer psychischen Existenz »lebensbedrohlich« gefährdet fühlen.
Ist das Auftreten von Lampenfieber also durchaus grundsätzlich als biologisch sinnvoll einzustufen, so besteht doch eine Schwierigkeit darin, dass es an die Erfordernisse der Auftrittssituationen im künstlerischen oder rhetorischen Bereich nicht optimal angepasst ist. Vergleichen wir diese Erfordernisse mit denen einer undifferenzierten Kampf-Flucht-Situation, so ergeben sich Diskrepanzen auf körperlicher, psychomentaler und sozialer Ebene: Als Künstler und Vortragende benutzen wir stärker unsere Feinmotorik (Instrumentalisten) und differenzierte Artikulation (Sänger, Schauspieler, Redner), wir müssen uns auf komplexe psychomotorische Vorgänge konzentrieren (Instrumentalisten, Sänger, Tänzer) und nicht nur auf einfache Handlungsabläufe, wir brauchen keinen »leeren Kopf«, sondern sind auf unsere Gedächtnisleistung angewiesen (Schauspieler, Musiker, Tänzer), und wir agieren nicht in Feindkategorien, sondern stellen eine differenzierte soziale Kommunikation mit dem Publikum her. Machen wir uns all dies klar, so folgt hieraus, dass es unsere Aufgabe ist, die grundsätzlich positive Anlage des Lampenfiebers im Hinblick auf die jeweiligen spezifischen Anforderungen des Auftritts auszudifferenzieren. Wir sprechen in diesem Sinne ganz grundsätzlich von einer Optimierung des Lampenfiebers.
Optimierung von Lampenfieber
Lampenfieber in seiner optimalen Ausprägung führt dazu, dass wir auf Bühne und Podium besonders konzentriert, brillant und ausdrucksstark sind. Stellen wir uns einmal vor, wir würden in der gleichen Verfassung, in der wir zu Hause im Sessel sitzen, einen Auftritt bestreiten, so wird sehr schnell deutlich, dass dies nicht angemessen wäre und wohl nicht zu einem erfolgreichen Auftritt führen würde. Im Zusammenhang mit Lampenfieber verwenden viele Künstler deshalb die Begriffe Spannung und Konzentration. Man könnte demnach auch sagen, dass es die Funktion des Lampenfiebers ist, uns in die richtige Spannung und Konzentration für einen Auftritt zu versetzen. Es ist also wichtig, dass jede auftretende Person in der jeweiligen Auftrittssituation den optimalen Grad an Lampenfieber erreicht. Der Zusammenhang zwischen der Leistung, d.h. wie gut unsere Darbietung ist, und dem Grad an Aufregung durch das Lampenfieber ist in Abbildung 5 dargestellt.
Der Kurvenverlauf zeigt, dass die Leistung bei niedriger Aufregung schlecht ist, während sie sich bei zunehmender Aufregung verbessert. Die beste Leistung erbringen wir bei einem mittleren Grad an Aufregung, bei noch stärkerer Aufregung nimmt die Leistung wieder ab (Steptoe, 1983). Dieser Zusammenhang wurde bereits 1908 von den Forschern Yerkes und Dodson beschrieben (Yerkes u. Dodson, 1908). Wo der optimale, mittlere Aufregungsgrad für den einzelnen Auftretenden liegt, lässt sich bei künstlerischen oder rhetorischen Vorträgen nur schwer an messbaren Körperfunktionen festmachen. Anders als im Sport, wo z.B. im Biathlon das optimal functioning level für die beste Treffsicherheit beim Schießen anhand der individuellen Herzfrequenz festgelegt werden kann, sind Auftritte bei Reden oder künstlerischen Darbietungen komplexer und in ihrer Leistung nicht an einem einzigen Zielparameter festzumachen. Der optimale Grad an Lampenfieber lässt sich hier eher als eine durch Auftrittserfahrungen erlernte Einstellung beschreiben. Einstellung meint hier im ursprünglichen Sinn des Wortes, die eigenen Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen und das Verhalten in der bestmöglichen Weise auf den Auftritt hin auszurichten.
Abb. 5: Zusammenhang zwischen Lampenfieber und Bühnenleistung
Wie kann sich Lampenfieber äußern?
Die schönste Variante des Lampenfiebers ist sicher die der freudigen Erwartung des Auftritts, der maximalen persönlichen Präsenz auf der Bühne und der Freude und Erleichterung über das Gelungene nach dem Auftritt. Selbst diese Idealvariante des Lampenfiebers ist jedoch gekennzeichnet durch eine ihr innewohnende Spannung: zwischen der Lust am Abenteuer, das vor einem liegt, und der gleichzeitigen Angst davor, es einzugehen. Die Gefühle können in beide Richtungen ausschlagen. Wenn wir unter unserem Lampenfieber leiden, dann in der Regel deshalb, weil die Angstkomponente überhand nimmt, uns lähmt und hilflos macht und wir die Kontrolle über uns selbst verlieren. Dann fehlen die innere Freiheit und der Spaß am Risiko. Neben diesem charakteristischen Gefühlsspektrum des Lampenfiebers sei noch erwähnt, dass es auch Gefühle der Niedergeschlagenheit und der Überforderung gibt, die starke Ausmaße annehmen können.
Lampenfieber lässt sich also am besten auf einem Kontinuum zwischen positiver und negativer Ausprägung beschreiben. Hierdurch wird deutlich, dass es fließende Übergänge zwischen verschiedenen Ausprägungsformen gibt (Abb. 6). Zudem weist Lampenfieber von Person zu Person und auch bei ein und derselben Person je nach Situation, Darbietung etc. immer gewisse Schwankungen innerhalb eines bestimmten Erfahrungsspektrums auf.
Abb. 6: Kontinuum der Gradausprägung des Lampenfiebers
Im Folgenden sollen – in Anlehnung an Möller (1999) – unterschiedliche Formen des Lampenfiebers bis hin zur Auftrittsangst beschrieben werden, die jedoch nur grobe Anhaltspunkte für die individuelle Ausprägung liefern:
► Die oben beschriebene optimale Variante des Lampenfiebers kann auch als leistungsfördernde Form bezeichnet werden. Sie ist gekennzeichnet durch eine verstärkte Konzentration und Leistungssteigerung sowie eine positive Selbsteinschätzung. Viele Künstler beschreiben dann beim Auftritt »High«-Erlebnisse – wie beispielsweise der Bariton Thomas Allen, der nach einer Vorstellung des »Don Giovanni« in Japan in einem Zeitungsinterview sagte: »Ich hätte über die Hausdächer hüpfen können, so high fühlte ich mich.« (Independent on Sunday, 1990). Selbst diese Idealvariante des Lampenfiebers ist jedoch, wie bereits dargelegt, gekennzeichnet durch eine Spannung zwischen Freude und Angst.
► Die zweite Variante des Lampenfiebers bezeichnen wir als leistungsbeeinträchtigende Form. Sie ist gegenüber der ersten gekennzeichnet durch ein Übergewicht der Angstkomponente. Hier leiden wir teilweise unter unserem Lampenfieber oder es stört uns. Neben den positiven, d.h. das Selbstwertgefühl stärkenden Gedanken treten auch negative wie Selbstzweifel oder Misserfolgserwartungen auf. Hieraus können Konzentrationsstörungen, Gedächtniseinschränkungen oder Blockaden resultieren. In manchen Momenten würden wir uns vor der Anforderung des Auftritts am liebsten zurückziehen und wir zeigen Ansätze von Vermeidungsverhalten.
► Die dritte Form bezeichnen wir als leistungsverhindernd, sie ist gleichbedeutend mit der Auftrittsangst. Von Auftrittsangst sprechen wir, wenn ein Grad der Angst erreicht wird, bei dem die Leistung in der Auftrittssituation sehr stark behindert oder unmöglich ist und bei dem die Person psychisch so stark belastet ist, dass sie Tage oder Wochen vor bzw. nach dem Auftritt nicht mehr am sozialen Leben teilnehmen kann und Symptome von Stress und Depression entwickelt. Die Auftrittssituation wird hier als extrem belastend wahrgenommen. Es resultiert häufig eine völlige Blockade bzw. ein Vermeidungsverhalten, sodass Auftritte abgesagt oder gar nicht mehr geplant werden.
Für die Gesamteinschätzung des Lampenfiebers ist es maßgeblich, wie häufig sich welche Anzeichen im Verlauf einer längeren Periode von Auftritten äußern und wie groß insgesamt deren Variationsbreite ist. Wechseln sich positive und negative Auftrittserfahrungen ab, so ist dies insgesamt eher als günstig einzuschätzen, da sich dann kein überdauerndes negatives Auftrittsmuster etabliert hat. Hierbei ist auch zu betonen, dass Schwankungen des Lampenfiebers zur Auftrittsrealität gehören und dass ein stabiler Idealzustand mit ausschließlich positiven Lampenfiebererfahrungen nur selten anzutreffen sein wird. Sogar die Grenzen zwischen Lampenfieber und Auftrittsangst sind fließend und können situativ sowie in der Lebenszeitperspektive und im Laufe des Berufslebens variieren.
Grundsätzlich markiert der Übergang vom Lampenfieber zur Auftrittsangst jedoch den Wechsel vom »Gesunden« zum »Kranken«, was hinsichtlich des Bezugsrahmens im Gesundheitssystem einen Wechsel vom Bereich der Optimierung von Lampenfieber und Prävention hin zur Behandlung bedeutet. Bei der Auftrittsangst handelt es sich demnach um eine medizinische Diagnose, die in der diagnostischen Klassifikation für psychische Störungen ICD 10 als eine besondere Form der sozialen Phobie einzustufen ist. Auftrittsangst sollte bei einem Facharzt für Psychosomatische Medizin und/oder einem Psychologischen Psychotherapeuten in jedem Fall abgeklärt und bei Bestätigung der Diagnose ambulant behandelt werden. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn sich auch außerhalb des Auftritts Ängste entwickeln und wenn die Betroffenen zu gesundheitlich schädlichen Hilfsmitteln wie selbst verordneten Medikamenten, Alkohol oder Drogen greifen, um ihre Auftrittsangst zu bewältigen. Grundsätzlich stehen wirkungsvolle diagnostische und therapeutische Verfahren zur Verfügung, sodass nicht unnötig lange gezögert werden sollte, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen (Spahn, 2011b). Dies trifft auch zu, wenn Sie unsicher sind, ob Ihr Lampenfieber den Grad einer Auftrittsangst erreicht hat oder wenn Sie die Erfahrung machen, dass Sie eine Verbesserung Ihrer Auftrittssituation allein aus eigener Kraft nicht erreichen können.
Wie verläuft Lampenfieber?
Lampenfieber kann in Bezug auf den Auftritt zeitlich ganz unterschiedlich verlaufen. Bereits Tage bis Wochen vorher kann eine erhöhte Grundspannung bestehen oder sich beim Gedanken an den bevorstehenden Auftritt Lampenfieber einstellen. Je näher der Auftritt rückt, desto stärker wird in der Regel das Lampenfieber. Im Verlauf des Auftritts lässt die Spitze der Aufregung dann nach, wobei eine erhöhte Vigilanz während des ganzen Auftritts bleibt, das Lampenfieber also nie ganz verschwindet. Lampenfieber kann jedoch auch ganz anders verlaufen. Manche Personen sind direkt vor dem Auftritt ziemlich ruhig und das Lampenfieber überfällt sie, sobald sie die Bühne betreten, oder es kommt plötzlich während der Darbietung auf der Bühne über sie. Auch gefürchtete Stellen oder Passagen während des Auftritts können das Lampenfieber nochmals kurzfristig hochschnellen lassen.
Zum Verlauf von Angst vor und während des Fallschirmspringens machten Fenz und Epstein bereits vor über 40 Jahren eine interessante Studie (Fenz u. Epstein, 1967). Hierbei verglichen sie je 33 erfahrene (mit bereits über 100 Absprüngen) und unerfahrene (mit 1 bis 5 Absprüngen) Fallschirmspringer. Beide Gruppen hatten ähnlich starkes Lampenfieber, die erfahrenen Fallschirmspringer zeigten jedoch eine bessere Angstregulation, da bei ihnen der Gipfel des Lampenfiebers vor dem Absprung lag, während die unerfahrenen Fallschirmspringer das stärkste Lampenfieber genau in der gefährlichen Reaktionszone während des Absprungs hatten (Abb. 7).
Abb. 7: Angstkurve bei Fallschirmspringern (nach Fenz u. Epstein, 1967)
Auch bei vielen erfahrenen Musikern liegen die Lampenfieberspitzen vor dem Auftritt. So bestellte der berühmte Jazzpianist und Komponist Michel Petrucciani im Jahr 1995 bei den Leipziger Jazztagen den Journalisten für ein Zeitungsinterview extra vor dem Konzert, um sich dann, wenn das Lampenfieber für ihn am schrecklichsten war, abzulenken: »Auf dem Weg zur Bühne fluchte Petrucciani: ›I hate it‹. Eine Art Hassliebe, eine Überwindung ins Rampenlicht zu treten. Und schließlich: Standing Ovations.« (Noglik, 2002)
Wie häufig ist Lampenfieber?
Da Lampenfieber zum menschlichen Erlebensrepertoire gehört, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass jeder Mensch im Laufe seines Lebens Lampenfieber erfährt – die meisten Menschen sicherlich bei einer Rede oder Ansprache. Berufsgruppen wie Künstler, Politiker, Lehrer u.a. verbringen ihren Beruf größtenteils auf Bühne und Podium. Für sie stellt Lampenfieber in all seinen Ausdrucksformen eine Berufsrealität dar, die sie zwingt, ihre eigenen Bewältigungsstrategien zu entwickeln und im Laufe des Berufslebens immer wieder neu anzupassen. Sie unterscheiden sich damit sehr deutlich vom größeren Teil der Bevölkerung, der vergleichsweise viel seltener Situationen erlebt, in denen Lampenfieber auftritt. Die absolute Häufigkeit von Lampenfieber hängt demnach davon ab, wie häufig eine Person in ihrem individuellen Leben oder bestimmte Personengruppen in ihrem Berufsfeld Auftrittssituationen ausgesetzt sind. Da Lampenfieber in verschiedenen Ausprägungen auftritt, ist die weiterführende Frage interessant, wie häufig uns Lampenfieber in welchen Formen begegnet. In diesem Zusammenhang ist allgemein eine deutliche Tendenz festzustellen, die Aufmerksamkeit stärker auf die beeinträchtigenden Seiten des Lampenfiebers zu richten. Diese Tendenz findet sich sowohl in Zeugnissen über Künstler als auch in der wissenschaftlichen Literatur wieder. Insgesamt lässt sich sagen, dass nicht nur Menschen, die wenig auftreten, sondern auch Künstler mit umfangreicher Auftrittspraxis starkes Lampenfieber erleben.
Manche Künstler glauben, dass leistungsbeeinträchtigendes Lampenfieber sich nur bei schlechten Künstlern manifestiert und kommen im Umkehrschluss zu dem Fazit, dass sie selbst – da sie von großem Lampenfieber geplagt sind – folglich schlechte Künstler sein müssen. Dies ist jedoch ein bedauerlicher Irrtum, da auch starkes Lampenfieber unabhängig von der artistischen Potenz und Qualität des betreffenden Künstlers auftreten kann. Gerade in jüngster Zeit haben einige der aktuell populärsten Stars der Rock- und Popszene wie Robbie Williams oder die 2009 als beste Nachwuchskünstlerin mit dem Grammy ausgezeichnete Adele in Interviews über ihre sehr großen Probleme mit dem Lampenfieber berichtet. Autobiografische Aufzeichnungen erfolgreicher Künstler zu ihrem Erleben von Lampenfieber und Umgang mit Auftritten stellen eine interessante Quelle dar. So kennen wir eine Reihe von Künstlern, die unter starkem Lampenfieber leiden oder litten, denken wir z.B. an die Sängerinnen Ella Fitzgerald, Barbra Streisand und Annette Humpe, den Schauspieler Sir Laurence Olivier und an den Mitbegründer der Beatles, Paul McCartney, um nur einige wenige aus unterschiedlichen Genres zu nennen. Schon aus dieser sehr kursorischen und unvollständigen Auflistung wird deutlich, dass auch Künstler, in deren Erleben Lampenfieber phasenweise belastend war, zu außerordentlichen Bühnenleistungen fähig sind. Stellvertretend für eine Reihe berühmter konzertierender Musiker aus dem klassischen Sektor mit ausgeprägtem Lampenfieber sei Enrico Caruso (1873–1921) angeführt. Sein Impresario Emil Ledner, der ihn jahrelang begleitet und betreut hat, schreibt:
»Kritische Stunden erster Ordnung brachten jene Tage, an welchen eine Vorstellung stattfand. An solchen Tagen wurde Caruso von einem entsetzlichem Lampenfieber gequält. Jeder Künstler leidet mehr oder weniger unter diesen Empfindungen, bei Caruso nahm das Lampenfieber unbeschreibliche Dimensionen an, die ihm jede Vernunft raubte, seine Nerven peitschte und seine Umgebung zur Verzweiflung brachte. (…) An Spieltagen musste für Todesstille in allen Räumen gesorgt werden. Jedes laut gesprochene Wort peinigte ihn. Frühstück, Mittagessen, durchaus leicht zu verdauende, in winzigsten Quantitäten genossene Speisen – nichts von ihnen konnte er bei sich behalten – und nach dem Genuss zweier Tassen Kamillentee fuhr er ins Theater.« (Ledner, 1922, S. 73 u. 76)
Nähert man sich dem Phänomen von wissenschaftlicher Seite, so gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Häufigkeit und Ausprägung von Lampenfieber zu messen. Die meisten wissenschaftlichen Untersuchungen erfassen Lampenfieber, indem sie Betroffene vor und nach Auftrittssituationen mittels standardisierter Fragebögen befragen, wie sie Lampenfieber in der jeweiligen Situation oder über einen größeren Zeitraum erleben, d.h. welche Gefühle sie dabei haben, welche Gedanken sie beschäftigen, welche Umgebungsfaktoren sie beeinflussen etc. Hieraus lässt sich insgesamt ableiten, wie angenehm bzw. unangenehm eine Person Lampenfieber erlebt bzw. ob sie darunter leidet. Bei einer entsprechenden Befragung von Studierenden unterschiedlicher Fächer zeigte sich, dass 40 Prozent ihr Lampenfieber vor öffentlichen Vorträgen als unangenehm stark empfinden, bei Musikstudierenden sind dies 60 Prozent (Schröder u. Liebelt, 1999). Wie die von außen zu beobachtende Leistung auf Bühne oder Podium ist, ist hierbei nicht berücksichtigt.
Neben der Selbsteinschätzung des Lampenfiebers lassen sich auch die körperlichen Anzeichen wie Herz- und Atemfrequenz, Blutdruck und Hautwiderstand messen. In einer Untersuchung unserer eigenen Arbeitsgruppe haben wir Opernsänger bei Haupt- und Generalproben sowie Premieren vor, während und nach dem Bühnenauftritt untersucht (Spahn et al., 2010). Die körperlichen Parameter wurden kontinuierlich gemessen, außerdem wurde das erlebte Lampenfieber mittels eines Fragebogens 10 Minuten vor und nach dem Auftritt erfasst. Es handelte sich um männliche und weibliche Sänger mit fünf bis zehn Jahren Berufserfahrung im festen Engagement an einem deutschen Theater mittlerer Größe. Eine der untersuchten Sängerinnen gab eine starke Angstkomponente ihres Lampenfiebers an, die anderen berichteten von geringer Angst im Lampenfieber. Hierbei zeigten die Angaben zum Lampenfieber und die gemessenen körperlichen Anzeichen nicht in die gleiche Richtung: Die Sängerin mit der stark erlebten Angst hatte normale Werte bei Herzfrequenz und Blutdruck, während andere Sänger, die geringe Angst im Lampenfieber angaben, deutlich erhöhte Werte für Herzfrequenz und Blutdruck zeigten. Diese Diskrepanz zwischen Selbsterleben und körperlichen Reaktionen fand sich auch in anderen Untersuchungen (Craske u. Craig, 1984; Studer et al., 2011). Es wird deshalb vermutet, dass die gleichen physiologischen Zustände als unterschiedlich bedrohlich interpretiert werden.
Dieser kurze Einblick in die Forschung zum Thema Lampenfieber soll zeigen, dass eine angemessene und differenzierte Erfassung der verschiedenen Komponenten sehr schwierig ist und Untersuchungsergebnisse deshalb sehr vorsichtig interpretiert werden müssen. Wollen wir nun entsprechend den oben getroffenen Definitionen zwischen Lampenfieber und Auftrittsangst differenzieren, so enthält die reine Selbsteinschätzung mittels Fragebogen einige Unschärfen. Ausgehend von der bestehenden Literatur lassen sich die Ergebnisse epidemiologischer Untersuchungen am Beispiel der Musiker trotzdem dahingehend abschätzen, dass die Prävalenz von Auftrittsangst bei dieser Berufsgruppe zwischen 13 und 25 Prozent liegt (Steptoe, 2005; Gembris u. Heye, 2012). Außer durch direkte Befragung erhalten wir auch indirekte Hinweise auf den Leidensdruck durch Lampenfieber oder Auftrittsangst. So gab ca. ein Viertel der Orchestermusiker in den USA (Fishbein et al., 1988) und ca. ein Fünftel in Deutschland (Gembris u. Heye, 2012) an, Betarezeptorenblocker in Selbstmedikation einzunehmen. Da als einzige Motivation für die Einnahme die Unterdrückung der adrenergen körperlichen Symptome in Frage kommt, ist der Zusammenhang mit belastendem Lampenfieber oder Auftrittsängsten sehr wahrscheinlich.