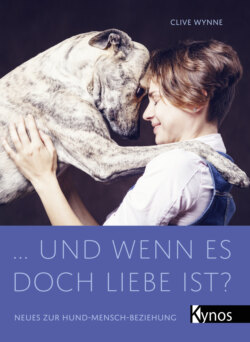Читать книгу ... und wenn es doch Liebe ist? - Clive Wynne - Страница 6
ОглавлениеNeulich nahm ich mir eine vorübergehende Auszeit von meiner Wahlheimat, den Vereinigten Staaten, um mein Vaterland England zu besuchen. Es war ein Spätnachmittag im Winter und die Sonne hatte ihr kurzes Tagespensum bereits abgeleistet. Ich ging zwischen Tausenden von anderen, die von ihrem Arbeitstag im Zentrum zurückkehrten, die Treppenstufen einer Bahnstation in den äußeren Londoner Vororten hinunter. Diese viktorianischen Bahnhöfe müssen zur Zeit ihrer Erbauung großartig ausgesehen haben, und manche tun es im Licht der Sommersonne auch immer noch, aber am Ende eines nasskalten Tages wie diesem wirken sie ausgesprochen bedrückend: die alten, dunkelroten Ziegelsteine waren nur von trübem und flackerndem Neonlicht schwach beleuchtet und die ganze ehemals triumphierende Atmosphäre von der übellaunigen Stimmung erschöpfter Pendler durchzogen.
Als ob die Szene noch nicht trostlos genug gewesen wäre, erschallte plötzlich das ganze Bahnhofsgebäude unter dem drängenden Gebell eines Hundes. Unten am Fuß der Treppe, knapp hinter den Schranken, die Menschen ohne Fahrschein am Betreten des Bahnsteigs hindern, hielt eine junge Frau – eigentlich noch ein Kind – mit aller Kraft das Ende einer Leine fest. Deren anderes Ende hielt einen kleinen, aber lauten und sehr energischen Hund, höchstwahrscheinlich irgendeine Art von Terrier. Dieser kleine Hund veranstaltete ein erhebliches Getöse aus lautem Kläffen.
Meine erste unbewusste Reaktion war Verärgerung: die ohnehin schon düstere Szene hatte noch eine nervige Geräuschuntermalung bekommen. Aber als ich näherkam und sah, wie glücklich dieser Hund war, schlich sich ein unfreiwilliges Lächeln in mein Gesicht.
Der Hund hatte irgendjemanden in der großen Menschenmenge erkannt. Als diese Person näherkam, verwandelte sich das Bellen des Hundes vom aufgebrachten Gekläff in eine Art überglückliches, fast singendes Geheul. Seine Krallen schlitterten über den glatten Fußboden, als er darum kämpfte, zu seinem Menschen zu kommen. Als der Mann endlich durch die Ticketschranke war, sprang der kleine Hund in seine Arme und schlabberte sein Gesicht ab. Ich war nur ein kurzes Stück hinter dem Mann und konnte hören, wie er seinem Hund beruhigend zuredete: „Ist ja gut, ist ja gut, jetzt bin ich ja wieder da!“
Als ich mich umschaute, sah ich, dass das ganze Gesichtermeer meine eigene Gefühlsreaktion widerspiegelte: Erst Gereiztheit – noch eine unnötige Last am müden Ende eines langen Tages – und dann unwillkürlich empfundenes Glück angesichts der Liebe dieses Hundes für seinen Herrn. Hier und da breitete sich Lächeln in der Menge aus, gefolgt von freundlichem Lachen. Menschen, die mit Bekannten zusammen unterwegs waren, tauschten Kopfnicken und ein paar Worte aus. Die meisten Alleinreisenden packten ihr Lächeln wieder in ihre Taschen, aber ihre Schritte blieben ein klein wenig leichter und federnder in Erinnerung an die unerwartete kleine Freude, die sie auf ihrem Heimweg im Bahnhof erlebt hatten.
Während ich diese fröhliche Szene noch auf mich wirken ließ, führte mich meine Erinnerung zurück zu einer meiner ersten Reisen heim ins Vereinigte Königreich, nachdem ich dessen Küsten vor über dreißig Jahren verlassen hatte. Damals lebte unser Familienhund Benji noch. Meine Mutter war mit dem Auto zum Bahnhof der Isle of Wight, wo ich aufgewachsen war, gekommen, um mich abzuholen – und Benji saß aufrecht und aufmerksam auf dem Beifahrersitz. Weil man in England auf der linken Straßenseite fährt, sind in britischen Autos die Positionen von Fahrerund Beifahrersitz vertauscht - was dazu führte, dass es für meine müden und vom Jetlag mitgenommenen Augen, die daran gewöhnt waren, Fahrer an der Stelle zu sehen, wo jetzt Benji saß, so aussah, als ob mein Hund das Auto steuern würde. Mein verwirrter Verstand fand kaum Zeit, sich zu sortieren, als das Auto auf den Seitenstreifen fuhr, ich die Beifahrertür öffnete und auf Benjis Anfall von Wiedersehensfreude prallte. Sobald Benji mich sah, drehte er durch vor Freude, genau wie der kleine Terrier auf dem Bahnhof viele Jahre später – und genau wie ich, auch wenn ich meine Gefühle etwas strenger unter Kontrolle hielt.
Benji mag auf den ersten Blick nicht wie etwas erwähnenswert Besonderes ausgesehen haben, er war einfach ein eher kleiner, schwarz-lohfarbener Tierheimmischling. Für uns allerdings war er etwas sehr Besonderes. Sandfarbene Flecken um seine Augenbrauen herum machten seine Augen ganz besonders ausdrucksstark, vor allem, wenn er verdutzt war. Wir neckten ihn gerne, was er stets mit guter Laune hinzunehmen schien. Er konnte seine Ohren aufstellen, um seine Neugier zu zeigen. Mit seinem Schwanz konnte er Fröhlichkeit und Vertrauen ausdrücken, und seine Zuneigung zeigte er mit Zungenschlecken (was sich wie nasses Schmirgelpapier anfühlte und bei mir und meinen Brüdern Proteste hervorrief, obwohl wir uns von seiner Aufmerksamkeit geehrt fühlten).
Benji, der Hund meiner Kindheit, irgendwann in den frühen 1980er Jahren.
Benji, meine Brüder und ich wuchsen in den 1970er Jahren zusammen auf der Isle of Wight vor der Südküste Englands auf. Wenn mein jüngerer Bruder und ich von der Schule nach Hause kamen, ließen wir uns für gewöhnlich aufs Sofa fallen, von wo aus wir erst hörten und dann sahen, wie Benji aus dem Garten hinterm Haus hereingestürmt kam. Aus drei Metern Entfernung setzte er zum Sprung an und landete direkt auf uns drauf, wedelte uns seinen Schwanz um die Ohren und beschlabberte uns abwechselnd im Gesicht, wobei sein kleiner Körper sich vor Freude über das Wiedersehen krümmte und wand. Er liebte uns, ganz klar – oder zumindest schien uns das damals ganz unbestritten.
Es vergingen viele Jahre. Benjis kurzes Leben endete und ich war mit meinem ruhelosen, umherziehenden Dasein beschäftigt. Aber die Erinnerung an den Hund meiner Kindheit dauerte an, genau wie meine Faszination für eine andere Spezies neben unserer eigenen.
Mit der Zeit zog es mich zum akademischen Leben, wo ich zu studieren begann, wie verschiedene Tierarten Wissen erwerben und welche Schlüsse sie aus ihrer Umwelt ziehen. Ich wollte begreifen, worin sich der Verstand von Tieren von unserem unterscheidet. Bis zu welchem Grad ist die menschliche Fähigkeit zum Schlussfolgern, Denken und Kommunizieren etwas uns Eigenes und in welchem Ausmaß wird sie von anderen Spezies auf diesem Planeten mit uns geteilt? Oft interessiert man sich dafür, ob es wohl denkende Wesen auf anderen Planeten gibt, aber ich wollte etwas über die Intelligenzen auf unserem Planeten erfahren.
Als Professor der Tierpsychologie konzentrierte sich meine Forschung zunächst auf die häufigsten Laborbewohner in diesem Bereich: Ratten und Tauben. Und als ich ein Jahrzehnt lang in Australien lebte und arbeitete, hatte ich Gelegenheit, mich mit einer wirklichen coolen Beuteltierart zu beschäftigen, die noch niemand zuvor untersucht hatte. Es war ein tolles Leben voller faszinierender intellektueller Fragestellungen und interessanter Entdeckungen – aber trotzdem war ich nicht ganz zufrieden.
Mit der Zeit wurde mir klar, dass ich nicht nur am isoliert betrachteten Tierverhalten interessiert war. Vielmehr zog es mich zur Beziehung zwischen Menschen und Tieren. Und von all den Tausenden Tierarten auf der Erde teilt keine eine stärkere und interessantere Bindung mit uns als der Hund.
Im Rückblick wundert es mich, dass ich so lange brauchte, um zu begreifen, dass ich Hunde studieren musste. Ihr Verhalten ist so unglaublich reich: Es gibt Hunde, die Krebs und Schmuggelware erschnüffeln können, Hunde, die Menschen mit durchlebten Traumata trösten und Hunde, die blinden Menschen beim Überqueren stark befahrener Straßen helfen. Und Hunde und Menschen sind schon ganz schön lange zusammen. Es gibt kein Tier, zu dem Menschen eine längere und tiefere Beziehung haben.
Menschen und Hunde leben seit über fünfzehntausend Jahren Seite an Seite. Diese lange gemeinsame Geschichte hat den Verstand der Hunde mit dem unsrigen auf eine Art und Weise verwoben, die wir erst nach und nach zu verstehen beginnen. Zum Teil ist dieses mangelnde Verständnis einfacher Nachlässigkeit geschuldet: Als ich mit dem Studium des Hundeverhaltens begann, fingen die Wissenschaftler gerade erst an, sich wieder für Hunde zu interessieren, nachdem sie diese zuvor ein halbes Jahrhundert lang ignoriert hatten. Dieses wiedererwachte Interesse brachte einige faszinierende Entdeckungen über Hunde ans Tageslicht – Forschung, die mich schon bald zu meiner eigenen wissenschaftlichen Fragestellung inspirierte.
In den späten 1990er Jahren wurde das Feld der Hundewissenschaft von neuen Forschungen beherrscht, die den Beweis für sich beanspruchten, Hunde besäßen eine einzigartige Form der Intelligenz. Die Wissenschaftler stellten die Theorie auf, dass Hunde über die Tausende von Jahren, die sie in enger Nähe zum Menschen verbracht haben, einzigartige Fähigkeiten zum Verständnis menschlicher Absichten entwickelt hätten, sodass eine vielschichtige und feine Kommunikation zwischen unseren beiden Arten möglich geworden sei. Dieser sogenannte Genius der Hunde wurde als die spezielle Eigenschaft emporgehoben, die Hunde zu derart perfekt passenden Begleitern von Menschen machte. Folglich nahm man an, dass hierin auch der Schlüssel zum Verständnis und zur Gestaltung unserer Beziehung zu Hunden läge.
Diese Theorie – dass Hunde kognitive Fähigkeiten besäßen, die sie in die Lage versetzen, Menschen besser zu verstehen als jedes andere Tier – findet immer noch viele Unterstützer unter denjenigen, die das Verhalten und die Intelligenz von Hunden zu ihrem Beruf und ihrer Berufung machen. Als ich zum ersten Mal davon hörte, schien es mir eine plausible Erklärung für den erstaunlichen Erfolg der Hunde auf unserem von Menschen beherrschten Planeten zu sein. Und dennoch: Als meine Studenten und ich selbst damit begannen, Hundeverhalten zu studieren, schienen diese vielgerühmten, angeblich einzigartigen kognitiven Fähigkeiten jedes Mal dann wie ein Trugbild zu verschwinden, wenn wir nach ihnen greifen wollten.
Ich begann mich zu fragen: Was, wenn Hunde gar keine einzigartigen kognitiven Fähigkeiten besäßen, sondern vielmehr besondere Fähigkeiten einer ganz anderen Art? Welche Art von Talent könnte das sein? Und wenn Hunde aus irgendeinem anderen Grund außer ihrer Intelligenz etwas Besonderes wären, welche Folgen hätte das für die Art und Weise, wie wir mit Hunden umgehen und uns um sie kümmern sollten?
Diese Fragen stellten sich mir nicht alle auf einmal. Wie die meisten aktiven Wissenschaftler war ich vor allem mit der Forschung direkt vor meiner Nase beschäftigt. Manchmal macht es professionelle Erfahrung eben schwieriger, das zu erkennen, was ein Laie vielleicht sofort identifizieren mag. So kam es, dass ich zunächst nicht sah, dass Hunde, solange ich sie kannte, eigentlich immer recht offen mir gegenüber in Bezug auf ihr wahres Wesen gewesen waren. Benji, der Hund meiner Kindheit, und der freudig juchzende Terrier im düsteren Bahnhof vor vielen Jahren: mit jedem Wedeln ihres Schwanzes und jedem Lecken ihrer Zunge hatten sie die Frage beantwortet, was Hunde so besonders macht. Die eigentliche Frage war – konnte ein Wissenschaftler das sehen?
Die Hundeforschung hat über etwa die letzten zehn Jahre eine Revolution erlebt. Die Wissenschaftler entdecken eine reiche Tradition an Studien zu den Caniden wieder und gleichen diese mit den bewährten Instrumenten der Psychologie sowie den neuesten Methoden und Technologien aus Neurowissenschaft, Genetik und anderen Spitzen-Wissenschaftsbereichen ab. Das Ergebnis war eine wahre Explosion an Erkenntnissen dazu, wie Hunde fühlen und denken - Daten, die es wiederum Wissenschaftlern wie mir erlaubt haben, Fragen aufzuwerfen, über die wir noch ein paar Jahre zuvor niemals nachzudenken gewagt hätten, geschweige denn Jahre unseres Berufslebens für deren Erforschung aufzuwenden.
Meine eigenen Studien und die Arbeit vieler anderer im üppig gedeihenden Bereich der Hundeforschung machten es überdeutlich: Es ist nicht die Intelligenz der Hunde, die sie von anderen Tierarten abhebt, aber dennoch ist etwas bemerkenswert Besonderes an unseren Hundefreunden. Vielleicht ist diese Forschung nicht weniger kontrovers und erstaunlich als frühere Studien zur hündischen Intelligenz, weil sie auf eine einfache, aber geheimnisvolle Quelle für die einzigartige Bindung der Hunde zu Menschen hinweist. Dieses Phänomen ist verwirrend und kann bei einem Wissenschaftler Konfliktgefühle hervorrufen – aber es ist für jeden Hundefreund unmittelbar zu erkennen oder sogar ganz selbstverständlich.
Hunde besitzen eine überhöhte, überschäumende und vielleicht sogar exzessive Fähigkeit, von Zuneigung geprägte Beziehungen zu Angehörigen anderer Spezies einzugehen. Diese Fähigkeit ist derart stark, dass wir sie, würden wir sie an einem Mitmenschen feststellen, für recht seltsam oder sogar krankhaft halten würden. In meinen wissenschaftlichen Texten, die mich zur Nutzung fachlich korrekter Sprache verpflichten, bezeichne ich dieses abnorme Verhalten als Hypersozialität. Aber als Hundefreund, dem Tiere und ihr Wohlergehen zutiefst am Herzen liegen, sehe ich absolut keinen Grund dafür, warum wir es nicht einfach Liebe nennen sollten.
Viele Hundenarren werfen recht großzügig mit dem L-Wort um sich, und auch ich habe in meinem Privatleben zuhause lange Zeit das gleiche getan. Als Wissenschaftler war es aber nicht annähernd so leicht für mich, dieses Wort zu benutzen. Das liegt daran, dass allein die Idee, dass Tiere Gefühle haben, für die meisten Menschen in meinem Fachbereich lange Zeit so etwas wie Ausschluss aus der akademischen Gemeinde bedeutete – und insbesondere das Konzept der Liebe scheint für unseren nüchternen Wissenschaftszweig zu rührselig und ungenau zu sein. Wer es Hunden zuschreibt, läuft außerdem Gefahr, diese zu vermenschlichen, sprich sie eher wie unsereins denn als eigenständige Spezies zu betrachten. Das ist etwas, wogegen Wissenschaftler sich – zu Recht – lange Zeit gewehrt haben, sowohl wegen der wissenschaftlichen Genauigkeit als auch wegen des Wohlergehens der Tiere.
Und dennoch bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass zumindest in dieser Beziehung ein Hauch von Vermenschlichung gestattet oder sogar angemessen ist. Das liebevolle Wesen der Hunde anzuerkennen ist der einzige Weg, um aus ihnen schlau zu werden. Mehr noch: Das Bedürfnis der Hunde nach Liebe zu ignorieren (ja, ich werde in Kürze noch darauf eingehen, dass Hunde tatsächlich Liebe brauchen) ist genauso unethisch, wie ihnen gesunde Nahrung und Bewegung zu verweigern.
Zu dieser Schlussfolgerung wurde ich aufgrund einer ganzen Reihe von Beweisen gebracht, die aus Laboren und Tierheimen auf der ganzen Welt kommen – Beweise, die ganz klar zeigen, dass Hunde Liebe genauso empfinden, wie wir Menschen es tun. Und sobald ich erst einmal darauf zu achten begonnen hatte, wurde mir klar, dass die Leidenschaft, die Hunde gegenüber Menschen empfinden, sich auf vielerlei Weise ausdrückt. Wir alle haben schon Geschichten darüber gehört, was Hunde Unerhörtes getan haben, um ihre Besitzer zu schützen. Forschungen dazu, wie Hunde auf gestresste oder in Not befindliche Menschen reagieren, zeigen ganz klar, dass sie sich um die Menschen sorgen – auch wenn die tatsächlichen Fähigkeiten, die sie anzubieten haben, nicht annähernd so dramatisch sind, wie Hollywood es uns gerne glauben machen möchte. Noch beeindruckender sind Studien, die zeigen, wie der Herzschlag von Hund und Halter sich synchronisiert, wenn beide zusammen sind – ganz ähnlich der Synchronizität bei menschlichen Liebespaaren. Wenn Hunde mit den von ihnen geliebten Menschen zusammen sind, erleben sie auch neurologische Veränderungen – einschließlich Spitzenwerten an Gehirnbotenstoffen wie Oxytocin – welche die Veränderungen widerspiegeln, die auch wir Menschen erfahren, wenn wir Liebe empfinden. Die starke Liebe der Hunde zu Menschen kann sogar auf den eigentlichen Kern ihres Seins reduziert werden: auf ihren genetischen Code, der uns heute unglaubliche Einsichten in den Verstand und in die Evolutionsgeschichte dieser Spezies eröffnet und den Wissenschaftler sich weiter zu entschlüsseln beeilen.
Diese und weitere aktuelle Entdeckungen haben mich zu der Erkenntnis gezwungen, dass Liebe der Schlüssel zum Verstehen von Hunden ist. Außerdem bin ich zu der Überzeugung gelangt – und werde auf den nachfolgenden Seiten zahlreiche wissenschaftliche Beweise zur Unterstützung dafür anführen –, dass es das Bedürfnis der Hunde nach warmherzigen Gefühlsbeziehungen und nicht etwa irgendeine Art besonderer Cleverness war, die diese Spezies so erfolgreich in der menschlichen Gesellschaft gemacht hat. Ihr liebendes Wesen macht Hunde so vereinnahmend, dass viele von uns einfach nicht anders können, als ihnen den Gefallen zu erwidern und den Streuner zu trösten, der auf unserer Haustürtreppe auf kreuzt, den Rassehund zu lieben, den wir von einem Züchter gekauft haben oder den Hund aus dem örtlichen Tierheim, der so sehr darum gebeten hat, mit nach Hause genommen zu werden.
Die Liebe der Hunde ist wirklich der Grundstein für die Hund-Mensch-Beziehung, ob wir uns dazu entscheiden, uns die Bedeutung dieser Tatsache einzugestehen oder nicht. Und ich möchte argumentieren, dass es unsere Verantwortung ist, diese Bedeutung anzuerkennen und außerdem unser eigenes Verhalten angesichts der Fähigkeit von Hunden zum Lieben zu verändern. Denn die Theorie der Hundeliebe (ein Begriff, den ich nur halbwegs scherzhaft verwende) ist nicht nur der Schlüssel zu einem besseren Verständnis dieser erstaunlichen Lebewesen, sondern auch dazu, unsere Beziehung zu ihnen erfolgreicher zu gestalten. Wenn es ihre Fähigkeit zu lieben ist, die Hunde einzigartig macht, dann gibt es auch guten Grund zu der Annahme, dass sie deshalb einzigartige Bedürfnisse haben. Wenn es eine einzige, einfache Schlussfolgerung aus meinen Forschungen gibt, dann diese: Wir Menschen müssen viel mehr tun, um die Zuneigung unserer Hunde wertzuschätzen und zu erwidern. Ihre Fähigkeit, uns zu lieben, verlangt ganz einfach nach Gegenseitigkeit – was viele Menschen ja auch bereitwillig tun, auch wenn sie keine Ahnung von der Wissenschaft haben, die hinter dieser uralten Dynamik gegenseitiger Bewunderung steckt. Die Wissenschaft kann sowohl unsere enge Beziehung zu Hunden erklären als auch zu ihrer Verbesserung beitragen. Wir können das Wohlbefinden unserer Hunde mit so einfachen Dingen verbessern wie sie mehr zu berühren, weniger allein zu lassen und ihnen Gelegenheit zu geben, in einem Netzwerk starker, emotional positiver Beziehungen zu leben.
Wir leben in aufregenden Zeiten, was die Hundewissenschaft betrifft. Genetik und Genomik, Gehirn- und Hormonforschung preschen immer weiter vor, um Fragen zu beleuchten, die viele Wissenschaftler bisher noch nicht einmal gestellt haben: Wie sind unsere Hundefreunde dazu in der Lage, solch außergewöhnliche Brücken der Zuneigung zu anderen Spezies zu schlagen? Welche Umstände müssen im Leben eines Hundes gegeben sein, um sicherzustellen, dass Bande der Zuneigung fest geknüpft werden? Und wie konnten Hunde diese Fähigkeit in (nach evolutionären Maßstäben gemessen) so kurzer Zeit entwickeln? Die Beantwortung dieser Fragen war in den letzten Jahren das Ziel einiger der spannendsten Studien von Pionieren der Wissenschaft an der Frontlinie moderner Hundeforschung. In diesem Buch möchte ich ihre Erkenntnisse neben den meinigen beschreiben.
Aber es reicht nicht aus, Hunde nur zu studieren und sie zu verstehen. Wir müssen vielmehr dieses Wissen dazu benutzen, dass Hunde ein reicheres und erfüllteres Leben führen können. Hunde vertrauen uns, und doch enttäuschen wir sie in so vielerlei Hinsicht. Wenn dieses Buch irgendetwas bewirkt, dann hoffentlich zumindest das – Menschen zu der Einsicht zu bringen, dass Hunde etwas Besseres verdienen. Sie haben ein Recht auf mehr als das isolierte und unglückliche Leben, das wir ihnen so oft zumuten. Sie verdienen unsere Liebe im Gegenzug zu der, die sie uns so freigiebig schenken.
Dies sind nicht nur meine tiefsten Überzeugungen als Hundefreund, sondern auch meine wohldurchdachten und von Daten gestützten Schlussfolgerungen als Wissenschaftler. Als jemand, der sich selbst einmal darin schuldig gemacht hat, die Idee von der Liebe der Hunde als abwegige Sentimentalität abzutun, lassen Sie mich nochmals wiederholen: Nach vielen Jahren und gegen meine eigenen Neigungen habe ich ein unerhörte Menge an Beweisen gefunden, um die Theorie von der Liebe der Hunde zu stützen und nur sehr wenige, die sie unterminieren. Das ist keine Gefühlsduselei, sondern Wissenschaft.
Manchmal wird mir durchaus zu bewusst, dass ich nach so vielen Jahren der schonungslos skeptisch betriebenen Forschung zu tierischer Intelligenz letzten Endes eine Sicht auf Hunde befürworte, die so manch einer als überzuckert bezeichnen würde. Aber damit kann ich leben, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es Hunden mit dieser Ansicht besser gehen wird, wenn nur mehr Menschen dazu gebracht werden können, sie zu übernehmen.
Außerdem empfinde ich es als außerordentlich befriedigend, nun zu wissen, dass das, was ich vor all den Jahren mit Benji erlebt habe, real und richtig war. Liebe war die Quintessenz dieser Beziehung, wie es bei beinahe jedem Austausch zwischen Mensch und Hund der Fall ist. Viele Hundefreunde wussten schon die ganze Zeit, dass die Wissenschaftler auf dem Holzweg waren, wenn sie meinten, dass die Besonderheit von Hunden in ihrem Verstand anstatt in ihrem Herzen zu suchen sei. Aber jetzt wenigstens holt die Forschung endlich auf.