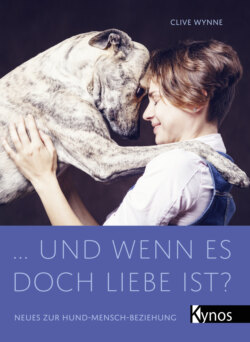Читать книгу ... und wenn es doch Liebe ist? - Clive Wynne - Страница 8
ОглавлениеAls ich Xephos zum ersten Mal sah, schien sie schrecklich winzig. Zum Teil war das ihr eigenes Werk: sie hatte ihren kleinen Körper auf dem Betonboden des Tierheimzwingers zu einem verängstigten Ball zusammengerollt. Überall um sie herum hüpften andere, größere Hunde in ihren Zwingern auf und ab und bellten, um meine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Aber die arme Xeph hatte sich hingekauert und war zu verängstigt, um etwas anderes zu tun, als unter ihrem Hinterlauf hindurch zu dem unbekannten Besucher zu spähen.
Das Tierheim war sauber und der ehrenamtliche Mitarbeiter, der mich zwischen den Zwingern herumführte, strahlte echte Fürsorge für seine Schützlinge aus – und dennoch fiel es schwer, hier nicht in gedrückte Stimmung zu geraten. Xephos‘ Zuhause war eine kahle, gefängnisähnliche Welt aus Metallgitterstäben und nackten, harten Oberflächen: ein lauter, nichtssagender Raum aus Stahl und Beton. Der Lärm, der von ihren Nachbarn ausging, war anstrengend. Ich wollte nichts wie schnell wieder von dort weg, und ich bin mir sicher, dass es Xephos und den anderen Hunden genauso ging.
Ich war mit meiner Frau Ros und meinem Sohn Sam in dieses Tierheim im Norden Floridas gekommen, weil die beiden beschlossen hatten, mich zu meinem Geburtstag mit einem Hund zu „überraschen“. Ich benutze die Anführungszeichen, weil sie mich klugerweise in ihr Geheimnis eingeweiht hatten. Niemand sollte je einen geliebten Menschen mit einem lebenden Tier als Geschenk tatsächlich überraschen: die Verantwortung der Sorge für ein anderes Lebewesen ist einfach viel zu groß. Bei uns war es so, dass Ros und Sam, nachdem ich ihrer Idee zugestimmt hatte, die ganze Arbeit auf sich nahmen, um einen passenden Hund für mich zu finden, damit ich trotzdem das Gefühl haben sollte, ein Geschenk zu bekommen.
Als wir uns 2012 endlich dazu entschlossen hatten, einen Hund zu uns zu nehmen, hatte ich mich mehrere Jahre lang in einer wissenschaftlichen Einrichtung mit Hunden befasst, ohne selbst einen zu Hause zu haben, der dort auf mich wartete. Mit all den Umzügen rund um die Welt und der Tatsache, dass wir Eltern wurden, war mir mein Leben zu kompliziert erschienen, um noch hündische Gesellschaft mit in die Mischung einzubringen. So sehr ich es früher genossen hatte, mein Zuhause mit einem Hund zu teilen, so hielt ich es dennoch zu diesem Zeitpunkt nicht für richtig, einem Hund unsere unvorhersehbaren Terminpläne und häufigen Abwesenheiten zuzumuten. Ich war damals der Meinung – und bin es auch heute noch – dass es einfach nicht im Leben jedes Menschen einen hundeförmigen Leerraum gibt, in den ein Welpe hineinschlüpfen könnte.
Aber irgendwann wurde klar, dass meine Familie jetzt sehr wohl dazu bereit war, einen Hund aufzunehmen. Vor allem hatte ich wirklich begonnen, mich nach einem zu sehnen. Ich verbrachte in meiner Arbeitszeit so viele Stunden mit Hundebesitzern und Hunden oder in Tierheimen, wo so viele tolle Hunde auf ein neues Zuhause warteten, dass es sich seltsam anfühlte, abends in ein hundeloses Heim zu kommen. Weil sie meine Sehnsucht spürten und außerdem selbst insgeheim nach einem Hund schielten, hatten Ros und Sam es sich zur Aufgabe gemacht, einen für mich zu finden.
Weil sie das Überraschungselement beizubehalten versuchten, vermieden es Ros und Sam, mich um Hilfe zu bitten – und so kam es, dass wir letzten Endes einen Hund in einem Tierheim anschauten, das ich nicht besonders gut kannte. Als Wissenschaftler, der sich auf die Erforschung des Hundeverhaltens spezialisiert hatte, hatte ich in diesem Teil Floridas Studien in vielen verschiedenen Tierheimen durchgeführt. Diesen speziellen Tierschutzverein hatten meine Kollegen und ich aber ausgelassen, weil viele seiner Schützlinge so ernsthafte Verhaltensprobleme zeigten, dass uns das Risiko für die jungen Studenten, die uns bei den Versuchen assistierten, zu hoch erschien. Alle Hunde mit irgendeiner Art von Verständnis dafür, wie sie Menschen ihre freundlichen Absichten mitteilen konnten, hatten schon längst neue Besitzer gefunden. So kam es, dass dieses Tierheim, in dem man auch keine Hunde einschläferte, größtenteils eine Population von Hunden beherbergte, die nicht wussten, wie man sich nach menschlichen Maßstäben wunschgemäß benimmt. Ob sie nun wirklich gefährlich waren oder nicht – diese armen Tiere hatten ganz klar keinerlei Ahnung, wie sie Menschen gegenüber ausdrücken sollten, dass sie gute Gefährten und Begleiter für sie wären.
Diese traurige Situation kündigte sich schon an, bevor man das Innere des Tierheims betrat. Die Hauptzwingeranlage war so laut, dass man die Kakophonie des Bellens schon vom Parkplatz aus hörte. Sobald man dann den Hunden selbst begegnete, zeigten sie Verhaltensweisen, die das genaue Gegenteil von einladend zu sein schienen. Meine Kollegen und ich hatten größten Respekt für die Leistungen dieses Tierheims und dessen Weigerung, irgendeins der Tiere einzuschläfern, die Eingang durch seine Türen gefunden hatten. Trotzdem hatten wir – hauptsächlich aus Sorge um unsere Studenten – das Gefühl, dort besser keine Studien durchzuführen. Folglich wäre ich auch nie auf die Idee gekommen, dort nach einem Hund zu schauen, wenn ich die Suche selbst organisiert hätte – was zum Glück nicht der Fall war.
Ros und Sam hatten am Tag vor unserem gemeinsamen Besuch bereits eine Erkundungstour zu diesem Tierheim unternommen und beschlossen, unbedingt zurückzukommen – und zwar aus einem einzigen einfachen Grund. Wie der glückliche Zufall es wollte, hatte das Tierheim gerade am Tag vor dem Besuch meiner Frau und meines Sohns einen neuen Junghund aufgenommen. Dieser befand sich noch im etwas ruhigeren (aber immer noch reichlich lauten) Quarantänebereich des Tierheims und war noch nicht in die Hauptzwingeranlage gebracht worden.
Ros und Sam kamen ganz begeistert von dem kleinen schwarzen Hund nach Hause, den sie gefunden hatten. Erstaunt über die Tatsache, dass sie anscheinend ein so nett klingendes Tier in einem Tierheim ausfindig gemacht hatten, das ich nur als Verwahrungsstätte für Hunde mit dem Urteil „lebenslänglich“ kannte, fuhr ich am nächsten Tag mit ihnen mit, um Xephos kennenzulernen.
Sie war ein armes, schüchternes, winziges Ding. Sie war etwa zwölf Monate alt, als wir sie trafen, schien aber viel jünger. Im Gegensatz zu den anderen Hunden in dem Raum, in dem sie gehalten wurde, winselte sie bei unserem Hereinkommen mehr, anstatt zu bellen. Sobald sie aus ihrem Zwinger gelassen wurde, rollte sie sich auf den Rücken und machte ein bisschen Pipi in dem verzweifelten Versuch, uns ihre Ergebenheit mitzuteilen. Sie zog ihren Schwanz so eng zwischen die Hinterläufe, wie es einem Hund nur möglich ist. Sie leckte unsere Hände, und als wir uns zu ihr hinunterbeugten, wollte sie unsere Mundwinkel abschlecken. Sie benutzte den ganzen Werkzeugkasten hündischer Verhaltensweisen, die dazu dienen, Respekt und den Wunsch nach Aufbau einer emotionalen Bindung zu zeigen. Mit allem, was sie hatte, schien sie zu sagen: „Ich bin euer Hund. Nehmt mich mit nach Hause und ich werde euch ergeben lieben.“ Das war ein schlagendes Argument und wir unterschrieben auf der Stelle.
Später erfuhren wir, dass Xephos ein hartes erstes Lebensjahr gehabt hatte. Sie war in einem anderen Tierheim der Stadt zur Welt gekommen. Ihre Mutter war dort, als sie trächtig war, abgegeben worden, und der Wurf schnappte so ziemlich jede Krankheit auf, die gerade die Runde machte. Mit der Zeit wurde Xephos gesund und wurde in ein Zuhause vermittelt, aber leider hatte ihre erste Familie beschlossen, sie nicht zu behalten. So kam es, dass Xephos wieder zurück im Tierheim landete, diesmal einem anderen – allein, verängstigt und dringend auf eine zweite Chance angewiesen.
Ich wusste damals genug über Tierheimhunde, um mir darüber klar zu sein, dass Xephos‘ Werdegang traurigerweise typisch war und dass die große Mehrheit der Hunde ihr Zuhause ohne eigenes Verschulden verliert. Aber als wir sie erst bei uns zuhause hatten, konnte ich trotzdem nicht anders, als abwartend zu lauern, welches unentschuldbare Verhalten vielleicht dazu geführt haben könnte, dass Xephos von ihrer ersten Menschenfamilie abgegeben worden war. Aber es zeigte sich rein gar nichts in dieser Richtung. Was nur die erste von vielen angenehmen Überraschungen war, die dieses herrliche kleine Wesen uns machen sollte – und eine der vielen Lektionen, die es mich lehren sollte.
Während ich dies hier schreibe, ist Xephos etwa acht Jahre alt. Sie ist nach wie vor genauso bezaubernd und angenehm im Zusammenleben, wie sie sich bei unserem Treffen zeigte, vielleicht sogar noch mehr. In den ersten Wochen mit uns legte sie nach und nach ihre Scheu ab und eine starke, fröhliche Persönlichkeit kam zum Vorschein. Trotz ihrer tiefschwarzen Farbe erhellt sie jeden Raum, in dem sie sich befindet. Sie ist kein schüchterner Junghund mit eingeklemmtem Schwanz mehr – heute ist es mehr als unwahrscheinlich, dass ein Besucher dieses Körperteil anders zu Gesicht bekommt als in stolzer, aufrechter Haltung. Sie ist solch eine herausragende Persönlichkeit, dass ich oft überrascht bin, wie körperlich klein sie eigentlich ist. Sie ist immer die Erste, die Besucher an unserer Tür begrüßt: Sie veranstaltet ein Bellkonzert, wenn sie Schritte näherkommen hört und die Türklingel geht, um dann zu freudigem Geheul zu wechseln, wenn beim Öffnen der Tür da jemand steht, den sie kennt. Sie kennt die Motorengeräusche der Autos ihrer besten Freunde und jault, anstatt zu bellen, wenn diese auf die Tür zukommen.
Bei allem, was sie mit Menschen tut, strahlt Xephos Zuneigung aus. Selbst mit meinem heutigen Wissen über die Gründe für ihre Geselligkeit kann ich nicht anders, als darüber zu staunen. Aber damals, als wir sie zu uns nach Hause holten, erschien mir ihr anhängliches Wesen nicht annähernd so logisch oder so wundersam, wie es das heute tut.
Natürlich hatte ich auch vorher schon mit Hunden zusammengelebt und wusste, wie herzlich ihre Reaktion auf unsere Spezies ausfallen kann. Und doch besaß ich als Wissenschaftler, der Hundeverhalten erforscht, keinen Referenzrahmen für diesen offensichtlich emotionalen Aspekt im Leben von Hunden. Die Vorstellung, dass Hunde zu Liebe – oder überhaupt irgendeinem Gefühl – in der Lage sein könnten, war Hundepsychologen wie mir zu der Zeit, als wir Xephos fanden, geradezu ein Dorn im Auge. Sie lag so weit außerhalb der Begriffe wissenschaftlicher Diskussion über Hunde, dass es mir noch nicht einmal in den Sinn kam, darüber nachzudenken.
Dennoch hatte ich an diesem Punkt meiner beruflichen Karriere bereits damit begonnen, auch andere allgemein tradierte Weisheiten über die kognitiven Fähigkeiten von Hunden zu hinterfragen. Schon kurze Zeit später sollte diese Skepsis mich zu einer wahren Gewissenskrise über das Innenleben von Hunden führen und darüber, was sie zu dem macht, was sie sind. Dieses Nachsinnen wiederum bedeutete für mich den Aufbruch zu einer Entdeckungsreise, die meine Beziehung zu Hunden grundlegend veränderte – nicht nur die zu Xephos, sondern auch zu den unglücklichen Vierbeinern, die immer noch in Tierheimen weggesperrt sind und zu der gesamten gleichzeitig so vertrauten und so missverstandenen Spezies, deren Teil sie sind.
Xephos trat zu einem entscheidenden Zeitpunkt meines Nachdenkens über Hunde in mein Leben. Als Ros, Sam und ich 2012 Xephos nach Hause holten, bemühte ich mich gerade, meine wissenschaftliche Forschung zur hundlichen Kognition mit den verschiedenen, damals allgemein akzeptierten Theorien zu den Gründen für den Erfolg von Hunden in der menschlichen Gesellschaft in Einklang zu bringen. Diese Theorien erklärten angeblich die Grundlagen von Beziehungen, wie wir sie nun mit diesem pelzigen kleinen Familienmitglied eingingen.
In den späten 1990er Jahren, als es danach aussah, dass die Forscher die willig zu ihren Füßen ruhenden Subjekte beinahe vollkommen vergessen hätten, erweckten zwei Wissenschaftler das Interesse an der Psychologie von Hunde zu neuem Leben, indem sie unabhängig voneinander neue Sichtweisen auf das Verständnis dieser Spezies und seiner besonderen Beziehung zu Menschen warfen. Ádám Miklósi an der Eötvös Lorand Universität im ungarischen Budapest und Brian Hare, damals Student an der Emory University in Atlanta, Georgia (heute Professor an der Duke University in North Carolina), kamen aus vollkommen unterschiedlichen Backgrounds, aber zu der gleichen Schlussfolgerung: Dass Hunde eine einzigartige Form von Intelligenz besitzen, die es ihnen ermöglicht, mit Menschen so auszukommen, wie kein anderes Tier es fertigbringt.
Hare hatte zu Beginn gar nicht die soziale Intelligenz von Hunden erforscht, sondern die von Schimpansen. Weil sie unsere nächsten lebenden Verwandten im Tierreich sind, sind Schimpansen die natürliche Anlauf-Spezies für jeden, der sich dafür interessiert, was die menschliche Kognition so einzigartig macht. Hare war fasziniert von dem uralten Rätsel, was genau Menschen so sehr aus dem Tierreich hervorstechen lässt. Spätestens seit Darwin hatten sich Wissenschaftler herauszufinden bemüht, was genau den Unterschied zwischen dem menschlichen Verstand und dem anderer Spezies ausmacht. Eine typische Herangehensweise an diese Frage lautet: Wenn du meinst, etwas gefunden zu haben, das nur Menschen können, dann teste es an Schimpansen; und wenn Schimpansen es nicht können, ist es unwahrscheinlich, dass irgendeine andere, nicht so eng mit dem Menschen verwandte Art es können sollte.
Zu dieser Zeit testete Hare gerade auf eine Fähigkeit, die uns Menschen sehr simpel erscheint. Wenn ich im Gegensatz zu Ihnen weiß, wo etwas für Sie Begehrenswertes versteckt ist, kann ich Ihnen den Ort mitteilen, indem ich mit meiner Hand darauf zeige. Hare wollte herausfinden, ob dies eine nur beim Menschen vorkommende Form des sozialen Verstehens ist oder ob auch Schimpansen die Bedeutung einer einfachen Zeigegeste verstehen könnten.
Hares Experiment war einfach. Er stellte zwei Becher umgedreht hinter eine Sichtschutzwand, sodass der Schimpanse sie nicht sehen konnte, und versteckte ein Stückchen Futter unter einem von ihnen. Dann nahm er den Sichtschutz weg und zeigte auf den Becher mit dem versteckten Futter. Wählte nun der Schimpanse den Becher mit dem Futter darunter, legte das nahe, dass er die Bedeutung der menschlichen Geste verstanden hatte.
Wie sich herausstelle, wählten Hares‘ Schimpansen die Becher mehr oder weniger zufällig aus. So leicht die Aufgabe auch klingt, für sie war es anscheinend zuviel verlangt.
Hare fand das Versagen der Schimpansen merkwürdig, weil er sicher war, dass sein Hund zuhause die gleiche Aufgabe mit Leichtigkeit lösen könnte. Als er genau das zu seinem Mentor Michael Tomasello sagte, versicherte dieser ihm, dass nicht die geringste Chance dafür bestünde, dass ein Hund mit walnussgroßem Gehirn Erfolg bei einer Aufgabe haben könnte, an der Schimpansen gescheitert waren.
Und so kam es dazu, dass Hare beim nächsten Mal, als er mit Oreo, dem Hund seiner Kindheit, zusammen zuhause war, in der Garage seiner Eltern stand – mit zwei umgedrehten Bechern, einer rechts und einer links von ihm. Sein Hund wartete geduldig, während Hare ein Stück Futter unter einem Becher versteckte und bei dem anderen Becher nur so tat. Dann zeigte er auf den Becher mit dem Futter und Oreo trottete ohne jedes Zögern geradewegs zum richtigen.
Hare war davon überzeugt, dass sein Hund nicht einfach nur erschnüffelte, wo das Futter versteckt war. Schließlich wusste Oreo, wenn Hare zwischen beiden Bechern stand und auf keinen von ihnen zeigte, nicht, wo er hingehen sollte. Es sah wirklich danach aus, als ob Oreo in der Lage war, Hares Zeigegeste zu verstehen – was bedeutete, dass das kleinhirnige Familienhaustier dort Erfolg hatte, wo der mit viel größerem Gehirn ausgestattete und engere Verwandte des Menschen, der Schimpanse, gescheitert war.
Das gab für Hare den Anstoß, zu einem Wolfsgehege nach Massachusetts zu reisen und dort handaufgezogene Wölfe ähnlichen Tests zu unterziehen. Weil alle Hunde von Wölfen abstammen, wollte Hare durch die Versuche an ihren wilden Verwandten überprüfen, ob die Fähigkeit der Hunde zur erfolgreichen Lösung dieser Aufgabe etwas war, das sie von ihren Vorfahren geerbt hatten oder eine Fähigkeit, die sich erst in der Evolution der Hunde erstmals herausgebildet hatte.
Die Ergebnisse von Hares Wolfsstudie legten nahe, dass Hunde in dieser Hinsicht wirklich ziemlich einzigartig sind. Er fand heraus, dass Wölfe im Gegensatz zu Hunden keine Ahnung hatten, was die Zeigegesten bedeuten sollten. Konfrontierte man die wilden Vettern der Hunde mit Hares Zeigegesten, waren sie genauso ahnungslos wie die Schimpansen.
Auf der anderen Seite der Erdkugel führte der ungarische Wissenschaftler Ádám Miklósi, ohne es zu wissen, beinahe genau das gleiche Experiment durch wie Hare – und kam zu beinahe genau den gleichen Ergebnissen. Während man Hares Weg als „von den Affen herab“ beschreiben kann, könnte man den von Miklósi als „von den Fischen ausgehend“ bezeichnen. Miklósi hatte sich in Ungarn mit der Ethologie befasst – einer Wissenschaft, die sich mit auf das Verhalten von Tieren in ihrem natürlichen Lebensraum konzentriert – und das Labor, in dem er arbeitete, hatte sich ursprünglich mit dem Studium kleiner Fische befasst. Mitte der 1990er Jahre hatte dessen Direktor jedoch entschieden, dass es nun an der Zeit war, ein Tier von direkterer Relevanz für das Leben der meisten Menschen zu untersuchen, weshalb Miklósi dazu kam, Hunde anstatt von Fischen zu beobachten. Seine Forschungsgruppe ging der Frage nach, ob Menschen und Hunde sich in Psychologie und Verhalten in der Evolution so entwickelt hatten, dass sie sich gegenseitig besser verstehen konnten. Ohne zu wissen, woran Hare in Atlanta arbeitete, führten Miklósi und seine Studenten in Budapest genau den gleichen Prozess durch. Zuerst untersuchten sie, ob Haushunde dazu in der Lage waren, den Zeigegesten von Menschen zu folgen und stellten fest, dass diese darin höchst erfolgreich waren. Anschließend zogen sie einige Wolfswelpen von Hand in ihren Budapester Wohnungen auf und fanden heraus, dass die Wölfe ihre Handbewegungen nicht nutzen konnten, um Futter zu finden.
Nachdem Hare diese und andere Studien analysiert hatte, folgerte er, dass Hunde eine über die Jahrtausende des Zusammenlebens mit dem Menschen angezüchtete, genetische Prädisposition dafür besitzen müssten, die Kommunikationsabsichten und einiges von der sozialen Intelligenz der Menschen zu verstehen. Diese Fähigkeit, so argumentierte Hare, sei jedem Hundewelpen angeboren und entwickle sich spontan in jedem einzelnen von ihnen, selbst dann, wenn er keine Erfahrung mit uns Menschen und den Dingen hat, die wir tun. Hare stritt nicht ab, dass es mit minutiösem Training möglich sein könnte, auch Tieren anderer Spezies einige Aspekte dessen beizubringen, was Hunde leisten können, aber seiner Meinung nach waren nur Hunde dazu geboren, Menschen auf diese Art und Weise zu verstehen – der entscheidende Unterschied zwischen ihnen und jedem anderen nichtmenschlichen Lebewesen auf diesem Planeten.
Als Hare seine Schlussfolgerungen erstmals 2002 veröffentlichte, fand ich sie wirklich aufregend – und befand mich außerdem an einem Punkt meiner Karriere, an dem ich dazu bereit war, mich von etwas Neuem inspirieren zu lassen. In jenem Jahr war ich gerade als junger Nachwuchsprofessor an der psychologischen Fakultät der Universität von Florida gelandet. Das vorangegangene Jahrzehnt hatte ich an der University of Western Australia verbracht, wo ich das Verhalten von Beuteltieren wie etwa der dickschwänzigen Schmalfußbeutelmaus studierte – einem entzückenden, mausähnlichen Tierchen mit weniger als drei Gramm Gehirnmasse, das aber dennoch zu schnellem Lernen in der Lage war. Der Umzug nach Florida war spannend für mich, bedeutete aber auch den Abschied von den Beuteltieren, die mich so sehr fasziniert hatten. Ich hatte bis jetzt noch nicht daran gedacht, mein Interesse Hunden zuzuwenden, aber als ich Hares Forschungsergebnisse las, war ich fasziniert von der Vorstellung, dass ein Canide ohne besondere Ausstattung im entsprechenden Gehirnbereich irgendwie Formen der Kognition erworben haben sollte, deren Vorkommen ansonsten nur bei unserer eigenen, notorisch gehirnlastigen Spezies bekannt sind.
Hares‘ Forschungsergebnisse begannen ungefähr zu der gleichen Zeit in der wissenschaftlichen Literatur zu erscheinen wie die ersten Artikel mit DNA-Analysen des Hundes. Der Input der Genetiker trug eine weitere, faszinierende Komplexitätsebene zu der Diskussion bei, was Hunde so einzigartig macht.
Genetiker schätzen das Alter einer Spezies, indem sie deren Genmaterial mit dem eng verwandter Arten vergleichen, und Studien aus Schweden, China und den USA ergaben, dass der Domestikationsprozess, der die Haushunde hervorgebracht hatte, nach evolutionären Maßstäben extrem schnell abgelaufen war. Anstatt der Millionen Jahre, die zu merklichen Veränderungen bei einer so relativ großen und langlebigen Spezies wie dem unmittelbarsten Vorfahren des Hundes, dem Wolf, nötig waren, waren Hunde innerhalb von nur wenigen Zehntausenden von Jahren – höchstenfalls! – auf der Bühne erschienen. Wölfe pflanzen sich normalerweise nur einmal pro Jahr fort und werden erst in ihrem zweiten Lebensjahr geschlechtsreif. Für uns mag das jung klingen, aber im Vergleich zu den meisten anderen Tieren ist das ein sehr langsamer Lebenszyklus. Die Geschwindigkeit der Evolution ist notwendigerweise daran gekoppelt, wie lange die Individuen brauchen, um die nächste Generation ihrer Art hervorzubringen. Folglich kann ein Tier, das nur alle zwei Jahre eine neue Generation hervorbringen kann, sich evolutionär nur sehr langsam weiterentwickeln.
Diese beiden parallel verlaufenden Forschungsstränge begannen sich in meinem Gehirn miteinander zu verweben. Wenn, wie Hare behauptete, Hunde wirklich mit der einzigartigen Gabe gesegnet wären, uns Menschen von Natur aus zu verstehen, dann müssten sie diese Fähigkeit in nur einem Wimpernschlag der Evolution herausgebildet haben. Wie, so begann ich mich zu fragen, konnten sie diese Fähigkeit derart schnell erwerben?
Gerade, als diese Fragestellung in meinen Gedanken Form anzunehmen begann, kreuzte die ideale Studentin meinen Weg, um mir bei deren Beantwortung zu helfen. Monique Udell kam nicht nur sowohl aus Psychologie und Biologie, sondern war auch mit einer unglaublichen Bereitschaft zu reiner, harter Arbeit gesegnet. Außerdem war sie auch noch willens, eine Doktorarbeit bei einem Mentor in Angriff zu nehmen, der sich Forschung zu einer Spezies wünschte, die er zuvor noch nie studiert hatte. Zusammen begannen Monique und ich, die Bedeutung dieser spannenden neuen Ergebnisse für Evolution und Kognition der Hunde zu entdecken.
Wir begannen, indem wir das Zeige-Experiment von Miklósi und Hare mit einigen Familienhunden in deren jeweiligem Zuhause wiederholten. Das war recht einfach zu bewerkstelligen, und die Ergebnisse unserer Studie stimmten exakt mit denen von Hare und Miklósi überein: Haushunde sind in der Tat außerordentlich sensibel für die Handlungen und Absichten von Menschen. Wir versteckten Futter unter einem von zwei auf dem Boden stehenden Behältnissen, und wenn Monique auf den zeigte, unter dem das Leckerchen versteckt war, liefen die Hunde ganz genau dorthin. Es war, als ob sie den Artikel in der Wissenschaftszeitschrift auch gelesen hätten.*
Wir hatten nun zwar Ergebnisse erhalten, die exakt mit dem übereinstimmten, was Hare und Miklósi über Hunde gesagt hatten, aber noch nicht unsere größere Frage beantwortet: Was, wenn überhaupt, hat bei Hunden die schnelle Evolution der Fähigkeit zum Verstehen menschlicher Gesten angetrieben? Wie haben Hunde diese Eigenschaft erworben?
Kaum hatten Monique und ich unsere Aufmerksamkeit diesem Problem zugewandt, als sich ganz von selbst eine Gelegenheit zu seiner Untersuchung bot, nämlich in Form einer Einladung von den Verwaltern der Forschungseinrichtung „Wolf Park“ in Indiana, die gern wollten, dass wir kämen und Versuche mit ihren Wölfen anstellten.
Es war nicht unbedingt ein Übermaß an körperlichem Mut, das mich zu einem Leben als Universitätsprofessor bewogen hatte, weshalb ich kein Problem damit habe, zuzugeben, dass ich doch einige Beklemmung empfand, als ich im Seminarraum des Wolf Park saß und der Pflichtunterweisung der Direktorin Pat Goodman zu Sicherheitsmaßnahmen im Umgang mit Wölfen zuhörte.
Die Regeln zur Interaktion mit den Bewohnern von Wolf Park sind recht einfach. Einen Wolf nicht direkt anstarren, aber ihn andererseits auch keinen Moment aus den Augen lassen. Wichtig ist, keine plötzlichen Bewegungen zu machen, aber ebenso wichtig, nicht einfach still dazustehen und die Arme nutzlos hängen zu lassen. Wenn man sich zu unbeweglich gibt, könnten die Wölfe einen irrtümlich für ein Kauspielzeug halten, erklärte Pat, was auf mich nicht unbedingt eine beruhigende Wirkung hatte. Aber das Wichtigste, machte sie klar, ist es, nicht auf einen Ast oder auf ein Kaninchenloch zu treten, denn anscheinend ist es wohl sehr schwierig, einen Wolf wieder von jemandem wegzuziehen.
Durchaus wachgerüttelt von dieser mehr als einstündigen Aufzählung der wirklich üblen Dinge, die ein neunzig Kilo schwerer Grauwolf mit einem mickrigen Psychologieprofessor anstellen kann, war ich letzten Endes zur ersten Begegnung mit meinen Forschungssubjekten bereit. Es war Zeit, sich gegen den kalten Septembertag zu wappnen und sich in Richtung Wolfsgehege aufzumachen.
Wolf Park ist eine Oase angenehm sanften Hügellandes in den unendlichen, tellerflachen Ebenen im Herzen Indianas. Bis ganz heran an den Eingang des Parks gibt es nichts als Flachland, aber das Grundstück, auf dem der Park selbst liegt, bietet mit einem Bach, ein paar bewaldeten Ecken und einem schönen, großen See, in dem die Wölfe spielen können, eine willkommene Abwechslung in der Topographie. Als einer der wenigen baumbestandenen Flecken inmitten Tausender von Hektar Sojabohnen und Mais dient der Park auch als Zufluchtsort für Vögel, was der angenehmen Szenerie zusätzlich eine fröhliche Hintergrundmelodie verleiht. Es ist wirklich ein wunderschöner Ort, aber ich muss zugeben, dass ich nicht sicher bin, wie viel davon ich bei unserem Besuch wirklich wahrgenommen habe. Ich war eher auf die großen Carnivoren konzentriert, deren Zuhause ich mich gerade zu betreten anschickte.
Der Moment der Wahrheit – und des Schreckens – kam, als Monique und ich das Wolfsgehege betraten. Kaum war ich durch das Tor im Maschendrahtzaun geschlüpft, als einer der älteren Wölfe, Renki, auf mich zugestürmt kam. Bevor ich noch die Hände aus meinen Jackentaschen nehmen konnte, hatte er seine beiden Vorderpfoten auf meine Schultern gepflanzt. Ich hatte gerade noch Zeit für den Gedanken „Mach’s gut, du schnöde Welt“, bevor Renki mir kraftvoll über beide Wangen schleckte.
Ich begriff augenblicklich, wie es sich anfühlt, in einem Wolfsrudel akzeptiert zu werden, und ich kann Ihnen sagen, große Erleichterung ist kein unerheblicher Teil davon. Ich stand noch eine Weile länger herum, um meine neuen Rudelgefährten und Forschungssubjekte kennenzulernen. Letzten Endes, als ich mich in Gegenwart der Wölfe angemessen wohlfühlte und klar war, dass diese nichts gegen meine Anwesenheit hatten, machte ich mich an die Durchführung des Experiments, das mich in erster Linie in den Wolf Park geführt hatte.
Monique und ich waren in den Wolf Park eingeladen worden, weil man dort von den neuen Forschungsergebnissen aus den Laboren von Brian Hare und Ádám Miklósi gehört hatte. Insbesondere hatte man Notiz von (und Anstoß an) den Behauptungen genommen, dass Hunde eine einzigartige Fähigkeit zur Verfolgung der Implikationen menschlichen Handelns besäßen: eine Fähigkeit, die Hunde, so Hare, mit keinem anderen Tier teilten, auch nicht mit Wölfen.
Es kann nur wenige Menschen auf diesem Planeten mit einem nuancierteren Verständnis von Wolfsverhalten geben als die Angestellten und Freiwilligen von Wolf Park. Seit 1974 ziehen sie Wölfe von Hand auf, dienen ihnen als Ersatzeltern und begleiten sie beim Erwachsenwerden, sodass diese Wildtiere Menschen als Sozialpartner akzeptieren. Die Leiterin Pat Goodman und der Gründer Erich Klinghammer haben die Techniken dazu perfektioniert. Dazu gehört unter anderem, dass eine menschliche „Mutter“ in den ersten Lebenswochen der Wolfswelpen rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche bei ihnen bleibt, sodass diese beim Aufwachsen Menschen als Teil ihres sozialen Gefüges zu betrachten lernen. Pat und viele aus dem Team von Wolf Park haben auch Hunde zuhause, sodass sie ihre Arbeitszeit mit Wölfen und ihre Freizeit mit Hunden verbringen – ein Arrangement, das den Angestellten einen besonders geschärften Sinn für die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen handaufgezogenen Wölfen und Hunden verschafft.
Die Aufnahme des Autors in das Rudel von Wolf Park.
Es waren also diese einzigartig gut informierten Wolfs- und Hundemenschen, die mit mir Kontakt aufnahmen, um mir mitzuteilen, dass Hare und Miklósi falsch lagen. Diese Wolf Park Mitarbeiter hatten den starken Eindruck, dass die Wölfe, mit denen sie ihre Tage verbrachten, in jeder Hinsicht genauso sensibel gegenüber den Dingen waren, die Menschen so tun, wie die Hunde, die jeden Abend zuhause auf sie warteten.
Hare und Miklósi hatten natürlich beide Versuche mit Wölfen gemacht, um genau dieser Frage nachzugehen, und sie waren unabhängig voneinander zu dem Schluss gekommen, dass Wölfe nicht zum Verständnis menschlicher Gesten fähig sind. Ich hatte keinen besonderen Grund, ihren Ergebnissen mit Skepsis gegenüberzutreten, insbesondere, da diese aus voneinander unabhängigen Laboren von unterschiedlichen Seiten des Atlantiks stammten. Aber zumindest dachte ich, dass es Spaß machen würde, das Wolfsexperiment einmal selbst auszuprobieren. Zusätzlich hatte die Skepsis der Wolf Park Mitarbeiter meine Neugier geweckt. War es denkbar, dass die Wölfe in den Studien von Hare und Miklósi, die in einem Tierheim in Massachusetts beziehungsweise in mehreren Budapester Wohnungen von Hand aufgezogen worden waren, gar nicht repräsentativ für die Spezies als Ganzes waren?
Ich hatte zuvor noch niemals Wölfe von Nahem gesehen und war sowohl von ihrer respekteinflößenden Kraft als auch von ihrer offensichtlichen Intelligenz tief beeindruckt. Diese Wölfe hatten das Maß der größten Hunde – ich dachte sofort an Riesenrassen wie den Irish Wolfhound. Aber im Gegensatz zu großen Hunden, die eher dazu neigen, langsam in ihren Reaktionen zu sein, sind Grauwölfe schnell. Wirklich schnell. Wenn ein Kaninchen innerhalb ihres Geheges aus einem Erdloch auftaucht, dann bäm, haben sie es im gleichen Augenblick. Sie töten wie Profis, mit Berechnung und ohne Reue.
Aber ebenso beeindruckend wie die potenzielle Lebensgefahr, die von ihnen ausgeht, ist ihre Geselligkeit. Der Umgang der Wölfe untereinander und mit Menschen, die sie kennen, ist vielschichtig und bewegend zu beobachten. Ihre bernsteinfarbenen Augen scheinen vor intensiver Präsenz im gegenwärtigen Moment nur so zu glühen. Ich fühlte mich wirklich privilegiert, dass sie mich in ihr Leben ließen.
Außerdem war mir klargeworden, dass auch in der Wissenschaft Vorsicht stets die Mutter der Porzellankiste ist. Nachdem wir mit den Angestellten gesprochen, die Sicherheitsunterweisung absolviert und uns ins Gehege gewagt hatten, um uns den Wölfen vorzustellen, hatten Monique und ich uns dazu entschieden, unser Glück nicht herauszufordern. Wir verließen das Gehege und überließen es anderen, den Tieren besser vertrauten Menschen, die erste Runde der Zeigeversuche für uns durchzuführen. Anstatt selbst die Becher mit den Leckerchen darunter zu hantieren und darauf zu zeigen, riefen wir den Wolf Park Leuten Anweisungen zu, die dann für uns die Tests durchführten. Wir alle waren der Meinung, dass dies ungefährlicher war und wahrscheinlich auch die tatsächlichen Fähigkeiten der Wölfe besser zum Vorschein bringen würde. Monique und ich hatten die Hoffnung, dass wir nach einer gewissen Zeit, wenn die Wölfe sich mit uns wohl fühlen würden, Teile der Arbeit selbst würden durchführen können – aber bei diesem ersten Besuch wollten wir unsere Erfolgschancen erhöhen, indem wir die Fremden gegenüber oft misstrauischen Wölfe zunächst mit ihnen gut bekannten Menschen arbeiten ließen.
Einige Beschäftigte halfen dabei, ein ungenutztes Gehege zu säubern, sodass anschließend nacheinander die Wölfe für die Versuche hineingebracht werden konnten. Pat Goodmann und zwei Mitarbeiter wechselten sich in drei Rollen ab: zwischen zwei Behältern stehen und auf einen davon zeigen; etwa drei Meter weit weg stehen, um den Wolf nach Versuchsende wieder an die Startposition zurückzulocken; und letztlich, einfach nur anwesend zu sein, um aufzupassen, dass niemand in Gefahr geriet. Monique und ich riefen Anweisungen durch den Zaun und lieferten Nachschub an kleingeschnittenen Würstchen, die unsere unermüdlichen Helfer nutzten, um die Wölfe für ihre korrekte Entscheidung zu belohnen und sie zurück zum Start zu locken, nachdem jeder Testdurchlauf beendet war.
Es dauerte eine Weile, bis alles in Gang kam, aber sobald alles und jeder an seinem Platz war und die Studie zu laufen begann, waren Monique und ich sehr schnell bass erstaunt: die Wölfe schnitten bei dieser Aufgabe in jeder Hinsicht genauso gut ab wie die in diesem Versuch erfolgreichsten Hunde.
In nur einem einzigen Augenblick hatte unser Versuch erheblich komplizierter gemacht, was zuvor noch wie eine klar abgegrenzte Linie zwischen den kognitiven Fähigkeiten von Hunden und Wölfen ausgesehen hatte. Für einen Wissenschaftler wie mich, der besessen davon ist, jeden sprichwörtlichen Stein umzudrehen, um nachzuschauen, was sich darunter verbirgt und dessen ganze Welt sich darum dreht, neue, nach Antwort verlangende Fragen aufzuwerfen, verursachen Momente wie dieser ein seltenes Kribbeln. Zufällig fiel unser erster Besuch im Wolf Park auf meinen Geburtstag, und diese Entdeckung war das bei weitem denkwürdigste Geburtstagsgeschenk, das ich je bekommen hatte – von Xephos natürlich abgesehen.
Sobald ich über die erste Aufregung über dieses unerwartete Ergebnis hinweg war, führten wir den gleichen Versuch auch noch mit mehreren anderen Wölfen des Parks durch. Wir fanden das gleiche Verhaltensmuster immer und immer wieder: Diese Wölfe konnten menschlichen Zeigegesten genauso gut folgen wie jeder Hund.
Auf unserem Rückweg nach Florida grübelten Monique und ich über die möglichen Gründe für diese Diskrepanz zwischen unseren Beobachtungen und Brian Hares Theorie der angeborenen „Genialität“ von Hunden nach. Wir wussten, dass Genialität – oder wie immer man die bemerkenswerte Sensibilität der Hunde gegenüber Menschen nennen mag – nicht nur dem evolutionären Erbe unserer Vierbeiner zugeschrieben werden kann. Selbstverständlich ist die Evolution (und jener spezielle Fall von Evolution, den wir als Domestikation bezeichnen) ohne Zweifel ein wichtiger Faktor, aber es gibt noch eine weitere entscheidende Komponente, die allem, was ein Tier tut, zugrunde liegt – eine, die eine ebenso bedeutende Rolle in der Bestimmung dessen spielt, ob ein Hund – oder Wolf – die Absicht aus menschlichen Gesten herauslesen kann, nämlich „Nurture“ statt „Nature“, sprich Lernerfahrungen statt angeborenes Wissen.
Evolution ist das Ergebnis natürlicher Selektion, der Prozess, durch den sich Arten verändern, weil individuelle Organismen mit verschiedenen Sets genetischer Merkmale geboren werden, die einen besseres Überleben und mehr Nachkommen in der nächsten Generation als anderen ermöglichen. Über zahllose Generationen hinweg werden einige dieser Merkmale selektiert und weitergegeben, sodass die komplexe Gesamtheit einer ganzen Spezies mit seinem eigenen, einzigartigen Kaleidoskop von Merkmalen gefärbt wird – darunter die anatomischen und kognitiven Besonderheiten (wie zum Beispiel Intelligenz), welche die Basis für das typische Verhalten dieser Art legen.
Domestikation ist ein Sonderfall der Evolution und einer, dessen Mechanismen schon Thema so mancher Debatte waren. Darwin, der die Welt mit dem Konzept der Evolution bekannt gemacht hat, glaubte, dass Tiere dann domestiziert wurden, wenn Menschen zur Weiterzucht diejenigen Individuen auswählten, die ihnen am nützlichsten waren. Mit der Zeit, so Darwins Theorie, würde so eine ganz neue Spezies entstehen. Er bezeichnete den Prozess der Domestikation als künstliche Zuchtwahl oder Auslese – im Gegensatz zur natürlichen Zuchtwahl, die er als Begriff dafür prägte, was geschieht, wenn die Kräfte der Natur entscheiden, wer weiterlebt und wer stirbt. Heute sind wir uns nicht mehr so sicher, ob wir die ganze Geschichte der Domestikation wirklich auf das Konto unserer eigenen Spezies verbuchen können: wahrscheinlicher ist, dass ein Großteil der Domestikation eigentlich aus natürlicher Auslese bestand. Aber egal, ob sie das Ergebnis künstlicher oder natürlicher Auslese ist: Domestikation ist eine Form von Evolution – ein Prozess, in dessen Verlauf sich Lebewesen über Generationen hinweg verändern, weil manche Individuen ausgewählt werden, um zu überleben, zu gedeihen und ihre Gene weiterzugeben.
Aber die Evolution allein kann noch kein freundliches Gesellschaftstier für ein menschliches Zuhause formen. Natürliche und künstliche Auslese können sicherlich an den Grundlagen des typischen Verhaltens und an der Intelligenz eines Tieres wirken, aber Evolution kann niemals allein ursächlich für die einzigartige kognitive und verhaltensmäßige Gesamtausstattung (von uns häufig als „Persönlichkeit“ bezeichnet) eines individuellen Hundes sein. Dies liegt daran, dass die Evolution zwar einen Entwurf für ein Lebewesen niederlegt, aber keine Kontrolle darüber ausüben kann, wie dieser Entwurf gelesen werden wird. Jedes einzelne Tier besteht aus genetischer Information, die von besonderen Erfahrungen, die es im Verlauf seiner Entwicklung macht, ausgelesen wird. Folglich kann Evolution allein keinen freundlichen Hund hervorbringen.
So wie unsere Beine, die uns die Fähigkeit zum Gehen verleihen, Teil unseres evolutionären Erbes sind, so sind es auch die Strukturen in unserem Gehirn, die unsere Persönlichkeiten entstehen lassen. Und was auf uns zutrifft, stimmt genauso auch für unsere Hunde: sie erben Gehirnstrukturen, die sie darauf vorbereiten, Beziehungen mit Menschen eingehen zu können. Aber die Tatsache, dass mein Hund eine Beziehung zu mir hat und sensibel auf die Handlungen von Menschen in seinem Leben reagiert, ist nicht nur allein eine Folge der Evolution seiner Art, sondern sie hängt auch davon ab, dass er in einer Welt aufgewachsen ist, die ihm Möglichkeiten zur Entwicklung der Eigenschaften gegeben hat, die ihn als Individuum ausmachen.
Kurz gesagt ist Erfahrung der weitere Faktor, der die Handlungen und den Verstand von Hunden formt. Das liegt, wenn man einmal darüber nachdenkt, auf der Hand: letztlich kommt kein Welpe, kein Kätzchen und kein Jungtier irgendeiner anderen domestizierten Tierart zahm zur Welt. Zahmheit muss von jedem Individuum in seiner eigenen Lebenszeit gelernt werden. Selbst der niedlichste Welpe wird zu einem wilden Tier heranwachsen, wenn er nicht früh in seinem Leben Menschen kennenlernt. (In den 1960er Jahren hat man übrigens Versuche durchgeführt, um genau das zu zeigen. John Paul Scott und John L. Fuller zogen in einem Labor in Bar Harbor, Maine, Hundewelpen ohne jeden Kontakt zu Menschen während ihrer ersten vierzehn Lebenswochen auf. Als sie dann die Hunde als junge Erwachsene testeten, waren sie, wie die Forscher es formulierten, „wie Wildtiere“ und ließen keine Annäherung zu.)
Biologen bezeichnen unsere evolutionäre Geschichte als Phylogenese und unsere persönliche Lebensgeschichte als Ontogenese. Sowohl in der Biologie als auch in der Psychologie ist es eine Binsenweisheit, dass jeder von uns das Ergebnis der Kombination unserer Phylogenese und Ontogenese ist. Niemand von uns wäre so gutaussehend, clever und charmant – geschweige denn bescheiden – wie wir zweifellos alle sind, hätte es nicht eine evolutionäre Geschichte gegeben, die uns die Bühne für Lebenserfahrungen bereitet hat – welche wiederum unsere Charaktere in die beneidenswerte Form modelliert haben, die sie heute besitzen. Das Gleiche trifft auch auf Hunde zu. Jeder von ihnen hat die Persönlichkeit, die er besitzt – eine, die Hunde, wenn sie Glück hatten, besonders geeignet für das Zusammensein mit Menschen mit all den damit verbundenen Vorteilen macht – nur dank eines reichhaltigen Zusammenwirkens zwischen seiner genetischen Ausstattung und der Welt, in die er hineingewachsen ist.
Die Auffassung, dass Verhalten und Intelligenz der Hunde sowohl von Domestikation als auch von Erfahrungen bestimmt sind, schien Monique und mir ziemlich unstrittig zu sein, wenn wir sie im Licht dieser grundlegenden wissenschaftlichen Prinzipien betrachteten – aber sie wurde zur Grundlage einer Streitfrage im gerade entstehenden Forschungsfeld der Kognition von Hunden und zu einer Debatte, in die Monique und ich ungewollt hineingerieten. Auf der einen Seite standen Wissenschaftler wie Hare und Miklósi, die argumentierten, dass das Talent des Hundes zum Verstehen des Menschen Folge einer einzigartigen, in der Evolution herausgebildeten kognitiven Fähigkeit sei – Teil des Geburtsrechts eines jeden Hundes und unabhängig von irgendwelchen besonderen Lebenserfahrungen. Auf der anderen Seite gab es Wissenschaftler wie Monique und ich, die der Meinung waren, dass sowohl geeignete Lebenserfahrungen als auch die genetische Ausstattung der Schlüssel dazu sind, warum Hunde so gute Begleiter für Menschen sind.
Für unsere Weigerung zum Akzeptieren der Vorstellung, dass Hunde als direkte Folge des evolutionären Domestikationsprozesses mit der angeborenen Fähigkeit zur Welt kämen, die Bedeutung menschlicher Handlungen zu verstehen, mussten wir wohl oder übel die Rolle von Spielverderbern in der Verhaltensforschung übernehmen. Nachdem wir die Ergebnisse unserer Studie im Wolf Park veröffentlicht hatten, bezeichnete mich ein Journalist als „Spaßbremse“ der hündischen Kognitionsforschung. Das saß.
Ich musste darüber nachdenken, wo ich da hineingeraten war. Wie konnte ich als jemand, dem das Denken von Tieren zutiefst wichtig war und der sein Leben dessen Erforschung gewidmet hatte, einen so negativen Ruf als Anzweifler ihrer kognitiven Fähigkeiten bekommen? Ich fühlte mich missverstanden und mehr als nur ein bisschen verletzt, dass meine Zuneigung zu Hunden mich in die Lage gebracht hatte, dass ich so wirkte, als würde ich sie abwerten wollen.
Ich konnte nachvollziehen, wie es für Menschen, die mich nicht kannten, so klang, als würde ich behaupten, dass an Hunden nichts Bemerkenswertes sei. Aber ich versuchte keinesfalls, abzustreiten, dass sie etwas ganz Besonders waren, sondern sogar ganz im Gegenteil: Es war doch die einzigartige Bindung der Hunde an Menschen gewesen, die sie für mich in erster Linie als Forschungsthema so interessant gemacht hatte. Genau wie die hundelieben Mitarbeiter im Wolf Park musste ich zur Inspiration und Motivation für meine tägliche Arbeit gar nicht weiter schauen als in mein eigenes Wohnzimmer, wo Xephos sich oft gesellig neben mir auf dem Sofa niederließ, wenn ich die neuesten wissenschaftlichen Artikel und Beiträge in der Publikumspresse las, um den wachsenden Unmut über Moniques und meine Forschung zu verfolgen.
Hunde sind einzigartig: Das war für mich keine Frage. Ich war lediglich skeptisch gegenüber der vorherrschenden Theorie, was es denn war, dass sie so besonders machte. Als Wissenschaftler war ich gerne bereit, das „Miesepeter-Etikett“ mit Stolz zu tragen: ich würde mich nicht zu einer Sicht auf Hunde drängen lassen, die ich einfach nicht akzeptieren konnte. Als Hundefreund konnte ich aber nicht anders, als bis auf den Grund dessen vorzudringen, was Hunde denn nun so besonders macht. Je mehr ich über die Kognition von Hunden und deren Leben innerhalb der menschlichen Gesellschaft lernte, desto klarer wurde mir, dass die Debatte, die in diesem Bereich geführt wurde, nicht nur ein akademischer Streit war. Es stand viel auf dem Spiel – vor allem für die Hunde selbst.
Zusätzlich zu unseren Tests an Wölfen und Haushunden zur Fähigkeit zum Verstehen menschlicher Gesten hatten Monique und ich zusammen mit Nicole Dorey, einer weiteren guten Freundin und Mitstreiterin, genau den gleichen Versuch in einem Tierheim nahe unserer Heimat in Gainesville, Florida, ausprobiert. Und die Ergebnisse waren nicht schön.
Kein einziger der Tierheimhunde in diesem Versuch verstand, was eine Zeigegeste zu einem auf dem Boden stehenden Behälter bedeuten sollte. Jeder von ihnen starrte Monique verständnislos an, wenn sie zwischen den beiden Behältern stand und darauf wartete, dass der Hund sich für einen entschied – oder ging zu ihr und setzte sich nett vor sie hin, um sie so niedlich wie nur irgend möglich darum zu bitten, ihm doch die Leckerchen zu geben, die sie zweifellos hatte. Oder aber der gute Wuff ging einfach fort und suchte sich eine bessere Beschäftigung.
Zuerst dachten wir, dass diese Hunde vielleicht früher schlechte Erfahrungen im Umgang mit Menschen gemacht haben könnten und vielleicht nicht darauf vertrauten, dass Monique etwas Nettes mit ihnen vorhaben könnte. Aber auch wenn es sicherlich stimmt, dass in Tierheimen jede Menge Hunde sitzen, die von unserer Spezies im Stich gelassen wurden und deren Vertrauen in Menschen enttäuscht wurde, so hatten wir doch für unsere Studie sorgfältig solche Hunde ausgesucht, die ganz klar Begeisterung dafür zeigten, sich in Gesellschaft von Menschen zu befinden – aus dem Zwinger geholt zu werden, bespielt zu werden und Leckerchen zu bekommen, die weit über die übliche Tagesration hinausgingen. Die Hunde, mit denen Monique arbeitete, schienen also einfach nur wirklich nicht zu verstehen, was ihre Zeigegesten bedeuten sollten.
Die vorherrschende Theorie über die Einzigartigkeit von Hunden hatte düstere Implikationen für diese begriffsstutzigen Wesen. Wenn wir glauben, dass alle Hunde mit einer angeborenen Fähigkeit zum Verstehen der Handlungen und Absichten von Menschen zur Welt kommen, wie Brian Hare und seine Kollegen argumentiert hatten, dann hätten solche Hunde, die menschliche Absichten offenbar nicht verstehen können, irgendeine Art von erheblichem kognitivem Defizit, das sie daran hindert, ihr evolutionäres Potenzial als Hunde voll auszunutzen. Wenn die Fähigkeit zum Verständnis menschlicher Gesten angeboren ist, dann muss auch das Nichtverstehen derselben angeboren sein. Dies könnte zu der Schlussfolgerung führen, dass Hunde wie die, die wir im Tierheim getestet hatten, einfach schlechter als Begleiter für Menschen geeignet wären.
Die Ergebnisse, zu denen Monique und Nicole in unserem örtlichen Tierheim gekommen waren, in dem kein einziger Hund ihren Zeigegesten folgen konnte, könnten damit zu schrecklichen Folgen für sehr viele Hunde führen – sowohl in dieser Einrichtung selbst, in der zu dieser Zeit das Einschläfern nicht vermittelbarer Hunde noch Teil des Standardvorgehens war, als auch in ähnlichen Tierheimen überall im Land und sogar auf der ganzen Welt. Millionen von Hunden werden jedes Jahr geopfert, weil sich kein Zuhause für sie finden lässt. Jedes Merkmal, das bestimmen helfen könnte, ob ein Hund im Tierheim bleibt oder mit neuen Besitzern nach Hause geht, könnte den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Für Wissenschaftler und Hundefreunde wie Monique, Nicole und mich konnte es nichts Wichtigeres geben, als zu verstehen, wie Hunde ein erfülltes Leben in menschlichen Heimen finden können.
Wir setzten also alles daran, zu verstehen, was mit diesen armen Vierbeinern im Tierheim nicht stimmte und was die Implikationen ihres Handicaps waren. Fehlten ihnen die Gene zum Verstehen von Menschen – sprich, hatte irgendetwas in ihrer Phylogenese sie unfähig zum Deuten unserer Gesten gemacht? Oder lag das Problem eher in ihrer Ontogenese, an etwas in ihrer persönlichen Geschichte, dass sie unfähig machte, Moniques Zeigegesten zu verstehen? Das würde uns eine Erklärung für ihr Defizit liefern und, so hofften wir, einen Weg zur Korrektur des Problems aufzeigen.
Falls diese Hunde in der Lage sein sollten, die Bedeutung menschlicher Zeigegesten verstehen zu lernen, dann kannten wir ein einfaches Hundetrainings-Prinzip, das es uns ermöglichen würde, ihnen genau das beizubringen. Jedes Mal, wenn man auf etwas zeigt, das den Hund interessiert – ein Stück Futter, einen Ball oder irgendetwas anderes – um ihm das begehrte Objekt finden zu helfen und er es erfolgreich ortet, wird dieser Erfolg belohnend wirken. Im Wissenschaftsjargon sagen wir, dass die Aktion, die der Hund gerade ausgeführt hat, verstärkt wurde. Und nach allem, was wir über Tierverhalten wissen, werden verstärkte Verhalten in der Zukunft mit größerer Wahrscheinlichkeit wiederholt.
Dieser einfache Verhaltensmechanismus, so vermuteten wir, müsste ausreichen, damit Hunde lernen können, menschlichen Zeigegesten zu folgen. Wenn Monique auf ein Leckerchen zeigen und der Tierheimhund, den sie gerade testete, es finden würde – und sei es auch zunächst nur durch Zufall –, dann müsste dieser Hund dazu neigen, ihren Hinweisen in Zukunft eher zu folgen. Und sollte das so der Fall sein, dann würde es bedeuten, dass mit den Hunden im Tierheim nicht etwa „irgendetwas nicht stimmte“. Vielleicht konnten sie einfach deshalb menschlichen Zeigegesten nicht folgen, weil sie bis jetzt noch nicht viele Erfahrungen mit Menschen gemacht hatten, die auf Dinge zeigen. Vielleicht hatten sie keine Gelegenheit zu lernen oder einfach vergessen, was menschliche Gesten bedeuten.
Alles, was wir tun mussten, war, zurück zum Tierheim zu gehen und zu schauen, ob es möglich war, die Hunde dort zum Folgen menschlicher Zeigegesten zu trainieren. Wir mussten nur auf den Behälter mit Futter zeigen und den Hund sehen lassen, was das Ergebnis sein könnte, wenn er sich für diesen entscheiden würde. Sollte das Training nicht funktionieren, dann würde das bedeuten, dass Hare Recht hatte und Hunde eine in der Evolution herausgebildete, angeborene Fähigkeiten zum Folgen menschlicher Zeigegesten hätten – ein ererbtes Talent, das manche Hunde dann irgendwie nicht mitbekommen hätten. Aber wenn es funktionieren würde, dann würde das wiederum heißen, dass Hunde deshalb lernen, menschlichen Zeigegesten zu folgen, weil sie persönliche Erfahrungen damit gemacht haben, dass diese darauf hinweisen, wo sich verstärkende Ergebnisse befinden. Anders gesagt würde es implizieren, dass die Fähigkeit der Hunde zum Verstehen menschlicher Gesten eher erlernt als angeboren ist – und dass sie sich deshalb in dieser Hinsicht nicht von anderen Tieren unterscheiden. Die Ursache für ihre außergewöhnliche Bindung an Menschen musste dann anderswo liegen.
Ich schlug Monique und Nicole vor, dass sie mit jedem Tierheimhund vielleicht einen ganzen Tag lang arbeiten sollten, um zu schauen, ob sie ihnen beibringen konnten, was es bedeutet, wenn eine Person auf etwas zeigt. Monique und Nicole meinten aber, dass eine halbe Stunde Zeit pro Hund ausreichend sein sollte, und ihr Bauchgefühl stellte sich als richtig heraus: zwölf von vierzehn der Hunde, die sie testeten, lernten in weniger als dreißig Minuten, menschlichen Zeigegesten zu folgen. Die Durchschnittszeit der zwölf erfolgreichen Hunde, um zu lernen, dahin zu gehen, wohin jemand zeigte, betrug sogar nur ganze zehn Minuten. Innerhalb von zehn Minuten hatte ein Hund, der bis dahin keine Ahnung gehabt hatte, was ein ausgestreckter menschlicher Arm zu bedeuten hat, sich in einen Hund verwandelt, der pflichtbewusst einer menschlichen Geste folgte.
Das war ein aufregendes Ergebnis: diese Hunde waren offensichtlich doch nicht verloren! Es wies außerdem darauf hin, dass wir unsere Bemühungen, Verhalten und Kognition von Hunden zu verstehen, mindestens noch verdoppeln mussten. Wir hatten ganz klar noch viel darüber zu lernen, was Hunde zu solch bemerkenswerten Begleitern von Menschen macht. Und wir könnten noch viel zum Wohlergehen von Hunden beitragen, wenn wir nur herausfinden würden, was genau sie zum Sonderfall macht.
Zeigen ist natürlich nur einer der vielen Wege, auf denen Menschen mit Hunden kommunizieren. Und die Art soziokognitiver Intelligenz, wie sie Brian Hare, Ádám Miklósi und ihre Kollegen als für Hunde einzigartig herausgearbeitet haben, ist nur ein Aspekt dessen, weshalb Menschen Hunde als etwas Besonderes betrachten. Zwar hatten Monique, Nicole und ich gezeigt, dass die Fähigkeit der Hunde zum Verstehen menschlicher Zeigegesten erlernt anstatt angeboren ist, aber es war immer noch denkbar, dass andere Formen hundlicher Intelligenz als das Erkennen von Zeigegesten die einzigartige Bindung zwischen Hund und Mensch zu erklären helfen könnten. Bevor wir also weitermachten, mussten wir auch diese anderen Arten von Intelligenz als nur bei Hunden einzigartig ausschließen.
Fragen Sie einen beliebigen Hundefreund und er wird Ihnen mindestens einen Hund nennen, den er als außergewöhnlich intelligent kennengelernt hat. In meinem Fall wäre dieses besondere Exemplar nicht Xephos (tut mir leid, Süße!), sondern eher Benji, der Hund meiner Kindheit aus dem England der 1970er Jahre.
Benji war, was viele Menschen als schlauen Hund bezeichnen würden. Hauptsächlich bedeutet das, dass er eine nachweisliche Fähigkeit zum Ausbrechen aus Haus und Garten hatte, um seine eigenen Interessen in der Welt da draußen zu verfolgen. Benji und ich wurden etwa zur gleichen Zeit erwachsen, aber während ich zum pickligen, schweigsamen Nerd wurde, war er ein Naturtalent im Umgang mit Mädels. (Auf seinem Halsbandanhänger stand „Hi, ich bin Benji. Meine Telefonnummer ist Shanklin 2371“ – aber wir pflegten Witze zu machen, dass er, wenn er gekonnt hätte, gerne „Ey Kleine, wie heißtu und wasis dein Telefon?“ auf die andere Seite geschrieben hätte. Wir stellten uns immer vor, wie er das in derbem Straßenslang sagte, weil er für uns die Verkörperung eines harmlosen Halbstarken mit zweifelhaftem Ruf war.) Benji war einer jenen eher kleinen und sehr gelenkigen Hunde, die sich durch die engste Lücke in einer Hecke zwängen und über überraschend hohe Mauern springen konnten. Mit Sicherheit war die Tatsache, dass wir ihn nie hatten kastrieren lassen, ein weiterer wichtiger Faktor, der zu seiner Neigung zu unplanmäßigen Ausflügen beitrug. Meine Mutter konnte schon das Wort Kastration nicht leiden und mein Vater betrachtete nichts, was mit dem Hund zu tun hatte, je als seine Angelegenheit. Folglich sprang Benji immer dann, wenn er eine läufige Hündin in der Gegend roch, auf der Suche nach Abenteuern davon und kam erst Stunden später müde, aber glücklich wieder nach Hause.
Benjis kleine Ausflüge zum Besuch seiner Freundinnen entsprechen vielleicht am ehesten dem, was ein Biologe als intelligentes Verhalten bezeichnen würde. Für einen Biologen ist der Drang, sich fortzupflanzen, der grundlegendste Trieb im Leben, und jeder Trick, den ein Individuum sich ausdenkt, um ihm bei diesen Bemühungen zu helfen, zählt. Aber der Wunsch nach Fortpflanzung ist sicher nicht das, woran die meisten Laien denken, wenn sie das Wort „intelligent“ hören.
Tiere im Allgemeinen und Hunde im Besonderen besitzen offensichtlich viele andere schlaue Züge, die näher an der Duden-Standarddefinition von „Intelligenz“ liegen als der primitive Drang, da draußen nach einem Paarungspartner zu suchen. Zu meinen persönlichen Favoriten zählen die Spürhunde, deren Fähigkeit zum Entdecken von Dingen, die wir Menschen einfach nicht wahrnehmen können, beinahe magisch erscheinen kann. Ich habe absolute Ehrfurcht vor Hunden, die beispielsweise Krebs oder selbstgebaute Sprengstoffe wahrnehmen können, indem sie einfach nur die Luft schnuppern. Wenn ich den Spürhunden nicht meine persönliche Bestnote für die intelligentesten Hunde vergebe, dann nur deshalb, weil der größte Teil dessen, was mich an ihnen beeindruckt, in Wirklichkeit ihren Leistungen in der Sinneswahrnehmung zuzuschreiben ist – also ihrer Fähigkeit, Dinge zu riechen, die wir nicht riechen können – anstatt eigentlichen Lernleistungen oder Intelligenz.
Der schlaueste Hund, den ich je getroffen habe und der mit der bemerkenswertesten Fähigkeit zum Verstehen menschlicher Absichten muss unbedingt Chaser sein. Und das ist nicht nur mein persönliches Urteil. Diese klassisch schwarz-weiße Border Collie Hündin, von der BBC als „der schlaueste Hund der Welt“ betitelt, kennt die Namen von über eintausendzweihundert Spielzeugen. Chaser stammt aus einer echten Border Collie – Arbeitslinie: Ein Hund, der unbedingt eine Beschäftigung braucht, wenn er nicht mit dem Zerlegen der Möbel loslegen soll. Ihr Besitzer John Pilley war ein ehemaliger Psychologieprofessor, der nach seiner Pensionierung nach einem neuen Hobby gesucht hatte. Er hatte Wissenschaftsartikel aus Deutschland über einen Border Collie gelesen, der die Namen von über dreihundert verschiedenen Gegenständen kannte, und so hatte er, nachdem er Chaser bekommen hatte – die natürlich so hieß, weil sie gern Dingen nachjagte – beschlossen, selbst die Grenzen hündischen Verständnisses für die menschliche Sprache zu testen.
Als ich John und Chaser 2009 in ihrem Zuhause im schönen Norden von South Carolina besuchte, arbeiteten die beiden schon seit über drei Jahren zusammen. John bewahrte einen riesigen Vorrat an Spielsachen in großen Plastikboxen auf, die er auf der hinteren Veranda seines Hauses lagerte. Er bat mich, hinauszugehen und zehn zufällige Spielsachen auszusuchen. Es waren Dinge, wie man sie gerne Hunden und kleinen Kindern gibt, und auf jedes von ihnen hatte John mit Permanentstift einen Namen geschrieben. Er bat mich, die Namen auf einen Notizblock zu schreiben, die Spielsachen ins Haus zu bringen und sie in die Lücke zwischen Couch und Wohnzimmerwand auf den Fußboden zu legen. Während ich all das tat, warteten John und Chaser draußen auf der vorderen Veranda, sodass sie nicht sehen konnten, welche Spielsachen ich ausgesucht hatte.
Als ich fertig war, rief ich die beiden herein. John saß auf dem Sofa, das mit dem Rücken zu der Stelle stand, wo ich die Spielzeuge hingelegt hatte. Er stellte eine große, leere Plastikbox vor sich hin und wies Chaser an, sich daneben zu setzen. Als alles fertig war, las John den ersten Gegenstand von der Liste vor: „OK Chaser, geh und hol Goldfisch.“ Chaser schaute sich um, weil sie nicht wusste, wo ich die Spielsachen hingelegt hatte. „Goldfisch. Komm los, Chaser. Hol Goldfisch.“
Derart angestachelt, begann Chaser in Kreisen umherzulaufen und nach den Spielsachen zu suchen. Schnell fand sie den Haufen Sachen hinter dem Sofa und suchte darin, Nase auf dem Boden, nach Goldfisch. Abgesehen davon, dass sie etwas kurzsichtig zu sein schien – sie ging mit dem Gesicht sehr nah an jeden Gegenstand heran, bevor sie entschied, ob es sich dabei um Goldfisch handelte oder nicht – schien sie das zu tun, was auch jeder Mensch in dieser Situation tun würde. Schnell hob sie eins der Spielzeuge mit ihren Zähnen auf und lief damit zu John zurück.
„Leg ihn in die Kiste,“ instruierte John und zeigte auf den Plastikbehälter vor ihm. Dies schien der schwierigere Teil zu sein. Chaser zögerte und schien ihr Fundstück nur ungern loslassen zu wollen. „Leg ihn in die Kiste.“ Endlich gab Chaser nach und ließ das Spielzeug in die Plastikbox fallen.
„OK, dann schauen wir mal“, sagte John, als er das Spielzeug herausnahm und den Namen las. Dann explodierte er förmlich vor Freude, als er ihre korrekte Wahl bestätigte: „Das ist Goldfisch! Es ist golden, es ist ein Fisch, es ist Goldfisch!“
Und mit diesen Worten warf John Goldfisch quer durchs Zimmer, woraufhin Chaser ihm begeistert nachjagte. Sie brachte ihn zurück. Er warf ihn wieder. Sie brachte ihn zurück. Er warf ihn wieder. Es war schwer zu sagen, wer mehr Spaß an der Sache hatte, John oder Chaser, aber nach ein paar Runden vor und zurück wies John sie wieder an: „Leg‘s in die Kiste“ und kraulte ihr einmal liebevoll das Nackenfell, bevor er zum nächsten Gegenstand überging.
Und so arbeiteten sich die beiden durch meine Liste. Von Goldfisch und Radar über Weise Eule, Bling, Feozie und Shirley bis hin zu Schatzkiste, Streifenhörnchen und letztendlich Mickymaus. In den meisten Fällen belohnte John Chaser mit Nachjagen hinter dem Spielzeug, das sie in die Kiste gelegt hatte, aber manchmal wechselte er auch ein bisschen ab und spielte mit ihr Ziehen mit dem Spielzeug. Jedes Mal, wenn sie den richtigen Gegenstand brachte, war er außer sich vor Freude, und jedes Mal beendete er das Spiel mit einem freundlichen Durchwuscheln ihres Kopfes oder Kraulen des Nackens. Selten empfand ich Wissenschaft als so von Zuneigung und Freude geprägt wie damals, als ich den beiden beim gemeinsamen Arbeiten und Spielen zusah.
Da Chaser und John so viel Spaß miteinander hatten, ging ich nochmals auf die Veranda und suchte zehn weitere Spielsachen heraus, und wir wiederholten die ganze Prozedur noch einmal. Chaser hatte alle richtig, und so spielten wir wieder. Und wieder. Ich habe vergessen, wie oft wir das Namensspiel insgesamt wiederholt haben, aber ich bin sicher, dass ich Chaser mindestens einhundert Gegenstände allein nach ihrem Namen bringen gesehen habe. Nur einmal machte sie einen Fehler – oder jedenfalls sah es so aus. Bei näherem Hinsehen stellte sich dann heraus, dass John meine krakelige Handschrift falsch gelesen hatte und Chaser, die nicht finden konnte, was er wollte, ihn aber nicht enttäuschen wollte, ein anderes Spielzeug gebracht hatte.
John hörte damit auf, Chaser die Namen für neue Gegenstände beizubringen, als er bei rund eintausendzweihundert Spielzeugen angekommen war – einfach deshalb, weil er sich nicht mehr merken konnte, welche er schon gekauft hatte und deshalb begann, versehentlich doppelte mit nach Hause zu bringen. Er dachte sich dann ahnungslos neue Namen für diese überzähligen Spielsachen aus, brachte diese Chaser bei (sie wurde so gut darin, dass sie einen neuen Namen im ersten Anlauf lernen konnte) und stellte dann später nur durch Zufall fest, dass er nun zwei identische Spielzeuge mit unterschiedlichen Namen hatte. Bis zum eintausendzweihundertsten Spielzeug wurde Chaser beim Lernen neuer Namen niemals langsamer.
Ich brachte John dazu, seine Entdeckungen in einer Wissenschaftszeitschrift zu veröffentlichen, deren Herausgeber ich damals war und sein Bericht wurde zu einem der meistgelesenen Beiträge, die Behavioural Processes je publiziert hatte. John schrieb schließlich noch einen Bestseller, der seinen wunderbaren Hund unsterblich machte und die beiden traten sogar gemeinsam im landesweiten Fernsehen auf, bevor John kurz vor seinem neunzigsten Geburtstag im Juni 2018 an Leukämie verstarb.
Natürlich ist Chasers Geschichte nur ein einzelner Datenpunkt, aber ihr erstaunlicher Erfolg im Lernen so vieler Begriffe und die Tatsache, dass sie der einzige Hund ist, mit dem John dies versucht hatte, legt nahe, dass die Fähigkeit zum Verstehen menschlicher Sprache latent in jedem Border Collie vorhanden ist. Dies wird durch die Tatsache gestützt, dass die Hunde in Deutschland, die ein Vokabular von Dutzenden oder sogar mehreren Hundert Gegenständen haben (darunter auch der Hund, der John ursprünglich zu seinem eigenen Langzeit-Versuch mit Chaser inspiriert hatte) ebenfalls alle Border Collies gewesen waren.
Oberflächlich betrachtet sieht dies sicherlich wie ein Beweis dafür aus, dass Chasers Rasse mit einer außergewöhnlichen, angeborenen Intelligenz gesegnet ist. Aber Border Collies sind auch wegen einer anderen Eigenschaft außergewöhnlich: ihrem überdurchschnittlichen Arbeitseifer. John trainierte Chaser drei Jahre lang etwa drei Stunden pro Tag, bis sie an den Punkt kam, an dem sie die menschliche Sprache so wunderbar fließend verstand. Und zumindest ein Teil von Chasers Erfolg liegt in der Tatsache begründet, dass sie die Möglichkeit, Dingen nachzujagen, als enorm belohnend empfand: sie war zum Sprachelernen mit John deshalb hoch motiviert, weil der Vorgang des Findens jedes Spielzeugs an sich belohnend für sie war. Die meisten Hunde lassen sich gut mit Futter belohnen, aber es gibt eine Grenze dafür, wie viele Leckerchen man gescheiterweise in einen Hund stecken sollte. Futterbelohnte Hunde können nicht kontinuierlich mehrere Stunden lang pro Tag trainiert werden – sie würden nicht nur satt, sondern auch übergewichtig werden. Ein Hund wie Chaser dagegen, für den das Nachjagen hinter einem bewegten Gegenstand allein Motivation genug zum Arbeiten ist, kann jeden Tag viel länger trainiert werden. Jeder, der mit Border Collies arbeitet, weiß, was das bedeutet: man muss besonders gut auf ihr Wohlbefinden achten, denn sie werden buchstäblich bis zum Umfallen arbeiten, wenn man nicht aufpasst, selbst dann noch, wenn sie verletzt sind. Es ist diese grenzenlose Energie, dieser Fanatismus, der Border Collies zu idealen Kandidaten für diese Art von Projekten macht. Nur wenige andere Hunderassen haben so viel Begeisterung für die Arbeit.
Dazu kommt noch: Chasers Fähigkeiten waren, obwohl natürlich beeindruckend, eher simpel, und eher John Pilleys meisterhaftem Training zu verdanken als dem hündischen Intellekt an sich. Mit der Zeit wurde Johns Training von Chaser so leicht und einfach, dass es so aussehen konnte, als ob er ihr einfach nur den Namen eines neuen Gegenstands erklären würde, genau wie Eltern ihrem Kind den Namen von etwas Unbekanntem sagen. Aber das Prinzip, das hier im Spiel war, unterschied sich in einer wichtigen Hinsicht.
Hier das Szenario: John hat einen neuen Gegenstand. John kann diesen Gegenstand für Chaser enorm interessant machen, indem er ihn entweder wirft (sodass sie die Möglichkeit hat, hinterherzurennen und ihn zurückzubringen) oder indem er damit Zerren mit ihr spielt. Das Zerrspiel liebt sie fast genauso sehr wie das Nachjagen. John sagt etwas wie „Hey Chaser, lauf und hol das Zauberding“ – Zauberding ist der Name, den er ihr für den neuen Gegenstand beibringen möchte – und wirft mit diesen Worten Zauberding so weit, wie er nur kann. Voller Aufregung über diese tolle Möglichkeit, hinter etwas herrennen und es ihrem Herrchen zurückbringen zu können, flitzt Chaser los, um Zauberding zu holen und John zu bringen. Dann sagt John „Gib das Zauberding Pop-Pop“ (so nennt er sich selbst, wenn er ihr gegenüber von sich spricht). Chaser gerät in diesen köstlichen Zustand inneren Zwiespalts, den Hunde, die gern Sachen nachjagen, oft zeigen, wenn sie ihre zuvor ergatterte Beute abgeben sollen. Soll Chaser das Spielzeug abgeben und dafür die magische Belohnung eines weiteren Nachjagens bekommen, oder soll sie es lieber festhalten, weil es doch ihr Preis ist und sie es haben möchte? (Die erste Möglichkeit birgt ein gewisses Risiko, wie Chaser aus Erfahrung weiß: Pop-Pop könnte das Spielzeug weglegen und das Nachlauf-Spiel wäre für eine Weile vorbei.) Also beschwatzt John Chaser immer wieder „Gib Zauberding dem Pop- Pop“, bis sie es endlich abgibt. Und dann wirft er ihn wieder. „Los, Chaser, hol das Zauberding.“ Und das Ganze geht wieder von vorne los.
In einer Situation wie dieser, in der nur ein Gegenstand im Spiel ist, würden die meisten Hunde der Wortbezeichnung, die der Mensch dafür benutzt, nicht viel Aufmerksamkeit schenken. Aber zu der Zeit, als ich die beiden traf, hatte Chaser über drei Jahre Erfahrung in diesem Spiel mit John, der es wesentlich komplexer gemacht hatte, indem er ihr unterschiedlich benannte Gegenstände zum Apportieren anbot. Er belohnte sie nur dann mit dem Apportierspiel, wenn sie den richtigen Gegenstand brachte – den, den er genannt hatte. Über die sicherlich eine Million Male, die Chaser mit John Apportieren spielte, war die entscheidende Eigenschaft “neues Wort“ als Schlüssel zur sehr begehrten Nachjag-Gelegenheit fest in diesem sehr aufmerksamen Hund verankert worden.
Jeder Leser mit einem Nachjag-begeisterten Hund und viel Zeit kann dieses Trainingsmuster nachahmen und schauen, wie weit er den Wortschatz seines Hundes ausbauen kann. Leider hat meine eigene Hündin, Xephos, so lange kein Interesse am Apportieren von Dingen, wie ihr niemand nachläuft, um sie ihr abzunehmen – und ich bin nicht ausreichend fitnessfanatisch, um einem Hund einen vorzeigbaren Wortschatz dadurch beizubringen, dass ich ihm drei Stunden pro Tag durch den Garten nachlaufe.
Was also zeigt uns Chasers Training wirklich? Es zeigt, dass sie einen Laut wie „Zauberding“ mit einem Gegenstand verknüpfen kann und sie weiß, dass sie für das Zurückbringen dieses Gegenstands zu John belohnt werden wird. Diese Form des Verknüpfens von Dingen hält man für einen der grundlegendsten Bausteine intelligenten Verhaltens und sie lässt sich bei allen Tierarten beobachten, die man je daraufhin untersucht hat. Es handelt sich in der Tat um die Pavlov’sche Konditionierung, die der großartige russische Wissenschaftler Ivan Petrovich Pavlov vor über hundertzwanzig Jahren entdeckte und dabei Hunde als Forschungssubjekte benutzte.
Was Chaser außergewöhnlich macht, ist die schiere Menge unterschiedlicher Lautkombinationen, die sie mit bestimmten Gegenständen verknüpfen kann. Das Hinzufügen von mehr Gegenständen zeigt die Leistungsfähigkeit ihres Langzeitgedächtnisses, fügt aber keine tatsächliche intellektuelle Komplexität zu dem hinzu, was sie tut. Ihr immenser Wortschatz ist ganz und gar ein Zeugnis für Johns Geduld in ihrem Training und für ihre Bereitschaft, Stunde um Stunde, Tag um Tag und Jahr um Jahr weiterzuarbeiten.
Es geht hier keineswegs darum, Chasers Leistung herunterzuspielen, sondern nur darum, sie in den richtigen Kontext zu setzen. Eine große Bandbreite an Tierarten kann nachweislich Verknüpfungen bilden, und manche, so fand man heraus, zeigen kognitive Leistungen, die wesentlich bemerkenswerter sind als nur die Verknüpfung bestimmter Laute mit bestimmten Gegenständen (geschweige denn das Verknüpfen einer Zeigegeste mit einem Stück Futter). Tauben können identifizieren, ob ein Bild einen Stuhl, eine Blume, ein Auto oder eine Person darstellt; Delfine haben bewiesen, dass sie Grammatik verstehen; Honigbienen teilen ihren Schwarmgenossen spontan Entfernung, Richtung und Art der Futterquelle mit, die sie auf ihren Erkundungsflügen gefunden haben. Meines Wissens nach haben Hunde keins dieser Dinge erreicht.
Hinzu kommt, dass auch viele andere Tiere dazu trainiert werden können, Verknüpfungen zwischen menschlichen Aktionen und Ergebnissen zu bilden, sodass sie scheinbar in der Lage sind, die Absichten hinter dem menschlichen Verhalten zu „lesen“. Das vielleicht erstaunlichste Beispiel dafür – und auf jeden Fall mein persönlicher Favorit – stammt von Fledermäusen. Mein Student Nathan Hall (heute Professor an der Texas Tech University) führte eine Studie durch, welche die von Monique Udell und mir geleistete Arbeit an Hunden, die menschlichen Zeigegesten folgten, replizierte, aber er arbeitete dabei mit Fledermäusen aus einer Auffangstation in Florida. Der Versuchsaufbau war im Grunde der gleiche, wie wir ihn für Hunde und Wölfe benutzt hatten, aber der Hauptunterschied war, dass die Fledermäuse nicht auf dem Boden liefen, sondern sich an dem Kaninchendraht entlang hangelten, der die Decke ihres Geheges bildete. Folglich zeigte Nathan nicht auf am Boden stehende Behälter, sondern auf solche, die oben am Maschendraht aufgehängt waren.
Dieser Versuch war besonders nützlich dafür, zu verstehen, ob es Erblichkeit (Phylogenese) oder Lebenserfahrung (Ontogenese) war, die einem Tier das Verfolgen von menschlichen Zeigegesten ermöglichte, denn die Hälfte der untersuchten Fledermäuse war in der Station geboren und von Fledermausmüttern aufgezogen worden, während die anderen dort von Menschen abgegeben worden waren, die sie in der Hoffnung, ein unkonventionelles Haustier zu bekommen, selbst aufgezogen hatten. (Wie die meisten nicht domestizierten Arten geben Fledermäuse lausige Haustiere ab, sodass ihre Besitzer früher oder später genug davon hatten, Fledermauskot aufzuputzen und sie loswerden wollten.) Was Nathan herausfand, unterstützte stark die von Monique und mir entwickelte Theorie: Die von ihren eigenen Müttern aufgezogenen Fledermäuse folgten menschlichen Zeigegesten nicht, aber diejenigen, die von Menschenhand aufgezogen worden waren und deshalb erkannt hatten, dass die Bewegungen menschlicher Arme für sie eine wichtige Bedeutung hatten, taten es.
Im Zuge unserer Analyse der von Wissenschaftlern wie Nathan und John durchgeführten Versuche und unserer weiteren eigenen Experimente kamen meine Mitarbeiter und ich langsam zu der Erkenntnis, dass das, was Hare als den „Genius der Hunde“ bezeichnete, bei jedem Tier vorhanden ist, das von frühem Lebensalter an mit Menschen aufgewachsen ist. Die Fähigkeit, menschlichen Absichten zu folgen, kann deshalb nicht in genetischen Veränderungen begründet liegen, die während des Domestikationsprozesses stattgefunden haben: wir haben sie bei Wölfen und vielen anderen nicht domestizierten Tierarten beobachtet. Vielmehr sind wir heute überzeugt, dass diese Fähigkeit sich bei jedem Tier herausbilden kann, das mit Menschen großgezogen wird und von ihnen zur Erfüllung seiner täglichen Bedürfnisse abhängig ist.
Der Fairness halber muss man sagen, dass die Fähigkeit von Hunden, unsere Handlung und für sie bedeutsame Folgen miteinander in Verbindung zu bringen, oft so subtil ist, dass es so aussehen kann, als ob sie unsere Gedanken lesen könnten. Einmal kam nach einem Vortrag ein älterer Herr auf mich zu und sagte: „Ich dachte, es könnte Sie interessieren, dass mein Hund übernatürliche Fähigkeiten hat.“ Klar war ich neugierig, aber auch ein wenig misstrauisch. Wie sich herausstellte, war der Grund dafür, warum der Mann das Verhalten seines Hundes für übernatürlich hielt, der folgende: Der kleine Westie wusste immer genau, ob sein Herrchen dann, wenn er vom Sessel aufstand, zu einem Spaziergang mit ihm aufbrechen würde oder nicht, und zwar noch bevor er seine Schuhe anzog oder nach der Leine griff. Nun hatte ich zwar nie die Gelegenheit, diesen Hund zu testen, sodass eine geringe Wahrscheinlichkeit dafür bleibt, dass er wirklich übernatürliche Fähigkeiten besaß, aber meiner Meinung nach ist es viel wahrscheinlicher, dass dieser Hund – genau wie meine Xephos – gelernt hatte, die Unterschiede in der Körperbewegung wahrzunehmen, wenn der Mann aus dem Sessel aufstand, je nachdem, was zu tun er vorhatte. Wenn ich zuhause von meinem Schreibtisch aufstehe, scheint Xephos zu wissen, ob ich mir einen Kaffee machen oder mit ihr eine Runde um den Block gehen möchte. Ich bin mir zwar dessen nicht bewusst, aber ich bin mir sicher, dass die Art und Weise, wie ich mich halte und vielleicht auch, ob ich sie ansehe, ihr verrät, was ich vorhabe.
Auch Spürhunde mit ihrer fast unheimlichen Fähigkeit zum Entdecken uns verborgener Dinge – oft solche von entscheidender Bedeutung wie Bomben, Drogen, Krebs oder vermisste Menschen – erreichen ihre erstaunlichen Leistungen über den Mechanismus assoziativen Lernens. Über viele Monate kleinschrittigen und geduldigen Übens bringt der Trainer dem Hund bei, dass das Ausführen einer bestimmten Aktion (meist Sitzen oder Bellen, oder beides) immer dann, wenn er einen bestimmten Geruch wahrnimmt, mit einem Ballspiel, Zergeln oder einem Stückchen Futter belohnt wird.
Egal, ob wir einen Westie betrachten, der zu wissen scheint, was sein Herrchen als Nächstes tun wird oder Chaser, die auf Kommando jedes beliebige aus Hunderten von Spielzeugen bringen kann, oder die Tausende von Spürhunden, deren Namen wir nicht kennen und die täglich für unsere Sicherheit arbeiten – es mangelt nicht an Beispielen für Hunde, die zu den erstaunlichsten Dingen in der Lage sind. Und trotzdem glaube ich nicht, dass dies Beweise für irgendetwas Außergewöhnliches in der Intelligenz der Hunde sind. An Chaser stechen ihr Arbeitseifer und ihre starke Beziehung zu John Pilley hervor. Und ich habe keinerlei Zweifel daran, dass auch der Herr, dessen Westie anscheinend seine Gedanken lesen konnte, eine starke emotionale Bindung zu seinem Hund hatte. Was diese Bravourstücke hundlicher Intelligenz ermöglicht, sind vor allen Dingen die Beziehung zwischen Hund und Halter sowie Bereitschaft und Begeisterung des Hundes, sich von dieser Person leiten zu lassen. Das ist eigentlich keine einzigartige Form von Intelligenz. Man kann auch andere Tiere dazu trainieren, ähnliche Dinge zu tun – oder in manchen Fällen sogar noch erstaunlichere –, wenn jemand die Geduld für das Training aufbringt.
Brian Hare war sicherlich etwas auf der Spur, wenn er sagte, dass Hunde eine Form von Genius besäßen. Ein Hund, der als Haustier in einem warmen menschlichen Heim lebt, in dem er jederzeit von seinen Menschen abhängt, um Zugang zu den Dingen zu bekommen, die er braucht – Futter, Wasser, Schlafplatz oder die Möglichkeit, sich in Ruhe zu lösen – wird außergewöhnlich und angenehm sensibel für die Implikationen menschlicher Handlungen. Das steht vollkommen außer Zweifel. Viele von uns erleben das jeden Tag, wenn unser Hund unsere Gedanken zu lesen scheint und weiß, ob wir für eine Tasse Kaffee aufstehen oder für einen Spaziergang. Natürlich können Hunde das, und es ist eine Schlüsselkomponente dessen, was unser Zusammenleben mit ihnen so erfolgreich und befriedigend macht.
Die von meinen Studenten und mir durchgeführte Forschung macht aber klar, dass Hunde die Bedeutung von Dingen, die wir tun, deshalb lernen, weil sie mit uns zusammenleben – und nicht, weil sie schon als außergewöhnliche „Genies“ zum Verstehen von Menschen zur Welt kommen. Die Art, wie wir uns bewegen und wie wir handeln ermöglicht Hunden, vorherzusagen, was wir als Nächstes tun werden, und so lernen sie, in unser Verhalten Bedeutung hineinzulesen. Sie werden nicht damit geboren – Tierheimhunde zeigen es nicht verlässlich, können es aber schnell lernen, genau wie übrigens auch viele andere Tiere. Die Liste der Tierarten, die menschliche Absichten lesen können, umfasst auch andere domestizierte Arten wie Pferde oder Ziegen und sogar niemals domestizierte Tiere wie etwa den Delfin. Kürzlich unterhielt ich mich mit einigen schwedischen Wissenschaftlern, die ein paar Damhirsche von Hand aufgezogen hatten. Weil sie wussten, dass mich dieses Thema interessierte, berichteten sie mir aufgeregt, dass ihr Damwild nun ihren Zeigegesten folgen würde.
In Anbetracht all dieser Dinge ist klar, dass das, was wir bei unseren Hunden sehen, nicht außergewöhnliche Klugheit ist, sondern eher das Ergebnis einer phänomenalen Bindung zwischen Mensch und Hund. Die Intensität dieser Bindung macht es für Hunde und ihre Menschen möglich, sehr eng zusammenzuarbeiten – und, im Fall sehr geduldiger Menschen und sehr hoch motivierter Hunde – einige absolut erstaunliche Leistungen zu vollbringen.
Was aber ist wiederum die Ursache für diese phänomenale Bindung zwischen Hunden und Menschen? Nach unseren Studien in Wolf Park und im Tierheim war ich zwar nicht mehr davon überzeugt, dass Hunde eine außergewöhnliche Intelligenz besitzen, wurde aber trotzdem das Gefühl nicht los, dass an Hunden noch etwas ganz Besonderes war. Wenn es aber nicht die Intelligenz war, was war es dann?
Meine bisherige Arbeit hatte mich davon überzeugt, dass die Antwort auf diese Frage entscheidend sein würde – und zwar sowohl für die Hunde als auch für die Menschen, die sie studieren und die sich um sie kümmern.
Unsere ersten Vorstöße in die Welt der Tierheime waren nicht etwa von einer besonderen Sorge darüber angetrieben worden, wie herrenlose Hunde in unserer Gesellschaft behandelt werden. Ich gebe zu, dass ich bis zu diesem Punkt ziemlich naiv in Sachen der Frage war, wie Hunde leben, die niemandem gehören. Ich war rein aufgrund intellektueller Neugier auf das Tierheim gestoßen, weil ich verstehen wollte, wo die Ursprünge der Fähigkeit von Hunden für das Folgen menschlicher Absichten lagen. Aber nach unserer Arbeit im Tierheim war es mir nicht mehr möglich, diese teilnahmslose Haltung beizubehalten.
Ich war geschockt, wie armselig das Leben von Tierheimhunden ist. Mir war zuvor nicht klar gewesen, dass viele Millionen Hunde oft monatelang in Einrichtungen hocken, die eigentlich nur für kurze Aufenthalte gedacht sind. Sie verleben ihre Tage draußen auf Betonboden, haben täglich nur sehr kurz Kontakt zu Menschen und nur wenige kostbare Gelegenheiten, einfach nur mal einem Ball nachzujagen oder sonst irgendwie zu spielen. Manche Hunde sind vom pausenlosen Bellen ihrer Nachbarn quasi taub und leiden unter chronischem Schlafmangel wegen der unbehaglichen Umstände. Sie leiden auch noch in anderer Hinsicht. Die beiden US-Bundesstaaten, die ich am besten kenne, Florida und Arizona, haben beide höchst unangenehme Sommer: subtropische Schwüle in Florida und backofenähnliches Wüstenklima in Arizona. Die meisten Tierheimhunde in diesen Staaten erfahren keine Erleichterung von der Sommerhitze durch Klimaanlagen und genießen im Winter nur minimale Heizung.
Unsere Forschung zur Kognition der Hunde befand sich noch im Frühstadium, hatte aber bereits bedeutende Einsichten in den Verstand von Hunden ergeben – Einsichten, so war ich mir sicher, die das Potenzial besaßen, das Leben von Hunden zu verbessern oder möglicherweise sogar zu retten. So konnten wir zum Beispiel nachweisen, dass die Tierheimhunde zwar nicht spontan auf menschliche Zeigegesten reagierten, aber sehr schnell lernen konnten, dies zu tun. Falls (wie ich es Ihnen aus ganzem Herzen empfehle) Ihr nächster Hund aus dem Tierheim kommt, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, dass er Sonderunterricht braucht, um Sie verstehen zu können. Ein ganz normales Alltagsleben, in dem Menschen mit Hunden auf vielerlei und komplexe Weise interagieren, bietet einem Hund mehr als genug Erfahrungen, um die Bedeutung menschlicher Handlungen verstehen zu lernen, seien sie verbaler oder körperlicher Art. Im normalen Leben würde ein Hund wahrscheinlich nicht so schnell lernen wie die Tierheimhunde, die wir explizit trainiert hatten. Zeigegesten zu folgen ist etwas, das sie in ihrem neuen Zuhause im Verlauf der ersten Wochen lernen werden – neben einer ganzen Reihe anderer Dinge, zum Beispiel, ob es in Ordnung ist, auf das Bett oder Sofa zu springen und dass man die Katze nicht um den Esstisch jagen darf.
Unsere ersten Ausflüge ins Tierheim hatten mir einen Vorgeschmack auf das Gute gegeben, das unsere Arbeit bewirken können würde, mir aber auch die Lücke ganz im Herzen der Hunde-Kognitionsforschung bewusst gemacht und den dringenden Bedarf nach besserer Information über Hunde und darüber, wie sie ticken. Nach unserer ersten Tierheimstudie machte ich es zu meiner Mission, nicht nur verstehen zu wollen, was Hunde einzigartig macht, sondern auch herauszufinden, was diese Einzigartigkeit dafür bedeutet, wie Menschen mit Hunden umgehen sollten. Ich war es Benji, Xephos und all den anderen Hunden, die mein Leben bereichert hatten, schuldig, herauszufinden, was sie so besonders machte und dann diese Information dazu zu verwenden, ihre Leben besser zu machen.
....................................
* Sie können dies einfach selbst mit Ihrem eigenen Hund ausprobieren. Am besten wird es vermutlich funktionieren, wenn Sie einen Freund bitten können, Ihren Hund eine Weile zu beschäftigen, während Sie die Behälter vorbereiten. Manche Hunde scheuen sich möglicherweise etwas davor, umgestülpte Plastikbecher umzuwerfen, um nachzuschauen, was darunter ist, aber der Versuch funktioniert auch genauso gut, wenn Sie gar kein Futter unter irgendetwas verstecken. Legen Sie einfach ein Stück Futter oben auf den Behälter, auf den Sie gezeigt haben, nachdem der Hund seine Entscheidung getroffen hat. Höchstwahrscheinlich werden Sie feststellen, dass Ihr Hund in den meisten Fällen dahin geht, wohin Sie zeigen.