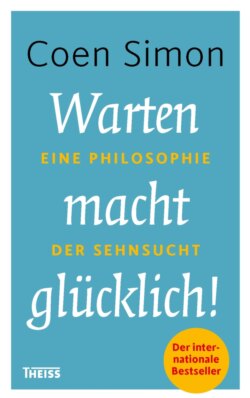Читать книгу Warten macht glücklich! - Coen Simon - Страница 8
Оглавление| 2 | LANDEVERSUCH AUF VERLORENEM GRUNDDie Sehnsucht nach dem Zuhause |
MEINE ÄLTERE SCHWESTER wohnt in Oxford, eine zweite in Florida, mein Bruder hat gerade per Anhalter die Grenze von Kirgisien nach China überquert, meine Eltern befinden sich in ihrem Haus in den Cevennen, und ich sitze, während ich diesen Satz schreibe, zu Hause in Nord-Groningen. Ich verreise nicht gern. Um ehrlich zu sein, bereitet mir schon ein verlängertes Wochenende auf der niederländischen Insel Schiermonnikoog größtes Unbehagen. Kofferpacken macht mich nervös, trotzdem beneide ich meine Familie um ihre Reiselust. Auch meine Mutter verreist nur mit größtem Widerwillen, meine Heimatverbundenheit habe ich also von ihr geerbt. Und ich vermute, dass sie sie wiederum von ihrem Vater hat, obwohl dessen Lebenslauf diesen Schluss kaum zulässt, denn er hat einen großen Teil seines Lebens weit weg von zu Hause verbracht. Als meine Großmutter ihn kennenlernte, war er Offizier des Ingenieurkorps bei der Königlich-Niederländisch-Indischen-Armee. Immer wieder wunderte ich mich, wie er mit dem Heimweh, das ich ihm nachsage, die vielen Jahre im japanischen Kriegsgefangenenlager aushalten konnte. Ich habe ihn nie danach gefragt. Nicht weil ich erst jetzt drüber nachdenke, sondern weil man Großvater solche Fragen nicht stellte. Niemand tat das. Und damit hatte er wie viele traumatisierte Menschen noch ein weiteres Schicksal zu erleiden: Opfer ständiger Mutmaßungen zu sein. Traumaopfer bilden die schweigende Projektionsleinwand für die ungeduldigen Vermutungen ihrer Zeitgenossen. Als Außenstehende glauben wir, das Opfer könne einfach nicht über sein Schicksal sprechen. Selten kommen wir über diese Feststellung hinaus, und den Rest ersetzen wir durch Allgemeinheiten über das Unglück des Opfers.
Es liegt mir fern zu behaupten, dass es in einem japanischen Kriegsgefangenenlager nicht so schlimm gewesen sei, wie behauptet wird, doch ich bin der Meinung, man sollte die Dinge wieder etwas banalisieren, um das Persönliche jedes einzelnen Schicksals stärker hervorzuheben. Je alltäglicher ein Leiden dargestellt wird, desto eher kann es nachvollzogen werden. Nun muss ich zugeben, dass das Leiden meines Großvaters als Zwangsarbeiter an der Birmaeisenbahn wenig alltäglich gewesen war: Es ist und bleibt eine nackte Tatsache.
Nicht mal The Bridge on the River Kwai, der berühmte Hollywoodfilm über die Eisenbahnlinie, den ich sicher fünf Mal gesehen habe, konnte daran etwas ändern. Er hatte sogar den gegenteiligen Effekt, denn jedes Mal, wenn ich mir Großvaters Kriegsgefangenschaft vorstellen wollte, geschah dies in Technicolor. Nach seinem Tod fand ich heraus, dass nicht nur mein Vorstellungsvermögen fehlerhaft war, sondern auch die oben erwähnte nackte Tatsache eine vollkommen falsche. Großvater hatte nämlich an der Pakanbaru-Eisenbahnlinie gearbeitet, an der sogenannten „Toteneisenbahnlinie“, und diese lag in Sumatra, nicht in Birma. Über diese Eisenbahnlinie aber hat Amerika keinen Film gedreht.
Seit ich die Vermutung hege, dass mein Großvater dieselbe Veranlagung für Heimweh besaß wie ich, kommt es mir zum ersten Mal so vor, als könnte ich mir eine authentischere Vorstellung von seinen widrigen Erfahrungen machen. Der alltägliche Charakter des Heimwehs führt zur Erkenntnis, dass die wenigen, uns zur Verfügung stehenden Gefühle genügen, um sich sogar die schwersten Schicksalsschläge eines Menschen vorstellen zu können.
Wir sind es gewöhnt, über großes Leid zu sagen, dass es unvorstellbar sei, weil Wörter es nicht hinreichend darstellen können. Aber auch kleines Leid und kleines Glück lässt sich nicht in Worte fassen, ohne dessen persönliche Bedeutung zu deformieren. Trotzdem können wir uns durchaus ein Bild davon machen. Fragte mich früher mein Vater, wo es mir wehtat, wenn ich mit einem geschwollenen Knöchel oder einer Schürfwunde aus der Schule nach Hause kam, dann konnte ich den Schmerz entweder als „pochend“, „stechend“, „heftig“ oder „dumpf“ beschreiben, und vielleicht vergesse ich sogar noch ein paar Möglichkeiten, doch niemals hatte ich dabei das Gefühl, mit meinen Worten die wahre Beschaffenheit des Schmerzes getroffen zu haben. Mein Vater aber wusste immer genau, was ich meinte, und damit auch, was zu tun war.
Dass ich mir meinen Großvater als einen Mann mit einer Veranlagung zu Heimweh vorstelle, geht auf eine Familienanekdote zurück. Sie ist auch für die immergleichen Bilder verantwortlich, die ich vor mir sehe, wenn ich an ihn denke: einen Drink in der Hand und laut lachend, oder aber still vor sich hin ins Leere starrend. In der Familie wurde immer wieder erzählt, dass sich Großvater jeden Nachmittag, wenn er von der Arbeit nach Hause kam, einen Drink einschenkte, mit dem Ehering an die Heizungsrohre klopfte und darauf wartete, dass meine Mutter und ihre Schwestern alles stehen und liegen ließen und zu ihm ins Wohnzimmer kamen. Ich vermute, dass meinem Großvater dieses Ticken gegen die Heizungsrohre, dieser wortlose Kontakt über das Rohrsystem des Hauses wichtiger war als der tägliche, gemeinsam eingenommene Drink.
Das Heimweh ist überall. Und wer eine untergründige Veranlagung zu Heimweh hat, braucht nicht mal das Haus zu verlassen, um davon ergriffen zu werden. Der Trugschluss, Heimweh habe nur der, der von zu Hause weg ist, ist weit verbreitet. Umgekehrt habe ich mich jedoch nie stärker zu Hause gefühlt als auf einer gewissen Waldlichtung. Es war an einem Mittwochnachmittag, ich war ungefähr sieben Jahre alt. Vermutlich war ein Geburtstagsfest der Anlass, der uns in dieses Wäldchen führte. Ich erinnere ich mich noch gut daran, wie empört ich war, als meine rücksichtslosen Freunde die Lichtung sofort mit Hilfe von Jacken als Andeutung von Torpfosten zu einem Fußballfeld umfunktionierten. Sie sahen nicht, dass die Buchen, Birken und Eichen in aller Eintracht einen vollkommenen Kreis bildeten. Obwohl auch ich Fußball liebte, setzte ich mich zuerst vor einer jungen Buche ins Moos und ergötzte mich an der Betrachtung dieses Heiligtums der Natur. Ansonsten blieb mir von diesem Nachmittag nicht viel in Erinnerung, ich werde den Rest davon wohl auch mit Fußballspielen verbracht haben.
Die Lichtung hinterließ einen so bleibenden Eindruck bei mir, dass ich danach meine Umgebung mit anderen Augen sah. Es war, als drehte sich von nun an alles um diesen einen Ort, als hätte ich mit ihm das Zentrum der Welt erblickt. Jede Brache, jeden trostlosen Ort verglich ich von nun an mit dieser heiligen Stätte. Darin liegt die angenehme Seite des Heimwehs: Die introvertierte Angst vor dem Fremden vermag es, das Fremde so in sich zu konzentrieren, dass man sich trotz aller Unterschiede zu dieser Welt mit ihr eins fühlt.
„Dieses Stück Landschaft finde ich am allerschönsten.“ Jedes Mal, wenn wir auf Schiermonnikoog mit dem Fahrrad unterwegs waren, hielt meine Frau irgendwann an, zeigte auf die aus Tannen, Dünen und Laubwald bestehende Landschaft und erklärte, dass sie das alles an die Veluwe erinnere, wo sie als Kind die Sommerferien bei der Großmutter verbracht habe. Es dauerte einige Schiermonnikoog-Aufenthalte, bis wir herausfanden, dass meine Frau immer an derselben Stelle stehenblieb. Mir schwante, dass ihr Lob damit gar nicht diesem bestimmten Stück Landschaft galt. Wie aber war es möglich, dass man einen einzigartigen Ort zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt als etwas Anderes, etwas Allgemeineres, erfahren konnte? Und wie war es möglich, dass man sich angesichts eines Ortes in der Gegenwart an einen Ort aus der Vergangenheit erinnerte? Da fiel mir ein, was ich früher beim Spielen im Wald immer tat: Ich projizierte meine Zukunft in die Landschaft.
Wenn wir uns nach einer bestimmten Landschaft zurücksehnen, so wollen wir im Grunde nicht die Landschaft wiedersehen, sondern das Glück nochmals empfinden, das wir bei ihrem ersten Anblick empfanden. Wir sind fest davon überzeugt, in dieser bestimmten Landschaft glücklich gewesen zu sein, doch dieses Glück bestand vor allem aus der Vorstellung eines in der Zukunft liegenden, wiederholbaren Glücks. Wenn wir zu einem anderen Zeitpunkt erneut in die Zukunft blicken – was wir mit Vorliebe während der Ferien tun –, bringt das Gedächtnis alte und neue Sehnsüchte durcheinander, und wir halten die schweigenden Landschaften, die Leinwände unserer Projektionen, zu Unrecht für die stillen Zeugen unserer Glücksgefühle.
Weil ich aus purem Zufall an jenem Mittwochnachmittag auf dieser Waldlichtung gelandet war, glaubte ich lange, ich müsste irgendwann zum Wäldchen zurückkehren. Aber dazu kam es nie. Ich wusste ja nicht einmal, wo es sich befand, nur dass es auf der anderen Seite einer vielbefahrenen Strasse liegen musste, die ich nicht mal allein überqueren durfte. Es wurde auch niemals mehr ein Geburtstag dort gefeiert.
So wurde die Waldlichtung zu meinem unsichtbaren Maßstab. Das Loch in der Nabe, um die das Rad sich dreht. Dummerweise hatte ich zwar die Tatsache der Existenz der Lichtung in meinem Gedächtnis bewahrt, es jedoch versäumt, mir zu merken, wie sie aussah. Ein Junge, mit dem ich mich am Ende meiner Gymnasiumszeit anfreundete und der die Land- und Forstwirtschaftschule besuchte, erzählte mir vom Leusveld, wo er nachts manchmal den Eulen zuhörte und Hirsche und Wildschweine beobachtete. Als er mir den Ort auf der Karte zeigte, war ich mir sicher, dass sich dort meine Lichtung befinden musste.
Jetzt, da ich die geografischen Koordinaten des Ortes besaß, der in meiner kindlichen Erlebniswelt das Zentrum der Welt gewesen war, bemerkte ich, dass mein Bild davon sehr vage war. Ich zweifelte allmählich daran, ob ich überhaupt gesehen hatte, was ich glaubte, gesehen zu haben. Wir vereinbarten, dass ich ihn einmal auf einer seinen nächtlichen Exkursionen begleiten sollte, doch auch dazu kam es nie.
Vielleicht gehört es zu den unvorstellbaren Dingen eines Menschenlebens, dass jede einzelne unserer Erfahrungen einzigartig zu sein scheint, obwohl wir lediglich über ein beschränktes Arsenal an Gefühlen verfügen. Diese Einzigartigkeit verdanken wir den zwei banalsten und gleichzeitig merkwürdigsten Eigenschaften, in denen sich unsere Wahrnehmung manifestiert: Raum und Zeit. Ludwig Wittgenstein schreibt im Tractatus logico-philosophicus (1921), dass zwei Gegenstände mit derselben logischen Form sich nur darin unterscheiden, dass sie verschieden sind. Merkwürdig, dass diese Tautologie überhaupt Aussagekraft besitzt, aber sie enthüllt eines der größten Geheimnisse unserer persönlichen Erfahrung. Obwohl wir mit unserer geringen Bandbreite an Gefühlen scheinbar stets dasselbe erleben, können wir diese Erfahrungen voneinander unterscheiden, weil sie an einer anderen Stelle im Raum, gewiss aber zu einem anderen Moment in der Zeit geschehen. Die Enthüllung dieses einen Geheimnisses beschwört ein anderes herauf, das sich in der Frage ausdrückt: Wo und wann sind wir, wenn wir erfahren? Der Mensch befindet sich stets in Raum und Zeit, doch vom Sein selber fehlen uns die räumlichen und zeitlichen Koordinaten.
Jede Wahrnehmung stützt sich auf zwei Grundpfeiler, einem psychologischen und einem existentiellen. Mit Letzterem ist die Beschaffenheit unserer Wirklichkeit gemeint. Die Veranlagung für Heimweh liegt also nicht nur in einem nostalgischen Gemüt, sondern entspringt auch diesem existentiellen Grund: dem entschiedenen Mangel einer Antwort auf die Frage, wo sich denn in Gottesnamen das Sein befindet. In Ermangelung dieser ersten Grundlage ist alles, was sich davon ableitet, zur Grundlosigkeit verurteilt, weshalb jeder Mensch mehr oder weniger die Veranlagung zum Heimweh in sich trägt. Man kann sich noch so sehr zu Hause fühlen, eines fehlt einem immer: die Gewissheit, wo die während eines ganzen Lebens liebgewonnenen Zeiten und Orte ihre Grundursache haben.
Ungeachtet der Tatsache, dass das Heimweh in unserem Alltag vor allem auf etwas Fehlendes ausgerichtet ist, offenbart die Sehnsucht nach dem Zuhause eine unfehlbare Ahndung für das Wesen unseres Seins. Diese Ahndung ist vermutlich sogar die Bedingung dafür, dass der Mensch sich in einem Sein verwurzelt fühlt, das sich der eindeutigen Identifikation fortwährend entzieht – wir werden es niemals ergründen können.
In jedem Leben müssen wir die persönlichen Koordinaten von Raum und Zeit miteinander verbinden, damit ein Netzwerk entstehen kann, das die ihm zugrunde liegende Willkür vergessen lässt. Für meine Mutter und ihre um eine Viertelstunde jüngere Zwillingsschwester liegt eine dieser vom Zufall bestimmten Lebenskoordinaten irgendwo bei Semarang in Mittel-Java. Bis zum Alter von vier Jahren lebten die beiden Mädchen mit ihrer Mutter in einem japanischen Kriegsgefangenenlager in Indonesien. Nachdem Japan kapituliert hatte, machten sich tausende bis dahin inhaftierte niederländische Männer und Jungen auf die Suche nach ihren Familien. Das wurde dadurch erschwert, dass die Lagerinsassen zu ihrer eigenen Sicherheit öfter in langen Militärkonvois von einem Lager ins andere verlegt wurden. Auch meine Mutter und meine Tante wurden so zu einem unbekannten Ort gebracht. Sicherheit und Glück folgten einander auf dem Fuß, denn die Verlegung der Frauen und der Kinder zog eine ungeheure Wanderung von Vätern und Söhnen nach sich, die auf der Suche nach ihren Familien von einem verlassenen Lager zum anderen zogen.
Die Schwestern saßen kurz vor einer neuerlichen Verlegung wartend auf dem Gepäck. Meine Großmutter stand neben ihnen. Hinter den dreien fand sich gerade eine Familie glücklich wieder, was die Aufmerksamkeit meiner Großmutter und meiner Mutter erregte. Meine Tante starrte währenddessen auf das Passbild meines Großvaters, das sie auf den Knien liegen hatte, und verglich es mit jedem Mann, der vorüberkam. Die Kinder konnten sich nicht mehr an das Gesicht ihres Vaters erinnern, außerdem dürfte das abgehärmte Gesicht so kurz nach der Entlassung aus der Lagerhaft wohl wenig mit dem Gesicht auf dem Foto gemein gehabt haben. Noch während meine Mutter gebannt das Schauspiel hinter sich beobachtete, ertönte plötzlich ganz ruhig die Stimme ihrer Schwester: „Da ist Papa.“
Ich hatte schon seit geraumer Zeit mein Elternhaus verlassen, als meine Eltern ein Dorf weiter zogen. Es lag nicht weit von Leusveld. Und so kam es, dass ich an einem Sonntagnachmittag fast dreißig Jahre nach meiner kindlichen Urerfahrung des Zuhauseseins mit dem Auto meiner Mutter zum Wäldchen fuhr. Ich suchte drei Stunden lang, aber eine Lichtung fand ich nicht.