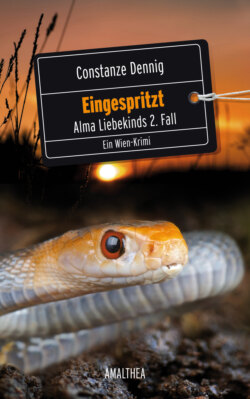Читать книгу Eingespritzt - Constanze Dennig - Страница 6
2. Kapitel
ОглавлениеWas es heißt, einen Tisch im Gastgarten eines beliebten Wiener Innenstadtkaffeehauses an einem Abend, an dem jeder anscheinend glaubt, dass er den letzten Sonnenuntergang seines Lebens erlebt, verteidigen zu müssen, spüre ich hautnah. Rund um mich sitzen die Leute beinahe aufeinander, nur ich residiere privilegiert mit drei Sesseln – noch dazu zwei davon unbesetzt – in bester Kaffeehauslage. Das weckt Aggressionen. Berechtigt! Trotzdem verweigere ich anderen Gästen, sich zu mir zu setzen oder auch nur einen Sessel abzuzweigen. Als ich Ilse, von der Peterskirche Richtung Café hetzend, wahrnehme, springe ich auf und winke, um auf mich aufmerksam zu machen.
Ich hätte sie sofort erkannt, auch ohne das Foto auf ihrer Website. Noch immer die gleiche Frisur, halblang, brünett (jetzt wohl gefärbt), die Welle auf der Schulter korrekt nach außen geföhnt. Das beige Businesskostüm ähnelt der Privatkleidung, die sie schon in Schärding getragen hat – wohl jetzt sehr viel teurer. Mit der zu den roten Schuhen passenden roten Handtasche als Blickfang sieht Ilse wie eine richtig erfolgreiche Ärztin aus. Ist sie wohl auch! Eine würdige Vertreterin ihres Berufsstandes! Im Gegensatz zu mir, die ich beschämt auf meine blutverschmierte Wade hinunterblicke, über der ein schlecht gebügelter Rock zipfelt. Vielleicht sollte ich doch mehr auf meine Freundin Erika hören?
Ilse scheint sich über unser Treffen zu freuen: »Servus! Gut schaust aus …«, begrüßt sie mich.
Ich nehme ihre Hand und schließe sie zwischen meine beiden Handflächen ein: »Es tut mir so leid. Ich, ich, ich wusste nicht … Wir haben uns aus den Augen verloren … Tja, die Zeit … Das Schicksal …«
Ilse rettet mich davor, noch mehr belangloses Blabla auszuspucken. Auch ein Psychiater ist nur dann ein Profi im Trösten, wenn es nicht um persönliche Beziehungen geht. Das Bild der nackten, jungen Frauenleiche, jetzt dieser Mutter, mit der ich einige Zeit meines Lebens verbrachte, zugeordnet – das löst in mir plötzlich so was wie einen persönlichen Schmerz aus. Ich spüre, dass meine Augen nass werden. Ehrlich, die Geschichte geht mir nahe.
Ilse spürt das, denn sie umarmt mich spontan.
Um zu verhindern, dass alle Leute im Gastgarten auf uns starren, ziehe ich Ilse Richtung Eingang des Cafés: »Setzen wir uns rein, da sind wir allein.«
Ilse geht vor, ich packe meine Handtasche von einem Sessel und schiebe den anderen Stuhl zum Nachbartisch, vor dessen Gästen ich ihn eben noch verteidigt habe: »Bitte schön …«
Der Mann schaut mich erstaunt an und schüttelt den Kopf: »Jetzt haben wir schon einen …«
»Na, dann eben nicht …« Ich schiebe den Sessel wieder zurück und folge Ilse hinein. Verdammt noch mal, bin ich eines dieser Lebewesen in Wien, das den letzten gefühlten Sonnenuntergang seines Lebens aus Pietät innen drinnen im Café verbringen muss?
Im »Korb« gibt es immerhin keine Klimaanlage. Wir setzen uns an einen Tisch ganz im Eck gegenüber dem Eingang. Da hätte man keine Zuhörer, selbst wenn es Leute drinnen gäbe. Ilse trinkt einen Tee, ich bestelle noch einen Spritzer; den ersten habe ich draußen vergessen. Wir schweigen.
Ilse rührt in ihrer Tasse, und ich versuche eine professionelle Haltung einzunehmen, sprich zu warten, bis mein Gegenüber reden möchte. Da Geduld nicht so meine Stärke ist, unterbreche ich unprofessionell als Erste die Stille: »Wie hältst du das aus?«
Ilse schluckt, drückt ihre Verzweiflung durch den Kehlkopf in Richtung Speiseröhre, blickt mich an, schließt die Augen und schlägt mit der Hand auf den Tisch, dass der Teelöffel auf den Boden springt.
Ich bücke mich und lege ihn wieder auf die Untertasse.
»Gar nicht …«
»Nimmst du was?«, frage ich, denn Tranquilizer sind in so einer Situation ein Segen.
Sie nickt: »Drei Mal ein Lexotanil …«
»Passt! Solltest aber auch einen SSRI dazu nehmen. Weißt eh, die Abhängigkeit.«
Sie schaut mich entgeistert an: »Weißt du, wie egal mir das ist?«
Klar, mir wäre das an ihrer Stelle auch egal. Kind tot, und eine so blöde Kuh wie ich redet über Abhängigkeiten.
»Die Lea war perfekt! Nie ein Problem mit ihr. Ich habe immer gesagt: Mit Lea hab ich so ein Glück, das habe ich nicht verdient. Jetzt muss ich für dieses Glück bitter bezahlen.«
»Hast du noch mehr Kinder?«
Ilse schüttelt den Kopf: »Ich habe nichts mehr außer der Ordination.«
»Schrecklich!«
»Ich möchte nur noch wissen, an was sie gestorben ist, und dann bring ich mich um.«
»Sie war doch nicht krank, oder?«
»Topfit …«
»Was vermutest du?«
»Keine Ahnung, sie sagen Tako-Tsubo-Kardiomyopathie. Das glaube ich nicht, eine Ausrede. Sie vermuten was anderes, sonst wäre sie nicht sofort auf die Gerichtsmedizin gekommen. Ich bekomme keine Auskunft, nur Herumgerede. Drum bin ich froh, dass du dich gemeldet hast.«
»Der Chef der Gerichtsmedizin ist mein Freund, drum weiß ich von deiner Lea.«
»Ich würde mir wünschen, dass du für mich spionierst. Ich muss wissen, woran sie verstorben ist.«
»Ich meine, hm … Ich meine, na ja, hm … Wenn sie keines natürlichen Todes … Also wenn ihr jemand …«
Ilses Gesicht versteinert: »Du brauchst nicht herumreden. Ich sagte schon, ich muss wissen, was da geschah, und dann werde ich mich umbringen. Du brauchst mit mir nicht wie mit einer Patientin reden. Ich lebe nur mehr, um Gewissheit zu haben.«
»Gut. Was weißt du von irgendwelchen Feinden? Konflikte, privat, beruflich?«
»Feinde nein. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ihr ein Oberarzt immer anzügliche SMS und Mails geschrieben hat. Ihr unmittelbarer Vorgesetzter auf der Internen.«
»Das Handy hat die Polizei – nehme ich an.«
Ilse schüttelt den Kopf: »Nein, das Handy habe ich. Als ich ihre Sachen aus dem Krankenhaus abgeholt habe, gab es noch keinen Verdacht auf Fremdverschulden, drum hat mir die Schwester alle ihre Sachen mitgegeben.« Ilse zieht ein Handy aus der Tasche. »Die Polizei hat von mir dann Leas Sachen wieder eingefordert, aber das Handy habe ich verschwiegen. Irgendwie wollte ich nicht, dass Fremde ihre persönlichen Botschaften lesen.«
»Pff, und das ist denen nicht komisch vorgekommen? Ein Mensch ohne Handy?«
»Schon! Ich denke, sie vermuten, dass es wer anderer genommen hat.«
Ich greife nach dem Handy, das am Tisch in einer bunten gehäkelten Hülle liegt. Ich streiche über das wollene Telefongewand. »Damit es nicht friert?«
»Lea hat im Nachtdienst immer gestrickt. Das ist jetzt wieder in – Handarbeiten.«
Ich lächle Ilse an: »Kannst dich erinnern, das haben wir auch gemacht. Du mit dünnen Nadeln, ich mit den ganz dicken.«
Sie lächelt verkniffen zurück: »Du Schal, ich Weste mit kompliziertem Zopfmuster.«
»Genau! Drum du Augenarzt und ich nur Psychiater.« Ich ziehe das Handy aus seiner Hülle und versuche es anzumachen. Akku leer, klar, nach drei Tagen. »Hast du gelesen, was der geschrieben hat?«
»Nein, es war ausgeschaltet, und ich habe keinen PIN.«
»Oje, was machen wir da?«
»Ich schaue, dass ich den PUK in ihrem Schreibtisch finde. Mit dem geht es auch. Den wollte ich schon suchen, aber es war so viel los.«
»Wohnt ihr zusammen?«
»Ja, sie ist nicht ausgezogen. Eine eigene Wohnung hätte sich nicht ausgezahlt, da sie im Turnus ja sowieso noch in die Schweiz gehen wollte.«
»Alle wollen in die Schweiz, drum haben wir keine Jungärzte mehr. Wie heißt der Oberarzt?«
»Babovsky. Ist erst seit einem halben Jahr wieder in Österreich, war vorher angeblich in Amerika. Deshalb hat er auch immer so gescheit getan.«
»Das kennen wir doch auch, oder? Wie hieß unserer aus Amerika?«
»Sie…, Sie…, Sie…?«
»Siegbert, genau. Siegbert. Siegbert, der Sieger!«
Ilse muss lächeln – fast unverkrampft. Die Erinnerung an das Leben vor Lea scheint sie aufzumuntern.
»Rufst du mich an, wenn du den PUK gefunden hast?«
Ilse nickt, trinkt den letzten Schluck Tee aus, schiebt mir das Handy hin und steht auf.
»Nimm’s du, ich schaffe das nicht.«
Ich gebe ihr das Telefon wieder zurück: »Nein, da sind vielleicht noch andere Mitteilungen drauf, die mich nichts angehen.« Dann erhebe ich mich ebenfalls, wir umarmen uns über den Tisch hinweg, der Teelöffel fällt wieder auf den Boden, aber jetzt hebt ihn keine mehr auf.
»Immerhin haben wir uns so wiedergetroffen. Finde ich schön!«
Das finde ich auch. Wahrscheinlich war ich zu jung, um zu erkennen, was für eine feine Person Ilse ist.
Nachdem Ilse verschwunden ist, rufe ich Michael an, um ihm vorzuschlagen, den Rest des Abends mit mir im Gastgarten des »Korb« zu verbringen.
Oh Wunder, er hebt ab. Und er wird kommen.
Selbstverständlich ist jetzt aber draußen kein Tisch mehr frei. Egal, in Amerika hätte ich auch drinnen sitzen müssen – und das mit Klimaanlage.
Gestern war dann doch noch ein wunderschöner Abend, denn Michael hatte sofort einen Tisch im Freien ergattert. Künstlerglück! Wir haben nicht einmal, wie sonst üblich, gestritten, denn die Geschichte mit Lea hat mich friedlich gestimmt. Wie geht es uns gut! Wieso sich sein Leben dann mit irgendwelchen blöden Kleinigkeiten, wie der, dass Michael, ohne mir was zu sagen, beschlossen hat, ab Samstag für drei Tage auf ein Schreibseminar an den Irrsee zu fahren, verpatzen? Blasphemische Exerzitien nenne ich so was.
Am Irrsee dürfte es besonders kreativ ablaufen, denn wenn er von da zurückkehrt, schwebt er in schöpferischen Sphären. Von einem künstlerischen Ertrag habe ich allerdings noch nie was bemerkt. Bis auf ein paar dann in der Wohnung wohl platzierten Notizzetteln schaut nichts dabei heraus. Ich habe es aufgegeben, nachzufragen, wann denn der Roman endlich fertig sein wird. Das Opus magnum braucht eben seine Zeit, meint er. Die Inspiration muss ersessen werden. Dieser Meinung bin ich gar nicht, denn ich denke, dass künstlerische Arbeit einfach auch nur Arbeit ist.
Egal, gestern Abend ließ ich ihn einfach Dichter sein, ohne spöttische Bemerkung über die Last der Kreativität.
Ausgeschlafen und voller Elan – zumindest ich – frühstücken wir noch bei mir, bevor ich in die Arbeit muss. Während ich das Frühstück wegräume, blättert Michael in der Gratiszeitung, die er noch vom Sonntag voriger Woche zerknüllt in seinem Rucksack mitgebracht hat. Er meint, dass es interessanter sei, die News nach einer Woche zu lesen, denn dann wisse man schon, wie sich manche Neuigkeiten überlebt haben, und hält mir eine Überschrift vor die Nase: »Rätselhaftes Verschwinden von Leichen aus der Pathologie im AKH!«
»Von wegen, dass ich schlampert bin! Die müssen schlampert sein! Leichen verloren! Wie gehen Leichen verloren? Erklär mir das!«
Ich nehme die Zeitung, um den Artikel zu lesen. Leider ist genau das Eck unterhalb der Überschrift abgerissen. Ich winke mit der Seite in die Luft über Michaels Kopf.
»Hast du den Rest im Rucksack?«
Michael bewegt sich nicht von der Stelle, sondern deutet nur auf den Boden, wo irgendwo sein Rucksack sein müsste. Ich schaue mich um und entdecke sein Heiligtum (immer dabei!) unter dem Sofa. Ich krame darin und finde außer ein paar gebrauchten Papiertaschentüchern keine weiteren Fetzen.
Also kombiniere ich: Leas Leichnam wurde sofort von der Pathologie auf die Gerichtsmedizin überstellt. Das bedeutet, dass irgendwas auf der Patho nicht stimmt. Vermutlich laufen schon Ermittlungen und man vertraut dem Institut keine Obduktionen mehr an.
Gestohlene Leichen? Da bleib ich dran! Manfred weiß sicher Genaueres, aber unterliegt der Verschwiegenheit. Das bedeutet, dass die tote Lea nicht nur wegen des Verdachts auf Fremdeinwirkung auf die Gerichtsmedizin überstellt wurde, sondern dass man das Verschwinden ihres Korpus verhindern wollte. Sehr spannend! »Kann ich die Zeitung haben?«
Michael wirft das Blatt durch die Luft: »Geschenkt! Das Kasblatt ist für dich, und alles, was da drinsteht, garantiert schon lange vorbei.« Er steht auf und haucht mir einen Kuss auf meinen Nacken, als ich mich gerade nach der Zeitung bücke. »Dein Schwanenhals …«, meint er bewundernd.
Das soll eine Aufforderung für mehr sein. Aber mit der Leichenbotschaft in der Hand ist mir so gar nicht nach Erotik. Ich entwinde mich abrupt, Michael versteht die Botschaft.
Er fasst eine Ecke der Seite, die ich gerade zusammenfalte: »Keine Ermittlungen, versprich mir!«
»Ich schwöre!« Wer redet da von Ermittlungen? Ich werde nur den Ameling, der zufällig Obduktionsgehilfe auf der Patho ist, anrufen, ob ich ihn auf ein Bier einladen darf.
Auf meinem Weg zur Ordination über den Augartensteg spende ich der Zigeunerin, die da am Boden sitzt und mit einem Packbecher bettelt, fünf Euro. Ich bin mir zwar sicher, dass diese bemitleidenswerte, frierende Person das Geld an ihren Kapo abgeben muss, aber auch ich gehorche dem innerlichen Reflex des Ablass-Kaufens.
Ich weiß, dass man Zigeuner nicht mehr sagen darf. Aber es ist doch so: Hat eine Menschengruppe gegenüber einer anderen Menschengruppe ein schlechtes Gewissen, ändert sie erst einmal die Bezeichnung für diese Gruppe, um sie angeblich nicht zu diskriminieren, also zum Beispiel »Zigeuner« auf »Roma« und »Sinti«. Dann geht es denen zwar genauso schlecht wie vorher, aber man kann sich vormachen, dass sie nicht mehr diskriminiert werden. Und dann spendet man, um den lieben Gott zu korrumpieren: Er möge doch dafür sorgen, dass der eigenen Gruppe so ein Elend erspart bleibe. Auch ich bin nicht frei von diesem Aberglauben, ganz im Gegenteil, je agnostischer ich werde, desto mehr muss ich dem Gott, an den ich nicht glaube, bezahlen.
Mutter erwartet mich schon mit einem zweiten Frühstück. Sie ist übrigens frei von jeglichem Aberglauben und braucht sich deshalb beim lieben Gott auch nicht freizukaufen.
»Heute habe ich dir einen Zwetschkenkuchen mitgebracht.«
Ich antworte gar nicht, da ich mich auf keine Diskussion einlassen möchte. Ich tue geschäftig und raffe Befunde, die auf ihrem Schreibtisch liegen, zusammen.
Aber sie lässt nicht locker: »Ist gar nicht einfach, österreichische Zwetschken zu bekommen, die Cilli meint, heuer wäre ein schlechtes Zwetschkenjahr.«
Die Cilli ist ihre Favoritin unter den Standlern am Karmelitermarkt. Den Naschmarkt boykottiert sie wegen der überwiegend ausländischen Geschäfte und der überhöhten Preise.
Ich tue noch immer so, als ob mich das nichts anginge. Sie hält mir den Teller mit dem Kuchen hin. Ich winke ab.
»Das waren übrigens die letzten, die sie hatte.«
Immer diese Erpressung! Soll ich mir den nächsten Kilo hinaufessen, nur weil die Cilli meiner Mutter gnadenhalber ihre letzten Zwetschken verkauft hat? Die letzten Zwetschken, die unwiderruflich letzten Zwetschken, die einzigen Zwetschken in ganz Wien, nein, in Österreich, nein, auf der ganzen Welt?
»Mama, ich habe schon gefrühstückt … mit Michael.«
»Na, das kann ich mir vorstellen, was du da gefrühstückt hast. Kaffee, und sonst nichts.«
»Wir haben ausreichend gefrühstückt …«
»Erzähl mir nicht, dass er Semmeln geholt hat? Nie im Leben.«
Jetzt ist es aber genug. Ich lasse mir meinen Liebhaber nicht immer schlechtmachen. Auch wenn was dran ist, dass er von selber nie auf die Idee käme, für mich Semmeln zu holen. »Michael ist auch nicht zum Semmelholen da«, kontere ich gehässig.
»Na, na, na … Bist mit dem falschen Fuß aufgestanden?«
Ich packe den Papierstoß, schenke ihr noch einen bösen Blick, den sie mit einem gekünstelten Lächeln beantwortet, und verziehe mich in mein Sprechzimmer, nicht ohne die Tür lautstark zu schließen.
Da lasse ich mich in meinen Chefsessel fallen, würge meinen glücksbringenden Plüschelefanten und blase die Mutterluft aus meinen Lungen. Huh! Wieso lasse ich mich immer noch so von ihr reizen? Ist doch nur gut gemeint, der Zwetschkenkuchen? Nein! Der Zwetschkenkuchen ist nicht gut gemeint, der dient nur dazu, auch noch die Kontrolle über so existenzielle Bedürfnisse wie meine Nahrungsaufnahme zu haben.
Kaum ist die ganze Mutterluft draußen, drückt mich das schlechte Gewissen und ich stehe auf, öffne sanft die Tür zum Empfang, tänzle leise an Mutters Schreibtisch vorbei in unsere Teeküche – denn der Kuchen steht nicht mehr vor ihr – und will ihn mir von da holen, als sie hinter mir her säuselt: »Den habe ich der Frau Skodal versprochen, für die Kinder. Die kriegen niiiie so was Gutes. Sie lässt sich sehr bei dir bedanken, dass du drauf verzichtest.«
Frau Skodal ist unsere Putzfrau. Ob sie wirklich Kinder hat, das weiß ich nicht.
»Da hättest du mich aber schon fragen können, ob ich den hergebe!«
»Ich dachte, du ziehst Michaels Semmeln vor …«
»Gerade jetzt möchte ich ihn aber!«
Zum Glück erlaubt unsere wartende Kundschaft keinen weiteren Diskurs, wir müssen losstarten. Bevor ich den ersten Patienten drannehme, bitte ich Mutter, noch einen Befund von Dr. Lea Sibjesky im AKH anzufordern. Sie wirft einen Blick in unsere Kartei, findet Lea da aber klarerweise nicht.
»Die ist nicht von uns.«
»Nein. Bitte trotzdem.«
Mutter schaut mich wissend an: »Tot?«
»Wieso …?«
»Weil dich doch nur die Befunde von deinen Leuten oder die von deinen Selbstmördern interessieren.«
»Weder noch. Bitte ruf an. Wir müssen.«
»Also tot, wie auch immer …«
Mutter nickt zufrieden. Sie mag es, wenn es was zu bespitzeln gibt. Mit vierundachtzig bleibt einem ja nur mehr das parasitäre Teilhaben am Leben der anderen. Zumindest stelle ich mir das so vor.
Nach dem letzten Patienten versuche ich, den Ameling zu erreichen. Ich rufe auf der Patho an, allerdings von meinem Handy, da ich nicht will, dass Mutter davon weiß. Mir kommt es wie eine Ewigkeit vor, bis ich über gefühlte dreitausend Vermittlungen endlich zu ihm durchdringe.
»Hier ist der Ameling, hallo …«
»Hier ist Alma Liebekind-Spanneck. Du kannst dich doch noch erinnern, oder?«
Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit ihm per Du oder per Sie bin. Ich denke aber per Du, denn wir kennen uns eigentlich nur von diversen Saufgelagen, die dann auf der Patho geendet haben. Das ist schon lange her. (Wie lange? Mag gar nicht nachrechnen …) Das war, als ich noch im AKH gearbeitet habe. Bei diesen Festivitäten haben sich alle geduzt, auch der Obduktionsgehilfe den Arzt. Der Ameling und das Bierkrügerl waren immer eine Symbiose. Ich denke, das wird sich nicht geändert haben.
»Hm, Alma, ja die Alma, klar. Mir vergessen nix.«
Leider habe ich aber Amelings Vornamen vergessen, irgendwie muss ich die Kurve kratzen, ihn ohne Vornamen anzusprechen: »Du, hm, du! Ich, ähm, ich hab mir gedacht, dass wir …, die alten Zeiten …, einfach so, jedenfalls … Gehen wir auf ein Bier? Nach dem Dienst?«
»Die Alma, super, die Alma. Das freut den Joschi, mit der Alma!«
Klar, Joschi!
»Hast Zeit um zwei im …?«
Er unterbricht mich: »Ich geh immer ins Colosseum, auf der Nußdorfer Straße. Super! Super Bier und Gulasch.«
Ich schaue auf meine Uhr, dreiviertel zwei. Wunderbar, das Colosseum ist nicht weit von meiner Ordination und auch nicht weit vom AKH.
»Sehr gut, da gehen wir hin. Bis gleich.«
Das Colosseum ist eigentlich ein Buffet, das vor achtzig Jahren zum Zwecke des Gassenverkaufs von Schinkenrollen, Brötchen und allerlei anderem – heute würde man sagen Fingerfood – gegründet wurde. Seither hat sich weder die Speisekarte noch das Interieur verändert. Man wählt am Buffet die Speisen aus, bezahlt und nimmt dann sein Tablett zu einem der Mamortischchen mit. Das Essen ist billig und schmackhaft. Das Bier und der Wein sind ebenfalls billig und trotzdem trinkbar.
Als ich nach meinem kurzen Spaziergang in der Gaststätte ankomme, steht der Ameling, der Joschi, also Josef, schon an der linken Seite des Lokals, angelehnt an so eine altmodische Stehbar mit einem Bier in der Hand. Er winkt mich, als er mich durch die Tür kommen sieht, zu sich. Ich setze mein strahlendstes Lächeln auf – immerhin will ich ja was von ihm – und starte auf ihn zu. Oh Gott, der hat aber zugelegt. Na ja, circa zwanzig Jahre Bierdiät bleiben eben nicht folgenlos. Der Joschi dürfte, grob geschätzt, um die hundertzwanzig Kilo haben. Reflektiert von einem vergilbten Wandspiegel hinter ihm leuchtet seine rote Birne – auf dem Kasten seines massiven Corpus thronend – wie ein Kürbis zu Halloween, nur eben rot anstatt orange.
»Gut schaust aus …«, entschlüpft es mir wenig passend.
Aber der Ameling versteht das zum Glück nicht als Anspielung, sondern als Kompliment. Er klopft sich auf seinen Bauch und meint stolz: »Gell, der gibt was her!« Dann zieht er mich zu sich und schmatzt mir auf beide Wangen. Das sind zwei wirklich ehrliche Bussis, die von Herzen kommen.
Ich bestelle mir auch einen Pfiff Bier, von wegen Solidarität, obwohl ich weiß, dass dann mein Tag gelaufen ist.
Der Joschi schüttelt tadelnd den Kopf: »Ein Pfiff, das ist ja nix …«
»Du, ich muss ja noch arbeiten.«
»Ich sollte auch, aber momentan sowieso nicht viel zu tun.«
»Wieso?«
»Keine Kundschaft.«
»Das gibt es doch nicht, gestorben wird doch immer.«
Ameling nimmt einen kräftigen Schluck von seinem Bier. Dann noch einen und dann auf ex. Nachdem das Krügel leer ist, schreitet er damit behäbig zur Schank, um noch ein weiteres Krügel zu ordern. Die Wirtin kennt ihn offensichtlich, denn sie bedient ihn weitaus freundlicher als jemanden wie mich. Sie schurlt zum Zapfhahn und lässt einen anderen Gast, der gerade dabei war zu bestellen, stehen: »Magst einmal zur Abwechslung ein Hirter?«
Der Joschi wiegt zweifelnd sein Haupt: »Nur kein Risiko, das weißt ja eh, nur kein Risiko …«
Die Wirtin lässt nicht locker: »Ich lade dich ein. Nur zum Kosten.«
Das überzeugt den Ameling: »Na, gut, weil das du bist, probier ich ein Kärntner Bier. Wenn mir schlecht wird, dann hast du die Verantwortung. Alles jenseits vom Semmering ist ein Risiko.«
Das leuchtet ihr ein: »Du wirst sehen, das ist auch nicht schlecht. Einmal was Ausländisches. Nicht immer nur Ottakring.«
Mit dem vollen Glas kehrt der Joschi dann zu mir zurück. Er hält mir das Krügel hin und muntert mich auf zu kosten: »Traust dich?«
Ich schüttle den Kopf und nehme einen Schluck aus meinem Pfiffglas: »Nein danke, ich fürchte mich vor den Kärntnern.«
Zum Glück versteht der Ameling keine zweideutigen politischen Anspielungen und nimmt meine Aussage für bare Münze: »Bier machen können die sicher nicht …« Er kostet, zuerst vorsichtig einen kleinen Schluck, dann noch einen größeren, und schließlich scheint auch das Ausland nicht mehr so gefährlich, denn er zieht ordentlich an, dass gleich mal die Hälfte weg ist. »Pff, nicht schlecht, könnte fast untreu werden.« Dann wankt er mit seinem Glas wieder zur Theke: »Franzi, gib mir noch eines von uns, zum Vergleich.«
Die Wirtin Franzi zapft eines zum Vergleich und Joschi stemmt beide Krügel in Richtung Stehplatz. Dort stellt er das Hirter ab, um es mit dem Ottakringer zu vergleichen. »Hm, hm, auch nicht schlecht. Das ist schwer …, schwer …, sehr schwer …«
Ich finde die Situation zwar amüsant, werde aber langsam ungeduldig, obwohl mir bewusst ist, dass ich warten muss, bis ihm der Alkohol die Zunge löst. Ich denke, dass ich nach drei bis vier Krügel zu meinen Informationen kommen werde: »Musst du nicht mehr in den Dienst?«
Der Ameling wiegt bedächtig seinen roten Plutzer: »Heute zahlt es sich nicht mehr aus. Keine Kundschaft.« Dann klopft er mir auf die Schulter und steht »Habt acht!«: »Zu Ihren Diensten, Frau Professor. Zu Ihren Diensten.«
»Und dein Chef?«, meine ich.
»Chef? Hm? Chef? Der ausländische Depp …«
»Wieso?«
»Na, ein Deutscher eben. Kennst den nicht?«
»Nein, woher auch, bin doch schon so lange weg vom AKH. Ist der neu?«
Joschi wiegt sein Haupt: »Ja, ganz neu. Ich sag immer: Es kommt nichts Besseres nach. Und es ist nichts Besseres nachgekommen. Depp.«
Leider sind beide Krügel leer und er muss Nachschub holen, was unsere vielversprechende Unterhaltung wieder unterbricht. Als er mit einem neuen Krügel zurückkommt, frage ich: »Ottakringer?«
»Bin ein Forscher, drum noch mal Kärntner.«
»Und der neue Chef, auch ein Forscher?«
»Wird schon so sein. Was der allerdings forscht, da kenne ich mich nicht aus. Der tut ultrageheim.«
»Und wieso habt’s keine Kundschaft?«
»Die kommen jetzt woanders hin. Aber nur die Frauen, die Mannsbilder, die bleiben uns. Eh klar, sind ja auch viel mehr Arbeit beim Zerteilen und dann wieder Zusammennähen.«
Ich tue interessiert-verwundert: »Das verstehe ich nicht. Wo kommen die Frauen denn dann hin?«
»Na, zu deinem Freund. Der ist doch dein Freund? Zumindest damals war er’s.«
»Du meinst den Manfred?«
»Klar der, hast du mit dem nicht was g’habt?«
Ich verdrehe die Augen und lache: »Aber geh, doch nicht mit dem Marchel. Wir sind immer noch gute Freunde, aber nicht mehr.«
»Na, der hätt dich aber gern g’schnackselt. Erzähl mir nix.«
Dann schaut er verträumt auf die Stuckdecke des Buffets: »Wer nicht? Warst ein rescher Has’.«
Ich nicke und tue ein bisschen verlegen: »Waren halt wilde Zeiten, damals. Kannst dich erinnern, wie wir im Kühlraum ›Jumpin’ Jack Flash‹ gespielt haben, von deinem Kassettenrekorder?«
Der Ameling freut sich, dass ich mich an gemeinsame Partys erinnere. War wohl das Highlight seiner Jugend, mit den Ärzten zu saufen.
Ehrlich gesagt, habe ich diese Rockmusik nie wirklich mögen. Ich bin schon immer mehr der Klassikfan gewesen, aber damals habe ich eben so getan, als ob ich diesen Krach auch gernhabe. Sonst hätte ich ja nicht dazugehört, dann wäre es mir wie der Ilse gegangen und ich wäre die Streber-Alma gewesen. Nichts schlimmer als das! Immerhin hat mir das Ertragen dieses Sounds die Bekanntschaft des Herrn Ameling ermöglicht, die mir jetzt zugutekommt. Ein Partynetzwerk sozusagen!
Der Joschi, jetzt schon alkoholisch ganz gut eingestellt, nickt verträumt: »Ja, ja, ja, das war was! Jetzt ist’s fad. Nix los.«
»Geh, aber dafür macht’s ihr jetzt mehr Wissenschaft.«
Das war das Reizwort – »Wissenschaft« –, das ich sehr bewusst in die Unterhaltung eingeworfen habe.
Der Joschi springt auch sofort an: »Wissenschaft! Scheiß Wissenschaft. Du hast ja keine Ahnung, was sich da bei uns wegen der Wissenschaft abspielt.«
Ich tue verwundert: »Und was? Ist doch ganz normal, dass auf einer Uniklinik geforscht wird.«
Jetzt wird der Ameling laut: »Normal …«, schreit er, sodass sich die anderen Gäste zu uns drehen und ich ihm beruhigend auf den Arm klopfen muss, »… normal ist bei uns gar nichts.«
»Verstehe ich nicht …«
Dann nimmt er mich zur Seite und flüstert mir ins Ohr: »Bei uns verschwinden Leichen. Und ich schwör dir, der Nähstädt verkauft sie.«
»Der Nähstädt? Wer ist das?«
»Der Chef.« Und verächtlich: »Der Deutsche.«
»Geh, so ein Blödsinn.«
»Ich schwöre es. Ich glaube Hornhautmafia! Da gehört er dazu.«
»Aber geh! Und drum habt ihr keine Kundschaft mehr? Aber wieso nur Frauen, wenn es wegen der Hornhaut wäre?«
»Na, weil die die schöneren Augen haben. Was weiß ich? Und mir unterstellt er, dass ich es war, diese Sau.«
»Wie viel sind denn verschwunden?«
»Bis jetzt zwei junge Weiber.« Er zieht mich wieder zur Seite und flüstert mir ins Ohr, oder was er in seinem Bierrausch für Flüstern hält: »Im April und im Juli. Und dann haben sie uns die Weiber weggenommen.«
»Also das ist echt gemein, gerade dir so was zu unterstellen. Wie lange bist du schon da? Ohne dich täte der Laden ja gar nicht funktionieren. Jeder sagt, dass du der beste Leichenfledderer bist, denn die Patho je hatte.«
»Fünfundzwanzig, ich sage nur fünfundzwanzig. Heuer ist meine silberne Hochzeit mit der Pathologie, und jetzt das.«
Dem Ameling treten aus Sentimentalität die Tränen in die Augen. Ich lege ihm meinen Arm um die Schulter. »Der Manfred meint das auch. Der Manfred hat neulich zu mir gesagt, dass er dem Binder heute noch böse ist, dass er dich nicht ihm gegeben hat. So eine Gemeinheit.«
Er schaut mich treuherzig an: »Wirklich? Der Manfred ist ein Herr! Nicht so ein Depp wie die unsrigen.«
Ich schicke ein Stoßgebet zum Himmel wegen meiner Schwindelei, denn in Wirklichkeit hat der Manfred einmal erwähnt: »Dem Himmel sei Dank, dass der Ameling auf der Patho ist und nicht auf der Gericht. Sonst täte er im Suff meine Wasserleichen erstechen.«
»Und wer waren die Frauen?«
»Geheim, ganz geheim«, nuschelt er so laut, dass es jeder hören kann. »Die eine war sogar eine Famulantin. Stell dir vor, eine von denen.«
»Und wie sie geheißen haben, das weißt du noch?«
»Na sowieso. Ich bin doch oft genug verhört worden. Die Kieberer haben eh nicht geglaubt, dass ich es war. Drum bin ich ja noch immer da. Sonst hätten sie mich ja geschasst. Der Nähstädt wollte das eh.«
»Die Famulantin? Kannst dich erinnern, wie die heißt? Vielleicht kenn ich sie?«
Der Joschi schwankt wieder Richtung Theke wegen Nachschub. Jetzt heißt es aufpassen, sonst ist er noch so beduselt, dass ihm die Namen nicht mehr einfallen. Drum hake ich gleich nach, bevor er den Humpen wieder ansetzt.
»Wie heißt die? Ich meine die Medizinstudentin?«
Und richtig, das Gedächtnis ist schon ein wenig geschwächt: »Irgendwas mit Leber und Rosa. Ja genau, Rosa. Weil so hat meine Schwester – Gott hab sie selig – geheißen. Rosa.«
Ich hake jetzt wegen der Schwester nicht nach, sonst wird es gar nichts mehr mit dem Namensgedächtnis, sondern insistiere auf der Rosa: »Mit Leber?«
Er nickt bedächtig und macht einen ordentlichen Zug aus dem Krügel, dann versucht er, den Namen auszuspucken: »Leber … Leber … Nein, nicht Fettleber, so ähnlich … Leberdick. Nein …«
Ich balle meine Faust in meiner Hosentasche, so als ob ich ihm den Namen herauspressen könnte, und tatsächlich, triumphierend posaunt er ihn in mein Ohr: »Lebertek Rosa. Lebertek Rosa!«
»Du hast ein Gedächtnis«, lobe ich ihn. »Und die andere, kannst dich da auch erinnern?«
Er schmunzelt souverän und stößt mit seinem Krügel an mein Pfiffglas: »Die ist leicht, die heißt Pospischil. Eine Wienerin halt.«
»Und an den Vornamen erinnerst dich auch?«
»Sowieso, den hab ich mir ganz leicht gemerkt, denn meine Nichte heißt auch so. Rat mal?«
Oh nein, nicht jetzt auch noch ein Ratespiel mit einem bald vollkommen zugedröhnten Anhänger des Ottakringers. Ein Versuch und – peng – gewonnen: »Selina?«
»Woher weißt du das?«
»Geraten, ein typisch Wiener Name, oder?«
Joschi wackelt mit seiner roten Birne, die an Farbe gewonnen hat: »Meinst typisch Wienerisch?«
Ich lasse mich auf keine Diskussion mehr ein, sondern verwende meine übliche Notlüge, um mich schleichen zu können. Ich klopfe ihm auf die Schulter: »Du, ich muss. Weißt eh, Ordi … Leben retten. Ich lade dich ein.«
Der Ameling ist richtig gerührt beim Abschied. Er umarmt mich, sodass ich auf seinem dicken Bauch zu liegen komme und seinen Bieratem inhalieren darf. Ich drücke ihn sanft weg und wiederhole: »Ich lade dich ein. Wir sehen uns bald wieder?«
Bevor er mich wieder an sich zieht, rette ich mich zur Theke und kaufe mich bei der Wirtin durch den Erlag von dreißig Euro frei. Also, wenn der Ameling da nicht schon zwei vor meiner Ankunft durch die Gurgel entsorgt hat, dann hat sie mir das Hirter zum Probieren auch verrechnet! Aber ich will nicht streiten. Nur raus aus der Bude und weg vom Bierdunst. Der Joschi winkt mir wehmütig zu und ich frohmütig zurück. Mir ahnt, dass wir uns bald wiedersehen werden.
Draußen auf der Nußdorfer Straße rufe ich die Erika, meine liebste Polizeikommissarin, an. Der Ameling hat mir doch erzählt, dass er verhört wurde, da liegt es doch auf der Hand, von der Frau Inspektor Näheres über das ominöse Verschwinden der beiden jungen Frauenleichen zu erfahren.
»Na so was! Dass du auch noch lebst. Hättest dich auch mal melden können.«
Wenn ich was hasse, dann sind es Leute, die mir Vorwürfe machen, dass ich mich nicht gemeldet habe. Und sie? »Und du? Du hast kein Telefon, oder? Immer soll ich.«
»Du hast mehr Zeit, du bist selbstständig, du kannst dir die Zeit einteilen.«
Kommt sie mir mit der Vorwurfsmasche? Als Nächstes vielleicht noch, dass ich mehr verdiene, oder wie? Das Übliche halt, dass es den Ärzten sowieso am besten geht und sie alle Millionäre sind. Jetzt ist mir schon die Lust vergangen, Erika zu treffen. »Und du …, du …, du …, du bist pragmatisiert.« So, damit wäre das Problem »Wer ist die Stärkere?« mal erledigt. Eins zu eins.
Kurze Funkstille, dann Erika: »Ich gehe jetzt zur Erni. Die macht einen Flohmarkt mit was zu trinken. Kommst auch?«
Mir ist gar nicht nach einer Boutique, gefüllt mit einer Masse stumpfsinniger Weiber, die mit dem Prosecco-Glas in der Hand über ihr trauriges, schweres, anstrengendes, zum Burn-out führendes Leben klagen. Da würde ich am liebsten jeder einen Spaten in die Hand drücken und sie zwingen, ohne Handschuhe einen Erdäpfelacker umzugraben. Nach dann getaner Arbeit, mit Blasen an den Fingern und einem verrissenen Kreuz, dürfen sie dann jammern, so lange sie wollen. »Ich komme. Wann?«
»Den ganzen Nachmittag ist Open House!«
»Ich meine, wann bist du da?«
»Ich bin schon am Weg. Circa halbe Stunde.«
»Und dann beklagst du dich, dass du weniger Zeit hast als ich. Hast du keinen Dienst mehr um die Zeit, um drei?«
»Wieso? Schon fertig, Gleitzeit.«
»Bis dann, Bussl.«
Gut, dann auf zu »Clothes antique« bei Erni Proga.