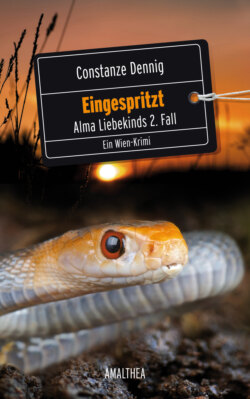Читать книгу Eingespritzt - Constanze Dennig - Страница 7
3. Kapitel
ОглавлениеVor der Boutique »Clothes antique« wartet schon ein Empfangskomitee (auf mich?). Jede der Damen mit einem Prosecco-Glas in der einen Hand, in der anderen eine Zigarette. Von den sechs sich offensichtlich köstlich unterhaltenden – wenn ich ihnen diese zur Schau gestellte Fröhlichkeit auch nicht ganz abnehme – Ladys ist eine Linkshänderin, denn sie hält die Zigarette links. Meine langjährigen Beobachtungen von Rauchern belegen, dass immer dominant geraucht wird, also Rechtshänder rechts, Linkshänder links. Immerhin haben die Smokerinnen Glück mit dem Wetter, sonst müssten sie statt des Prosecco-Glases den Regenschirm in der unterprivilegierten Sekthand halten.
Das Freihausviertel, unmittelbar neben dem Naschmarkt, in dem »Clothes antiques« liegt, ist momentan sehr angesagt. Urban living, Young people, die da living sind. Die Damen vor dem »Clothes antique« sind auch schon ein bisschen antique, tun aber auf young.
Die Erika steht mitten im Geschehen, rund um sie geschart die Pippi, die Puppi, die Mutzi, die Gagsi und die Erni, die Eignerin der Boutique. Sie löst sich sofort aus der Schar, als sie meiner ansichtig wird, und umarmt mich mit Bussi, Bussi – so, als ob ich ihre Freundin wäre. Das bin ich ganz und gar nicht, aber das wünscht sie sich wohl. Nicht, weil ich so ein liebenswürdiger Mensch bin, nein, sondern weil ich erstens Arzt – kann man immer brauchen – und zweitens weil ich Arzt – sind bekanntlich immer Millionäre – bin. Auf dieses Getue falle ich schon lange nicht mehr herein. Ich lächle gequält, auch dann noch, als sie mich sogar noch duzt: »Die Erika hat dich schon angekündigt. A delight! Du … und endlich Zeit zum Schauen.«
»Hm, ich wollte schon lange, aber Sie wissen, die Patienten. Aber jetzt ist es sich endlich ausgegangen.«
Ich bewege mich Richtung Ladys-Group, um die Erika zu herzen. Bis ich allerdings endlich zu ihr durchdringe, habe ich noch etliche Bussis von mir unbekannten Pippis, Putzis, Schnagsis zu erdulden. Was für verschwendete Menschenleben! Und wie viel Frust verbirgt sich wohl hinter diesen Pippi-Larven? Oder auch nicht? Vielleicht ist Mitleid ganz fehl am Platz? Vielleicht bin ich in Wirklichkeit die Frusttante?
Immerhin, die Erni scheint in dieser Society den Platz als Seelentrösterin genial auszufüllen. Ihren Patientinnen kann sie, im Gegensatz zu mir als Profiseelentröster, auch noch einen textilen Trost für zu Hause mitverkaufen.
Dann schaffe ich es endlich bis zu Erika. Sie küsst mich zum Glück nicht, Erika hat eben ein Gespür für »zu viel ist zu viel«. Dafür schlägt sie mir begeistert auf die Schulter: »Bravo! Haben Frau Doktor doch noch den Weg zu diesem Ort gefunden, der sie endlich aus ihrem ärmlichen Graue-Maus-Dasein erretten wird?«
Na, na, na! Das ist ein wenig übertrieben: »Frau Inspektor schätzen die Lage völlig falsch ein, denn Frau Doktor ist auch in ihrem frischen Mausgrau eine Diva.« Dabei drehe ich mich affektiert und greife nach dem Sektglas, das die Erni hilfsbereit gebracht hat.
Die Ladys verstehen nichts, sie kichern und nicken bejahend, nicht wissend, worüber eigentlich.
Erika hat fertig geraucht und zieht mich ins Geschäft: »Weißt eh, die D&G-Jacke, die hat die Erni nur für dich reserviert.«
Erika, du bist eine so schlechte Schwindlerin. Die wollte einfach keiner, denke ich insgeheim, tue aber kooperativ interessiert: »Sehr nett von ihr!«
Immerhin sind wir im Geschäft nicht mehr von dieser Horde gealterter Teenager umringt, und ich kann eine normale Unterhaltung führen. Erika startet zu einem Kleiderständer im Hintergrund und zieht eine blitzblaue Jacke aus dem Wust von anderen Kleidungsstücken. Diese hält sie vor mich hin, den Kleiderbügel genau vor mein Gesichtsfeld: »Genial!« Sie dreht mich Richtung Spiegel: »Genial, schau, genau wie deine Augen. Wie wenn die den Blazer für dich geschneidert hätten!«
»Wer sie?«
»Na, Dolce und Gabbana.«
Ich gucke zwischen der Gabel des Bügels und Erikas haltender Hand durch und stelle fest: Erika hat recht. Das Ding schaut gut aus. Aber der Preis! Zweihundertfünfunddreißig Euro! Horrend! Was hat dieses Teil dann neu gekostet, wenn es jetzt noch so viel wie die Betriebskosten meiner Wohnung ausmacht? »Sehr schön, aber zu teuer.«
Erika schaut mich strafend an: »Zu teuer? Das ist ein Schnäppchen, neu zweitausend, mindestens.«
Da ich sie nicht verärgern möchte, probiere ich das gute Stück. Passt!
Erika schwebt in höheren Designersphären: »Genial! Die Farbe und überhaupt.«
Gut, gut, wir wissen schon, von wegen genial. Obwohl ich mir sicher bin, dass ich für »dieses Blau« nicht so viel Geld ausgeben werde, tue ich so, als ob ich überlegen würde. »Ich glaub, es steht mir …«
»Und wie! Alma, du bist wie, na, wie …, na wie … neu.«
»Wie neu? Bin ich ohne wie alt?«
Erika nimmt mein Gesicht in ihre beiden Hände und drückt meine Wangen zusammen: »Eckerl, glaub mir, du musst was tun. Das sage ich dir in aller Freundschaft.«
Wie ich es hasse, wenn sie mich »Eckerl« (nach den Alma-Käseecken) nennt! Ich streife ihre Hände von meinen Wangen und ziehe die Jacke wieder aus. Während ich sie auf den Bügel hänge, versuche ich, sie auf mein Thema einzustimmen. »Wenn ich tot bin, dann brauche ich kein Gewand mehr.«
»Sag mal, bist depressiv oder was?«
»Ist Herbst, bald haben wir Allerheiligen, da kommt einem so was eben in den Sinn.«
»Gerade dann braucht man was Frisches, was nicht Graues. Drum. Ich sage dir ja, die Jacke ist Therapie, Herbsttherapie.«
Plötzlich erscheint in meinem Kopf wieder das Bild der nackten, jungen, toten Lea. »Als Leiche ist man nackt. Einfach nackt.«
Erika zieht mich hinter einen Kleiderständer, damit uns niemand von den anderen Damen sehen kann, die schon neugierig – zwar ohne Zigarette, aber noch mit Sektflöte – zu uns hinüberlugen. Sie rüttelt mich an den Schultern: »Spinnst du jetzt komplett? Hm? Hast dich von deinen Narrischen anstecken lassen?«
Ich senke mein Haupt, so als ob ich gleich zu heulen beginnen würde. So weit her ist es natürlich nicht mit meinem Mitgefühl für Lea, aber mein dysthymes Gehabe wirkt bei Erika immerhin so gut, dass sie ein bisschen aus der Schule plaudern wird. Sie kennt mich schon lange genug, um zu vermuten, dass mich ein Fall so mitnimmt.
»Welcher Selbstmörder ist es denn momentan, der dir die Lebensfreude raubt?«
»Lea Sibjesky. Ihre Mutter ist eine Freundin von mir, von früher. Ich muss immer an sie denken.«
»Wer soll das sein?«
Die Ladys kommen uns bedrohlich näher. Das passt mir gar nicht. Mit so vielen offenen Ohren rundherum wird Erika nicht aus ihrem Nähkästchen plaudern. Drum bewege ich mich mit dem blauen Ding in der Hand Richtung Kasse. Es wird mir nichts übrig bleiben, als mich mit dem guten Stück freizukaufen. Nächste Woche werde ich es einfach gegen einen Gutschein umtauschen. Da habe ich dann schon ein Weihnachtsgeschenk für Mutter und Erika. Mutter hundertfünfunddreißig Euro und Erika hundert. Damit ist allen gedient und mein Weihnachtsstress auch gleich erledigt.
Die Erni freut sich überschwänglich über das Geschäft: »Bin ich froh, dass ich das Jackerl für dich aufgehoben habe …« Sie legt mir zu dem Jackerl in dem Sackerl noch ein Packerl dazu: »Erst daheim aufmachen«, winkt sie drohend mit ihrem Zeigefinger.
Dann Bussi, Bussi und Tschüss.
So, ich nehme an, dass die Damen jetzt endlich wieder ein Thema zum Besprechen haben, nach dem Motto: »Die ist aber arrogant …«
Erika und ich spazieren Richtung Naschmarkt. Mir tut mein Bein weh, ich versuche aber, nicht zu hinken.
»Was ist los mit dir?«
»Bin nicht gut drauf. Das Mädel …«
»Hab ich was mit der zu tun? Sei ehrlich!«
»Mit der nicht, oder ich weiß nicht, vielleicht kriegst du sie noch … als Fall.«
»Aha, daher weht der Wind. Frau Doktor wollen wieder einmal Kommissar spielen. Eckerl bitte, ich flehe dich an, lass es!«
»Überhaupt nicht.«
»Und wieso dann das Getue? Glaubst, ich kenne dich nicht? Sag schon, bevor ich dich wieder vor einem Mörder retten muss. Ist mir lieber, ich weiß von vornherein Bescheid.«
»Ich war bei Manfred, um Entschuldigung bitten. Ich mag halt nicht, wenn jemand auf mich böse ist.«
»Und?«
»Alles wieder gut. Da war die Leiche von der Lea in seinem Sezierkammerl. Er hat nichts darüber erzählen wollen, außer, dass sie schnurstracks zu ihm gebracht wurde und nicht zuerst auf die Patho.«
Erika unterbricht mich: »Alles klar! Und du kombinierst sofort, dass die ermordet wurde. Ist sie aber nicht! Alle Frauen kommen jetzt sofort auf die Gerichtsmed.«
»Das weiß ich schon vom Ameling.«
»Ameling? Den kenne ich auch nicht.«
»Tss, der Obduktionsgehilfe auf der Patho.« Ich muss kichern: »Wäre ein Mann für dich …«
»Wenn du schon so tust, kann ich mir vorstellen, wie der ausschaut. Unter hundertfünfzig Kilo?«
»Schätze hundertzwanzig, und als Geliebte hat er das Ottakringer, dem er heute mit einem Hirter untreu wurde.«
Erika lacht und gibt mir ein Bussel auf die Wange: »Na schau. Depression weg? Ein bissel über Erika lustig machen und – Depression weg. Sag ich ja immer: Nichts wirkt besser gegen schlechte Stimmung, als über andere zu lästern.«
»Nicht ablenken. Wieso kommen die Frauen sofort auf die Gerichtsmedizin?«
Ich muss rasten, da mein Schienbein gewaltig zieht. Erika schließt daraus, dass ich das Lokal beehren möchte, vor dem wir gerade stehen. Ein Japaner am Naschmarkt, da kann man gleich Sushi essen. Sie deutet auf einen – oh Wunder! – leeren Tisch. Ich bin genervt von den lärmenden Leuten, die an dem Lokal vorbeiziehen, drum ist es mir ausnahmsweise lieber, drinnen zu sitzen. Irgendwie fühle ich mich nicht wohl. Wir setzen uns, eine Erlösung für mein Bein, und bestellen. Erika einen Aperolspritzer, ich einen Apfelsaft gespritzt.
»Du hast ja wirklich Depressionen! Apfelsaft?«
»Mir ist nicht gut, drum.«
»Verursachen dir die zweihundertfünfunddreißig Euro Bauchweh? Geizkragen!«
Ich schüttle den Kopf: »Weiß nicht, mir ist irgendwie komisch. Egal, wird gleich besser werden.«
Ich krame in meiner Handtasche nach einem Schmerzmittel, nach einem Mittel gegen Übelkeit und einem Magenschutzmittel. Keine einfache Aufgabe bei einer Tasche, die alles, was ich zum Leben benötige, beinhaltet.
Erika reicht mir eine stylische Taschenlampe, die sie am Henkel ihrer Tasche befestigt hat. »Da! So was solltest dir auch zulegen. Gibt’s auf der Mariahilfer Straße bei Zottlers.«
Im letzten Eck meines Beutels finde ich dann doch noch ein zerbröseltes Schmerzmittel. Die anderen Tabletten sind da, wo sie hingehören: im Seitenfach. Ich schlucke den Tablettencocktail mit dem Saft hinunter, verschlucke mich ein wenig, aber nicht bedrohlich, und fühle mich sofort besser. Allein das Wissen, mich behandelt zu haben, ist schon Therapie genug. Nichts geht über die Placebo-Wirkung! »Also, wieso bleiben die Frauen nicht auf der Patho?«
»Eigentlich darf ich dir das ja gar nicht erzählen, aber weil es du bist. Ich sag nur Hornhautmafia …«
Erika lügt, das sehe ich sofort an ihrer Miene und weil sie in ihrer Tasche nach den Zigaretten wühlt. Als sie die gefunden hat, steht sie auf und wackelt mit der Packung. »Ich komm gleich wieder!« Sie tut so, als ob sie verlegen lächeln würde wegen der Sucht, aber ich nehme ihr das nicht ab. »Nur zwei Züge, okay?«
Ich nicke und überlege mir, wie ich mehr aus ihr herausquetschen kann. Bei Erika geht das nur über die Kümmererschiene. Wenn sie Sorge hat, dass ich mich wieder in Gefahr bringen werde, dann wird sie, um mich am Ermitteln zu hindern, Informationen ausspucken, die mich das Fürchten lehren sollen. Also gleich mal in medias res gehen.
Als sie wieder hereinkommt, wirkt sie relaxed: »Ich hab uns Sushi bestellt, passt das? Wenig Kalorien, Omega-3-Fettsäuren und … für dich günstig, da nur eine Portion für uns beide. Außerdem bist eingeladen, damit du ein bissel was von der D&G wieder herinnen hast.«
Täusche dich nicht, meine liebe Erika, auch wenn du versuchst, abzulenken – ich werde nicht locker lassen: »Das verstehe ich nicht. Wegen der Hornhautmafia? Die Männer haben doch auch Hornhäute, die nimmt die Mafia nicht oder wie?«
Erika druckst herum: »Jetzt einmal nur die Frauen, dann schauen wir mal.«
Ich greife mir über den Tisch ihre Zigaretten und stecke sie in meine Handtasche. Erika begreift zuerst nicht, was das soll, dann geht ihr ein Licht auf: »Willst du mich erpressen. Meine Sucht skrupellos ausnutzen?«
»Ja! Die bekommst du wieder, wenn du mir sagst, weshalb es nur die Frauen sind.«
»Weil nur die Frauenleichen verschwunden sind! Aber das weißt du doch sicher schon längst von deinem Engerling.«
»Ameling heißt er. Also was sagt die Polizei dazu?«
»Keine Ahnung! Warum, weshalb, wohin? Keine Ahnung, ehrlich. Beide nicht obduziert. Das heißt, wir wissen nicht, an was die wirklich verstorben sind. Das einzige Bindeglied zwischen den Damen ist, dass sie blond, hübsch und jung sind. Und dass die beiden akut, bewusstlos, eingeliefert wurden und kurz nach ihrer Einlieferung verstarben. Und das wirst du auch, wenn du dich aus dieser Geschichte nicht heraushältst!«
Irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich merke, dass ich mich nur mehr schwer konzentrieren kann, auch wenn ich mich noch so anstrenge.
Das bemerkt auch Erika: »Du schaust gar nicht gut aus, hast was?«
Als das Sushi kommt, erregt alleine der Anblick bei mir Übelkeit, trotz Tablette. Als Erika mir von ihrer Portion vier auf einen Extrateller legt und das Sushi dann zu mir hinüberschiebt, winke ich ab: »Nein, danke, mir ist schlecht …«
Erika langt nach meinem Handgelenk, um den Puls zu fühlen: »Um Gottes willen, du rast ja!« Dann legt sie ihre Hand auf meine Stirn: »Klar, du glühst!« Sie rafft ihre Sachen zusammen, winkt nach dem Kellner: »Zahlen!«
Sie versucht, mich von meinem Sitz hochzuziehen, aber ich kann nicht. Meine Beine halten mich nicht, da die rechte Wade pulsiert, als wenn ich drinnen eine Pumpe eingebaut hätte.
Erika seufzt: »Was tun? Frau Doktor? Taxi?«
Ich bin willenlos, viel zu schwach, um nur irgendwas entscheiden zu können. Verdammt noch mal, das Fieber ist jetzt aber schnell eingeschossen. Irgendwo im Hinterkopf weiß ich, dass das mit meinem Unterschenkel zu tun hat und es sich um eine Verlassenschaft der umgeworfenen Rose handeln muss. Aber was nicht sein darf, das darf nicht sein. Mit gesenktem Kopf, der sich so anfühlt, als ob er hundert Kilo hätte, nuschle ich mit gebrochener Stimme: »Wenn du mich nach Hause bringen würdest, wäre nett.« Und stöhnend: »Ich kann den Michael anrufen, dass er mir einen Tee macht.«
»Du kannst gar niemanden anrufen! Wir bringen dich ins Spital!«
Das Wort Spital wirkt wie ein Zauberwort. Ich stütze mich mit meinen Händen am Tisch auf und ziehe mich hoch. Mit zwar zittriger, aber immerhin deutlicherer Stimme protestiere ich: »Nie und nimmer, Spital kommt nicht infrage. Ein Infekt! Nur ein Infekt.«
Erika hat in der Zwischenzeit die App des Funktaxis aufgerufen und einen Wagen zur linken Wienzeile dirigiert. Am Weg zum Ausgang drückt sie dem Kellner noch einen Schein für unsere Konsumation in die Hand. Sie stützt mich, um mich zur Tür hinauszuleiten. »Wir müssen bis zur Straße, geht das?«
Ich nicke, obwohl mich meine Beine kaum tragen. Sie schleift mich Richtung Wienzeile. Die Leute, die an diesem warmen Altweibersommerabend vor den Beiseln sitzen, starren uns an. Wahrscheinlich denken sie: Die hat zu viel getankt. Ich kriege das alles nur wie in einem Film mit, da ich darum ringe, nicht ohnmächtig zu werden. Als wir dann über eine Treppe zur Straße hinunter müssen, ist es endgültig aus mit meiner Kraft. Meine Beine knicken ein und ich lande auf den Stufen. Justament auf einer weggeworfenen Bierflasche, die meinen schwachen Körper auf die nächste Stufe hinunterrollen lässt. Da bleibe ich liegen und will nie wieder aufstehen. Das Bein klopft, mein Magen rebelliert, mein Kreislauf bricht zusammen.
Was dann weiter passiert ist, erfahre ich von Erika erst, als ich in der Ambulanz des AKH auf einer Bahre aufwache. Sie hält meine Hand und wischt mir gleichzeitig den Mund mit diesem rauen Papierkrepp, das in den Krankenhäusern zum Entfernen von Erbrochenem, Stuhl oder Blut verwendet wird, ab. Es ist mir gar nicht gut!
»Bist wieder wach, Eckerl? Geht’s wieder? Bist ohnmächtig geworden.«
»Wo sind wir?«
»AKH, wir warten darauf, dass du ins Zimmer kommst.«
Ich erhebe mich von meiner Bahre, um gleich wieder zurückzufallen: »Nein …«
Erika versucht noch, die Infusionsleitung zu retten, aber zu spät. Der Venflon hat sich verschoben und die Flüssigkeit rinnt anstatt in die Vene in die umgebenden Weichteile. Dieses Brennen ist aber im Verhältnis zu den Schmerzen in meinem Bein ein Wohlfühlweh. Mir ist alles egal. Erschöpft falle ich wieder auf die Liege zurück.
Erika streicht mir beruhigend über die Stirn: »Wirst sehen, alles wird gut. Du hast eine schlimme Entzündung am Bein. Was hast du denn mit dem gemacht?«
Nach einer Ewigkeit kommt eine Schwester mit einem Stationsgehilfen, um mich ins Zimmer zu bringen. Selbst zum Protestieren bin ich zu schwach. Da kein Bett auf der Klasse frei ist, verfrachten sie mich in ein Zimmer mit zwei anderen Frauen. Die Schwester meint noch: »Wenn was frei wird, kriegen S’ ein Klasse-Zimmer.«
Mir egal.
Im Krankenzimmer der allgemeinen Klasse werde ich zwischen eine offensichtlich muslimische (sogar im Bett Kopftuchträgerin, umringt von fünf auf sie für mich unverständlich einredenden Verwandten) mittelalterliche Frau zu meiner Rechten und eine stöhnende geriatrische Patientin zu meiner Linken geschoben.
Die Besucher der Patientin zu meiner Rechten lassen sich durch meine Ankunft nicht stören, auch dann nicht, als die Schwester sie höflich auffordert, nach draußen zu gehen: »Bitte verlassen Sie das Zimmer. Besuchszeit ist schon lange vorbei.« Die Schwester verdreht die Augen, sagt aber resignierend nichts weiter zu ihnen. Sie wendet sich an Erika: »Der Oberarzt kommt gleich.«
Als die Pflegerin und ihr Gehilfe den Raum verlassen haben, pflanzt sich Erika vor den Besuchern meiner Bettnachbarin auf und kommandiert: »Raus …« Sie zückt ihre Polizeimarke. »Sofort, auf der Stelle!« Bevor der Sippenchef noch antworten kann, schiebt sie ihn an der Schulter zur Tür und die anderen Familienmitglieder folgen ihm im Gänsemarsch. »Raus, Wiederschaun …« Dann schließt sie hinter ihnen die Tür. »So das hätten wir!« Sie kehrt an mein Bett zurück und nimmt meine schlaffe Hand: »Mein armes Eckerl! Weißt, wie ich den Michael erreichen kann? Der hebt nicht ab.«
Ich schüttle matt den Kopf. Michael und Handy, das wird nie mehr was. Mir egal.
Sie setzt sich an meine Bettkante und wartet mit mir auf den angekündigten Oberarzt. Derweil tropft die Infusionslösung weiter in meine Ellenbeuge. Mir egal.
Erika merkt, dass da was nicht stimmt, und dreht den Hahn am Schlauch zu. Herrlich, ein kleiner Schmerz weniger.
Dann erscheint der ersehnte Retter in der Tür, gefolgt von einer jungen, verschüchtert wirkenden Assistenzärztin. Trotz meines mentalen Dämmerzustandes erkenne ich den Mann: dicklich, beginnende Glatze, im Gesicht Narben, langer, gedrungener Oberkörper, kurze O-Beine. Das ist der Amerikaner aus dem Rebhuhn, nur eben nicht Amerikaner, eben von da – aus Wien. Ohne mich und Erika vorerst eines Blickes zu würdigen, beschäftigt er sich mit dem Krankenblatt, das ihm die Jungärztin reicht. Dann gibt er ihr die Papiere wieder zurück und startet auf mein Bett zu. »Babovsky …«, schnarrt er, ohne mich zu begrüßen oder mir in die Augen zu schauen. »Wird ein Mycobacterium chelonae sein. Sie haben schon ein Doxycyclin angehängt bekommen, hoffentlich sind Sie nicht resistent dagegen.«
Das klingt ja aufmunternd. Ein sympathischer Bursche! Mir egal.
Erika ist das nicht egal: »Angehängt schon …«, und deutet auf meinen Arm. »Aber leider daneben.«
Babovsky – woher kenne ich den Namen? Mir dämmert, dass ich diesen Namen schon gehört habe. Momentan allerdings schaffe ich es nicht, mein Gedächtnis dazu zu bewegen, nähere Informationen über ihn auszuspucken.
Doktor Grantscherm winkt der Turnusärztin, sich um die Infusion zu kümmern. Die Arme ist sichtlich nervös, als sie vor aller Augen versucht, den Venflon wieder in die richtige Stellung zu manipulieren. Selbstverständlich funktioniert das nicht. Zum Glück dreht sich der Chef um und verlässt ohne Gruß oder sonst eine weitere Äußerung den Raum. Mir egal.
Als er draußen ist, rutscht es Erika heraus: »Arschloch!«
Die Kleine schaut sie verschreckt an, denn das darf man doch nicht über einen Oberarzt sagen.
Aber Erika meint noch einmal, um ihr Statement zu untermauern: »Arschloch …« Und lacht.
Das bewirkt, dass die junge Kollegin – da sie ihre Unsicherheit überwindet – es tatsächlich schafft, das Röhrl richtig in meiner Vene zu positionieren.
»Was hat sie?«, fragt Erika.
»Eine schwere Infektion des Unterschenkels. Durch die Dornen, die da noch drinnen waren.«
Erika reißt die Augen auf und mustert mich vorwurfsvoll: »Alma, das musst du doch bemerkt haben. Kein Mensch hat Stacheln irgendwo drin, ohne sie zu bemerken.« Dann schüttelt sie den Kopf und seufzt: »Ich pack es nicht.«
Mir egal.
Ich schrecke nur kurz auf, als mein Michael bei der Tür des Krankenzimmers hereinstürzt, sich auf mein Bett wirft und mich drückt, so als ob ich schon tot wäre.
»Hm, Alma …, hm, Alma …«
Erika kommentiert trocken: »Sie lebt noch. Wieso kommen Männer eigentlich immer zu spät?«
Michael stottert: »… hab den Anrufbeantworter abgehört, … Katastrophe«, dann drückt er mich wieder: »Mein Engel …«
»Dein Engel wird das Mykobakterium sicher überleben. Ob sie aber dich überlebt? Da bin ich mir nicht so sicher …«
Ach wie schön, von meinem Michelangelo in den Schlaf geschaukelt zu werden. Er zieht einen Sessel zu meinem Bett, fasst mich um die Schulter und wiegt mich in den Schlaf. Das ist zwar gut gemeint, aber mit einem Krankenhausbetrieb nicht kompatibel. Kaum merke ich, wie ich entspannt in Orpheus Gefilde entschlummern würde, reißt die Schwester die Tür auf und brüllt meine Besucher an: »Die Besuchszeit ist beendet, meine Herrschaften, Nachtruhe!«
Erika ist erbost: »Sagen Sie mal, warum schreien Sie uns an, wo wir doch niemanden stören? Und die Besucher vorher, da haben Sie den Schwanz eingezogen. Ich muss schon sagen, das ist keine Art!«
Die Schwester keppelt zurück: »Wir nehmen Rücksicht auf die jeweilige Kultur. Diese Menschen sind es gewöhnt, dass sie ihre Angehörigen um sich haben.«
»Und die, deren Angehörige es nicht sind? Was ist mit denen? Müssen die auch auf die andere Kultur Rücksicht nehmen? Muss meine Freundin halb bewusstlos diesen Lärm in Kauf nehmen, nur aus Rücksicht auf irgendeine Kultur?«
Michael blickt Erika fragend an, er versteht nur Bahnhof. Meine rechte Nachbarin murmelt etwas Unverständliches vor sich hin und der geriatrische Fall zur Linken schnarcht schon. Wahrscheinlich gut eingestellt. Ich ertrage jetzt keinen Konflikt, ich bin zu matt, drum deute ich Erika, sich zu beruhigen.
Sie verdreht die Augen und seufzt: »Gut, ich gehe jetzt …« Und wendet sich an die Schwester: »Aber wehe, Sie haben für Frau Dr. Spanneck nicht morgen ein Bett in einem Einzelzimmer.«
Die Schwester lächelt verkniffen: »Wir werden schauen …«
Erika busselt mich liebevoll ab und wendet sich Michael zu: »Und du?«
Michael zuckt mit der Schulter: »Ich bleibe, mich müssen die schon mit der Polizei abholen.«
Erika lacht: »Sag ihnen, dann sollen sie bitte gleich mich bestellen!« Dann ist sie weg – meine liebste Freundin.
Michael wechselt den Sessel mit dem Lehnstuhl aus, der am Fenster steht, um sich für die Nacht einzurichten.
Die Schwester, die der rechten Nachbarin eine Schlaftablette in den Mund schiebt, beobachtet das argwöhnisch: »Ich sagte schon, Sie müssen gehen!«
Michael würdigt sie keines Blickes. Erst als die Nurse an mein Bett kommt und ihn versucht wegzuschieben, um meine Infusion zu wechseln, steht er auf.
Ich lege meine Hand auf seine Hand und drücke sie: »Geh! Ich schlafe jetzt. Du kommst morgen gleich in der Früh wieder.«
Er schüttelt den Kopf: »Kommt nicht infrage, meine Liebste.«
Die Schwester bemerkt spöttisch, aber auch irgendwie versöhnlich lächelnd: »Kommen S’ morgen wieder, Sie Turteltaube …«
Dann fällt mir ein, dass man ja morgen meine Patienten verschieben muss. Zum Glück beginnt die Ordination erst am Nachmittag. Manchmal hat es doch was Gutes, wenn man eine Mutter hat, die nicht früh aufstehen will. Drum starten wir nie vor halb elf. Mir passt das auch so, wenn ich auch so tue, als ob ich Mutter zuliebe so spät zu ordinieren anfange. »Bitte ruf Mama noch wegen morgen an. Sie muss die Leute verschieben. Tust du das für mich?«
»Kein Problem.«
»Und dann bitte noch in meine Wohnung fahren und die Waschmaschine ausräumen.«
»Sonst noch Aufträge? Du willst mich nur loswerden.«
Ich strecke ihm meine Arme entgegen: »Nein, aber ich schlafe jetzt sowieso.«
Dann küssen wir uns liebevoll, aber ziemlich platonisch.
Michelangelo flüstert mir ins Ohr: »Du darfst auch im Fieberwahn nicht vergessen: Ich liebe dich!«
Ich flüstere zurück: »Niemals, ich dich auch …«
Als er draußen ist, bietet mir die Schwester eine Schlaftablette und eine Schüssel zum Pinkeln an – ich nehme beides.
Fieberträume sind wie ein Spaziergang zwischen realer Welt und Phantastischem Realismus: Ich beobachte mein rechtes Bein. Aus winzigen Löchern gucken mich freundlich, mit riesigen Augen, so wie Bambi aus dem Zeichentrickfilm, Hunderte rosarote Würmer an. Sie drehen ihr Köpfchen, scheinen zu lächeln und winden sich aus den Löchern. Kaum sind sie an der Oberfläche, beginnen sie sich umeinander zu winden, so, als würden sie tanzen. Ich empfinde Genugtuung, dass ich ihnen mein Bein als Wohnung zur Verfügung stelle. Gerade, als sie sich wieder in ihre Löcher zurückziehen möchten, erscheint Babovsky in Begleitung von Ameling mit einer Hacke. Ameling scheint mich warnen zu wollen, denn er winkt mit seinem Bierkrug. Dadurch ergießt sich die gelbe Flüssigkeit über Babovskys Kopf, gerade als er mit dem Beil auf mein Bein zielt.
Als ich aufschrecke, sehe ich aber nur eine Pflegerin, die an meiner Decke zieht, da ich, wie im Spital üblich, um halb sechs geweckt werde. Der Nachtdienst muss dem Tagdienst eine ordentliche Abteilung übergeben. Das bedeutet: aufwecken, Bett machen, bei Bedarf wickeln, Fieber messen, Blutdruck messen, Blut abnehmen, Frühstück servieren und so weiter. Als ich noch im Krankenhaus gearbeitet habe, habe ich diesen Trubel gar nicht mitbekommen, da ich um die Zeit gemütlich bei einem Kaffee im Besprechungszimmer gesessen bin. Die Perspektive eines Krankenhauses aus der Sicht des Patienten war mir bisher fremd. Ehrlich, die Patientensicht ist für mich ganz und gar nicht attraktiv. Hektik und Lärm, der bald auch noch durch die Ankunft der muslimischen Angehörigen verstärkt wird, prägen den Tagesbeginn. Aber immerhin: Es geht mir besser, das Fieber scheint gesunken zu sein. Außerdem ist mir in meinem Traum eingefallen, wo ich den Namen Babovsky schon gehört habe. Von Ilse! Das ist der Oberarzt, der Lea anzügliche SMS geschrieben hat. Vielleicht macht er das auch bei der kleinen Assistenzärztin? Da bleibe ich dran.
Ich merke, dass meine Lebensgeister wieder zurückkommen. Die fühlen sich dann allerdings mehr theoretisch an, als ich versuche, aufzustehen, um die Toilette aufzusuchen (diese Kloschüsseln sind entwürdigend!). Da sacken sowohl mein rechtes Bein als auch der Blutdruck ab, obwohl ich kaum mehr Schmerzen verspüre. Na, da haben die mich wohl ordentlich mit Analgetika vollgepumpt! Ich kann mich gerade noch am Gitter des Bettes festhalten, um nicht auf den Boden zu fallen. Also wälze ich mich zurück auf mein Lager und läute nach der Schwester. Peinlich! Peinlich! Krank sein ist einfach nur peinlich!
Der Tagdienst scheint besser gelaunt als der gestrige Nachtdienst. Die Pflegerin stellt sich freundlich vor und verkündet mir, dass ich verlegt werde: »Schwester Britta. Sie kommen auf die Station 3 B, Klasse.«
Das ist mir aber gar nicht recht, denn dann verliere ich den Dr. Babovsky aus den Augen, der mir hier durch die glückliche Fügung einer Rosendorneninfektion sozusagen am Tablett serviert wird. »Muss das sein?«, frage ich.
»Wieso, Sie wollten doch auf Sekunda?«
»Tja, aber jetzt möchte ich lieber dableiben. Das Zimmer ist ganz in Ordnung, und so lange wird es wohl nicht dauern. Außerdem kennt man mich hier schon und dort geht alles wieder von vorne los.«
Die Schwester kapiert nichts, sie schüttelt verwundert den Kopf: »Aber Sie wollten doch …«
»Stimmt nicht! Meine Freundin meinte, dass ich auf der Klasse besser aufgehoben wäre. Ich als Ärztin aber weiß ja …«, dabei schaue ich die Nurse verschwörerisch an,»… dass das nicht stimmt. Wir beide kennen das doch, dass man auf der Klasse verloren ist, oder?«
Die Schwester strahlt über dieses Kompliment: »Na gut, dann sag ich Bescheid.«
Das ist ja noch mal gut gegangen. Hätten die mich auf 3 B verlegt, dann hätte sich meine Entzündung gar nicht ausgezahlt. Dann hätte ich gleich gesund bleiben können. Dann hätte ich mir den ganzen Krampf sparen können.
Ich checke meine Mails, tatsächlich eines von Ilse: »PUK gefunden. Habe SMS gelesen. Ziemlich ordinär. Soll ich Polizei?«
Ich schreibe zurück: »Noch nicht. Ich bin leider im Spital. Infektion. Melde mich, sobald ich Bett verlassen.«
Die Turnusärztin kommt Blut abnehmen. Diesmal klappt das Stechen gleich auf Anhieb.
Ich lobe sie: »Das machen Sie super. Wie lange sind Sie schon da, dass Sie so eine Routine haben?«
So ein Lob von einer alten Kollegin freut sie natürlich: »Vier Monate …«
»Und wie ist es so?«
Sie drückt ein verzwicktes »Schön« heraus.
»Schön? Im Turnus ist es nicht schön. Da ist es anstrengend, frustrierend, man ist müde, der Chef ist grauslich, die Schwestern fäulen einen an, man verzweifelt mehr oder weniger. Nicht schön…«
Sie nickt verlegen: »Es geht. Woanders ist es vielleicht noch schlimmer.«
»Und der Chef? Gestern war der ja ziemlich rüde.«
»Es geht …«
Ich versuche, ihr meine Solidarität zu vermitteln: »Ich war doch selber Turnus, ich weiß, wie das ist. Er ist ein Kotzbrocken, oder?«
Sie verzieht den Mund, so als ob sie gleich losheulen würde. »Geht«, stößt sie unglücklich heraus.
Ich streiche ihr über den Kopf: »Hallo, bei mir brauchen Sie nicht lügen. Ich hatte auch so einen. Wird er auch zudringlich? Im Nachtdienst?«
Ich kreuze meine Beine unter der Bettdecke zur Abbitte, denn ich hatte gar keinen so einen. Meiner war ein Schatz, der mich förderte, mich unterstützte und mir alles beigebracht hat, um ein funktionierender Psychiater zu werden. Sorry, Felix, Notlüge, die du verstehen würdest, oder? Wie ich auf dem Namensschild, das auf dem weißen Mantel befestigt ist, lesen kann, heißt die Ärztin Beate Lorenz: »Frau Dr. Lorenz, seien Sie ehrlich. Eine hat schon draufgezahlt …«
Als sie das hört, flieht sie panisch von meinem Krankenbett. Bingo, der Schuss hat gesessen. Die weiß alles über Lea.
Mein Vormittag wird kurzweiliger, als ich dachte, da meine Mutter erscheint. Ja – erscheint. Die nette Schwester öffnet die Tür, um sie ins Zimmer zu lassen. Mutter schreitet durch das Portal, schenkt der Domestikin einen dankenden Blick, durchstreift den Raum, während die Schwester leise die Tür schließt. Dann winkt sie die Schwester zu meinem Bett. Diese darf am Fußende stehen bleiben, während sie die Bettdecke lüftet, um mein Bein, das sowieso verpackt ist, zu begutachten. Ich wurde mit keinem Gruß bedacht, man straft mich mit Verachtung.
Sie stellt ihre altmodische Ärztetasche (so eine bauchige Ledertasche mit zwei Bügeln, die beim Schließen ineinanderklicken – Erbstück) auf mein Nachtkästchen, öffnet diese, langt den Zwetschkenkuchen heraus und legt ihn auf den Frühstücksteller, der noch unbenützt dasteht. Dann winkt sie der Schwester: »Das können Sie wegräumen. Trockene Semmeln essen wir nicht …«
Gehorsam nimmt die Schwester das Frühstückstablett weg.
»Sagen Sie dem Oberarzt, dass ich ihn sprechen möchte. Ich bin noch eine halbe Stunde da.«
Die Pflegerin stottert: »Der Herr Dr. Babovsky macht Visite. Er …, er … kann nicht …«
Mutter schaut sie verärgert an: »Was soll das heißen? Man bekommt hier keine Auskunft? Ist das eine Klinik oder ein Buschspital? Was heißt Buschspital? Ein Saftladen ist das!«
»Aber …, aber … Er … er wird keine Zeit haben, jetzt.«
»Dann wird er sich die Zeit nehmen müssen … Für eine Kollegin. Sonst gibt’s ein Problem. Kindchen, richten Sie ihm das aus.«
Das »Kindchen« – ich schätze das Kindchen auf circa vierzig – schurlt aus dem Zimmer.
Mutter stemmt sich auf das Gitter am Fußende meines Bettes. Die Mundwinkel verkrampft, die Augenbrauen nach oben gezogen, demonstriert sie mimisch ihre Missbilligung meines Fehlverhaltens.
Ich ahne, was da auf mich zukommt: »Du brauchst nichts zu sagen, ich gebe zu …«
»Ich sag ja auch nichts. Was für eine genetische Katastrophe habe ich geboren? Von mir hast du das nicht. Wer nicht hören will, muss fühlen. Ich hoffe, es fühlt sich schrecklich an.«
Ich betrachte betreten meine Bettdecke: »Tut es! So herauseiternde Dornen tun ziemlich weh. Also der Buße genug.«
Ich warte noch auf die Fortsetzung der Schimpftirade. Meiner Erfahrung nach braucht sie dazu noch ungefähr fünf Minuten, und dann ist die Luft raus. Aber nichts geschieht.
Sie steht weiter am Bettende, schüttelt den Kopf und damit ihre missbilligenden Augenbrauen wieder in eine sanftmütige Stellung. Dann ziehen sich die Mundwinkel nach oben, sie lächelt, macht zwei Schritte auf mich zu und umarmt mich: »Kind, wieso hast du die nicht herausgezogen?«
Ich umarme sie zurück: »Weißt eh, vergessen …«
»Du Wahnsinnige! Von wem du das wohl hast?«
Ich schmunzle: »Von dir?«
Dann lacht sie: »Kann nicht sein …« Sie nimmt ihre Ärztetasche wieder vom Nachtkastel, öffnet sie und zieht Zettel heraus: »Hier der Totenschein der Sibjesky. Und wer war der Arzt, der den Totenschein ausgestellt hat? Dein Oberarzt Babovsky!«
Ich nehme die Papiere, tue aber unbeteiligt: »So ein Zufall!«
»Mir kannst nichts vormachen. Da ist was. Aber wir haben ihn ja hierher bestellt.«
Ich kann gerade noch den Befund unter meiner Decke verschwinden lassen, als tatsächlich der Oberarzt durch die Tür hereinkommt.
Mutter wendet sich ihm zu und setzt ihr strahlendstes Routinelächeln auf: »Herr Oberarzt, so ein Zuvorkommen! Ich danke Ihnen, dass Sie uns ein Eckchen Ihrer kostbaren Zeit opfern. Aber das Mutterherz will halt seine Sorgen abladen.« Sie nimmt seine Hand und drückt sie zwischen ihren Händen.
Ich flehe in Gedanken zum Himmel: »Bitte nicht küssen!«
Doch kaum habe ich das gedacht, hat sie schon einen Luft-Kuss auf die Hand zwischen ihren Händen gehaucht: »Dass Sie ihr Leben gerettet haben, das vergesse ich Ihnen nie.«
Babovsky verschlägt es noch mehr die Sprache, als er sowieso sonst sprachlos ist. »Na, na …, gute Frau«, versucht er, ihr seine Hand zu entziehen. »Hm, hm kein Leben zu retten.«
Er hat keine Chance, Mutter umklammert ihn weiter, während sie ihn zum Bett zieht: »Man weiß ja, wie es auf so einer Klinik zugeht. Immer Hektik, nicht einmal Zeit für ein Kaffeepauserl. Aber da …«, sie löst ihre Umklammerung, um den Zwetschkenkuchen zu nehmen und ihn ihm direkt vor den Mund zu halten: »Kosten Sie. Österreichische Zwetschken, ungespritzt.«
Babovsky bleibt nichts anderes übrig, als den Teller in die Hand zu nehmen. Er schluckt und ringt um eine medizinische Erklärung meines Zustandes: »Hm, die Frau Kollegin, hm, Infektion …, Mykobakterien … Alles wieder unter Kontrolle, gell, Frau Kollegin?«
Die Frau Kollegin nickt und wünscht sich auf den Mond, weil sie sich für ihre Mutter so fremdschämt.
Ich nicke: »Geht schon wieder. Kann ich heute wieder nach Hause?«
Er schaut mich ungläubig an: »Wie stellen Sie sich das vor? Haben Sie jemand, der ihnen das Doxycyclin anhängt?«
Da tritt Mutter wieder auf den Plan: »Das mache ich. Kein Problem!« Und wissend: »Mykobakterien, prima vista, hm …«
Die Ärztetasche am Nachtkastel und das gespielte Fachwissen weisen Mutter als vermutliche Kollegin aus, drum nickt er ihr respektvoll bejahend zu: »Na dann, also … dann …. Wenn das Fieber weg ist, dann morgen.« Er wendet sich ab, um sich wieder kränkeren Patienten zu widmen, in der Hand noch immer den Teller mit dem Zwetschkenkuchen.
Mutter rennt hinter ihm her, zupft ihn an seinem weißen Mantel, um ihn festzuhalten und zirpt: »Danke, Herr Oberarzt! Danke und schönen Dank!«
Er dreht sich kurz zu ihr um, da sie ihn nicht loslässt.
»Haben Sie auch eine Privatordination? Sie wirken auf mich so vertrauenswürdig, und ich brauche einen Internisten … Das Herz, Sie wissen: die Insuffizienz.«
Er druckst etwas verlegen: »Eigentlich bin ich kein Kardiologe.«
»Ach wo! Ein EKG werden Sie schon machen können …«
Er zieht eine Karte aus seiner Manteltasche und gibt sie Mutter.
Die strahlt ihn an: »Da melde ich mich gleich an. Ist ja so schwer, einen guten Internisten …«
Diesmal entkommt er, ohne von ihr weiter aufgehalten zu werden.
»Den schauen wir uns mal genauer an, gell, mein Schatz?«