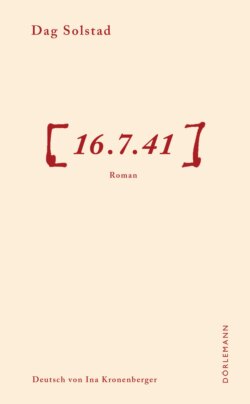Читать книгу 16.7.41 - Dag Solstad, Даг Солстад - Страница 6
Fußnoten Kapitel 1
ОглавлениеFußnote 1.
»Wie immer bin ich derjenige, der das hier schreibt. Doch wer ist derjenige, der sich in der internationalen Abflughalle des Flughafens Fornebu befindet, um mit einem SAS-Flug nach Frankfurt am Main zu reisen? Ich bin derjenige, der schreibt. Ich, der das hier schreibt, sage, der Mann am Flughafen ist derjenige, der schreibt. Also ich. Mein ›nacktes‹ Ich. Ich denke zurück an mich in Fornebu an einem Oktobertag 1990 und schreibe diesen Text. Das liegt jetzt mehr als zehn Jahre zurück.«
So lautete der ursprüngliche Einstieg ins Buch, der aber nicht zum eigentlichen Einstieg wurde, sondern zum verworfenen Versuch eines Einstiegs, wenngleich dem ersten in einer ganzen Reihe. Was ich damit erreichen wollte, war eine deutliche zeitliche Kluft zwischen mir, dem Schreibenden, und mir, dem Ich im Text. Das schreibende Ich ist nicht identisch mit dem handelnden Ich, obwohl beide Schriftsteller sind und auch Dag Solstad heißen, es ist derselbe Name, der als Autor auf dem Titelblatt dieser Erzählung stehen wird. Dieser Einstieg ermöglichte es mir, Dinge wie diese zu schreiben:
Fußnote 1b.
»Ich war damals wie heute ein gewöhnlicher Reisender, ausgestattet mit der selbstbewussten Achtsamkeit des Reisenden und ohne Bewusstsein dafür, dass eine Reihe ereignisreicher Jahre vor mir lagen, was dem jetzt schreibenden Ich hingegen vollkommen bewusst ist. Zu diesen Jahren gehören beispielsweise eine Reihe bemerkenswerter Ereignisse im privaten Bereich, aber auch die Tatsache, dass ich in der vor mir liegenden Zeit, von jenem Zeitpunkt an, als ich in Fornebu stand, bis zu dem Augenblick, in dem das hier geschrieben wird, vier neue Romane schreiben sollte, die noch nicht ausgebrütet waren, nicht einmal als vage Idee, ja nicht einmal als Ahnung, sie befanden sich damals völlig außerhalb meiner Vorstellungskraft, sie waren nicht einmal zu denken, wohingegen sie jetzt geschrieben sind und ein wichtiger Teil meiner Identität. Wenn ich damals Vorstellungen von meiner Zukunft hatte, waren sie wohl eher darauf gerichtet, dass ich in ein paar Jahren meinen fünfzigsten Geburtstag feiern sollte und was das für mein Leben bedeuten würde. Jetzt ist derjenige, der schreibt, sechzig.«
Oder er ermöglichte mir, Dinge wie diese zu schreiben: »Derjenige, der das hier schreibt, weiß, dass ich vor mehr als zehn Jahren mit diesem Flugzeug geflogen bin, und ich weiß im Moment des Schreibens, wie die Reise verlief. Doch derjenige, der vor der Departure-Anzeigetafel des längst stillgelegten Flughafens Fornebu steht und nichts weniger ist als ›ich‹, ist auf seiner Reise noch nicht weitergekommen als bis zu dieser Tafel, vor der er steht, um die Flugnummer, das Gate und die Boardingzeit herauszusuchen, und er hat viel Zeit vor sich, die noch nicht gefüllt ist und über die er noch nichts weiß, obgleich wir beide ›ich‹ sind, das schreibende Ich wie auch das Ich, über das ich schreibe. Wir sind beide ich und nennen uns ich und können jedes Mal, wenn einer von uns etwas denkt, ›dachte ich‹ oder ›sagte ich‹ oder ›fragte ich mich‹ sagen, und doch trennen uns gut zehn Jahre, und ich, der das hier schreibt, weiß viel mehr über ihn, der beschrieben wird, als er selbst, und auch viel mehr über ihn als über mich selbst und meine Zukunft, über die ich gar nichts weiß, weil sie vor mir liegt und nicht geschaut werden kann, und doch sind wir beide, sowohl ich mit einer Zukunft, die ich mir nicht vorstellen kann, als auch er, über den ich schreibe, ausgestattet mit dem Wort ›ich‹, dem einzigen existierenden Wort, das ausschließlich mir vorbehalten ist. Das Wort ist Ur. Die verrinnende Zeit.«
Wie man sieht, habe ich versucht, einen Einstieg hinzubekommen, der die Auflösung der Identität in der Begegnung mit der Zeit einbezieht. Es ist also eine Art düsteres Spiel, mit dem ich meinen neuen Roman ursprünglich beginnen wollte. Dass es sich eindeutig um meine eigene Identität gehandelt hat, hat mich vermutlich ebenfalls angespornt. »Wie immer bin ich derjenige, der das hier schreibt.« Wie immer war ich derjenige, der das hier schrieb: »Zu Beginn dieser Geschichte ist Bjørn Hansen gerade fünfzig geworden und steht am Bahnhof von Kongsberg«, wie es zu Beginn von Elfter Roman, achtzehntes Buch heißt, dem nächsten Buch, das der Ich-Erzähler aus der Eröffnungsszene dieser Geschichte schreiben wird und von dem er noch nichts ahnt, das jedoch von mir geschrieben wurde, so wie stets ich derjenige bin, der das hier schreibt, und darauf verweise ich mit dem zunehmenden Verdacht, dass dieses »Ich« kein Ich ist, sondern etwas anderes, etwas, das sich auflöst, wenn man anfängt, es näher zu untersuchen, z.B. in einer Art Spiel mit Wort und Zeit, doch auch in dieser Auflösung bin immer ich derjenige, der das hier schreibt. Das scheint mich sehr zu beschäftigen, da ich darauf poche, meinen neuen Roman mit diesem Spiel zu beginnen, während ich nun also fliegen will.
Dennoch habe ich diesen Beginn verworfen. Warum habe ich ihn verworfen? Es war ein langer Prozess, der erst endgültig abgeschlossen war, als ich mich beiseitenahm und mich eindringlich mit Du ansprach, um etwas Distanz in die Sache zu bringen. Jetzt schreibst Du schon, sagte ich zu mir selbst, seit mehr als fünfunddreißig Jahren Bücher, warum hast Du das hier nicht zu einem früheren Zeitpunkt aufgegriffen? Dafür hättest Du jahrelang Zeit gehabt und auch die Gelegenheit, es zu machen, aber das hast Du nicht getan. Du magst sagen, es ist ein Versäumnis, und es bedauern, aber das nützt mir nichts. Ich will jetzt fliegen und mich nicht mit Deinen Versäumnissen in einem Zeitraum von fünfunddreißig Jahren gelebten Lebens beschäftigen. Es ist jetzt zu spät, um mit einem »Wie immer bin ich derjenige, der das hier schreibt« anzukommen. Die Zeit ist Dir davongelaufen. Dass man begreift, in welcher Phase des eigenen Lebens man sich befindet, ist unabdingbare Voraussetzung für das beanspruchte Privileg, sich in fiktiver Form an die Öffentlichkeit zu wenden. Ich befinde mich in einer Phase, in der es zu spät ist, um dieses düstere Spiel mit Wort und Zeit mit mir selbst als Objekt oder Opfer anzustellen. Mich beschäftigt die Zeit, aber nicht in dieser aufgelösten Form. Meine Auflösung ist eine andere, ihr muss ich mich zuwenden. Dass mich dieses Spiel noch immer fasziniert, muss man als etwas Bedauernswertes hinnehmen, das keinerlei Legitimität verleiht, es in einen Romananfang zu pressen, wenn ich gerade fliegen will.
Darum verwarf ich diesen Einstieg. Hoffentlich war es der glückliche Ausgang eines schwierigen Prozesses. Endlich davon befreit, kam mir jedoch eine Idee. Wie wäre es, wenn ich diesen Roman mit Fußnoten ausstatten würde? Dann könnte ich derlei Betrachtungen mit einbeziehen, die ich dem Leser soeben präsentiert habe. Gesagt, getan. Ich beschloss, diesen Roman mit Fußnoten auszustatten, wo immer es mir in den Sinn kommen sollte.
Fußnote 2.
Ursprünglich hatte ich hier einen langen Vortrag stehen, in dem ich mich an diesem Oktobertag vor mehr als zehn Jahren von außen schildere. Unter anderem meine Kleidung, und ich hielt mich besonders lange bei der Frage auf, ob ich einen Anzug trug oder nicht, und wenn ja, welchen Anzug: »Trug ich einen Anzug? Ich nehme es an, da ich nur Handgepäck dabeihatte, weshalb ich den Anzug am Leib trug, damit er nicht im Koffer zerknittert wurde. Und ich wäre kaum ohne Anzug verreist, da ich an einer Literaturveranstaltung in Frankfurt teilnehmen wollte. Daher hatte ich ihn sicherlich an. Ich besaß damals zwei Anzüge, einen beigefarbenen Anzug von Pierre Cardin und einen koksgrauen von Dior, beide in der Ciudad de Mexico erstanden, den ersten 1983, den zweiten in derselben Stadt 1986. Der Pierre-Cardin-Anzug dürfte ein wenig in die Jahre gekommen sein, etwas abgetragen und ganz sicher unmodern hinsichtlich Schnitt und dergleichen, aber das störte mich vermutlich kaum, weshalb ich ihn gut und gern getragen haben könnte, falls er keine Flecken hatte. Ja, ich glaube schon, dass ich ihn dem Dior-Anzug vorgezogen hatte, denn der Dior-Anzug hatte einen Makel. Er war zu eng, ich hatte ihn leider zu eng gekauft. Das hatte zur Folge, dass er nicht sehr angenehm zu tragen war, und außerdem war er an den Armen zu kurz, sodass die weißen Hemdsärmel mehr zu sehen waren, als es sich schickte. Ich könnte ihn trotzdem getragen haben, denn ich trug ihn oft bei großen Anlässen, wie die Mitwirkung an einer Literaturveranstaltung auf der Frankfurter Buchmesse einer war. Aber ich glaube, ich hatte den Pierre-Cardin-Anzug dabei, so groß war die Veranstaltung nun auch wieder nicht.« Kurz zuvor hatte ich mich übrigens gefragt, ob ich einen Mantel trug, und angenommen, dass ich einen Frühlingsmantel übergezogen hatte, obwohl auch dieser nicht ohne Fehler war, die Gürtelschlaufe war abgerissen und nicht mehr angenäht worden. Desgleichen die Schuhe, es waren ziemlich ungeputzte schwarze Schuhe, hinten plattgetreten. Kurzum, ich konfrontiere die Leser mit einem reichlich schäbig aussehenden Mann. Mit teuren, aber abgetragenen und ziemlich unordentlichen Kleidern am Leib. Und ich selbst schildere mich vor zehn Jahren. Ich schreibe also über mich und wie ich vor zehn Jahren aussah. Ich, der ich bisher nie Wert darauf gelegt habe, die Kleider und das Aussehen meiner Romanfiguren zu beschreiben. Warum sollte ich es jetzt tun? Das habe ich zu beantworten versucht, wie ich sehe: »Warum ich dies jetzt tue, erschließt sich mir nicht ganz, vielleicht weil es eine besondere Begebenheit ist, dass ich in einem Roman mitwirken soll, als Hauptfigur, ich kann nicht sagen, dass ich davon geträumt habe oder mich besonders darüber freue. Aber es muss sein, es lässt sich nicht vermeiden.« Dann geschah jedoch Folgendes: Je mehr ich mich damit amüsierte, mich an diese alten Klamotten zu erinnern, und ich die Hauptfigur des Romans, also mich, darin kleidete, umso größer wurde mein Unbehagen. Dass ich mich, denselben und doch nicht denselben, von außen so detailliert beschrieb, fühlte sich mit der Zeit literarisch unerträglich an. Es wurde auch nicht besser, als ich dazu überging, Gegenstände zu beschreiben, die ich bei mir oder an mir trug, indem ich beispielsweise fragte, ob ich etwas am Handgelenk hatte, und darauf antwortete, ich trüge »eine billige Armbanduhr« am Handgelenk, um anschließend zu erzählen, dass ich eine unvorteilhafte Brille auf der Nase hatte, »eine sogenannte Hornbrille«, bevor ich mich zuletzt daran erinnerte, dass ich auch damals schon einen Bart trug. Doch jetzt reichte es mir. Jetzt war mein Unbehagen so angewachsen, dass mich allein der Gedanke daran, dass ich damals im Gegensatz zu heute einen Bart trug und ich mich wieder mit einem Bart ausstatten müsste, einem Bart, den ich mir bekanntlich irgendwann im Jahr 1991 abrasiert hatte und nie mehr wachsen ließ, mit einem Gefühl von Übelkeit erfüllte, weshalb ich mich weigerte fortzufahren, und ich löschte die Seiten, die ich bereits verfasst hatte. Es war mir schlicht und einfach unerträglich, so zu schreiben.
Fußnote 3.
Andere können das ganz anders sehen. Völlig andere Vorstellungen haben, obwohl wir uns auf dieselben Choräle und Bilder berufen. Für die Schwester meines Vaters, Tante Elise, waren die Straßen im Himmel aus Gold. Der Himmel war in meinem Elternhaus ein Gesprächsthema, z.B. sonntags beim Essen. Ich weiß noch, dass Tante Elise sagte, im Himmel seien die Straßen aus Gold. Tante Elise war halbblind, sie nahm die Umgebung nur als vage Schatten wahr, das war seit ihrer Kindheit so. Sie arbeitete nicht, blieb ein Leben lang zu Hause, zunächst bei ihren Eltern, später wohnte sie bei ihrem jüngeren unverheirateten Bruder. Sie kam im Alltag gut zurecht, bei der Hausarbeit, beim Kochen etc., mit fest einstudierten Routinen, aber sie war halbblind und konnte nichts sehen. Ich weiß noch, dass sie sagte, im Himmel seien die Straßen aus Gold. Bei einem Sonntagsessen, ich war ein kleiner Junge von sechs oder sieben Jahren und hörte, wie Tante Elise verkündete, im Himmel seien die Straßen aus purem Gold. Das klang toll, und sie wirkte stolz dabei, aber mein Vater widersprach ihr. Mit welcher Begründung er ihr widersprach, weiß ich nicht mehr, oder ich habe nicht darauf geachtet, aber er widersprach ihr, und Tante Elise war gekränkt. Sehr gekränkt, so gekränkt, dass ich mich heute noch, mehr als fünfzig Jahre später, daran erinnere. Rechthaberisch und zutiefst verletzt wiederholte sie, im Himmel seien die Straßen aus Gold. Es entspann sich eine Diskussion, an die ich keine Erinnerung mehr habe und an der ich selbst natürlich nicht beteiligt war. Vielleicht saß ich nicht einmal mit am Tisch, sondern darunter, wo ich so tat, als sei ich ein kleiner Hund, das machte ich gern, wenn es zum Essen Koteletts gab, und das war sonntags oft der Fall, dann saß ich unter dem Tisch und nagte an einem Knochen und tat so, als wäre ich ein kleiner Hund, doch sollte ich heute das Wort ergreifen, dann um Tante Elise beizuspringen. Die Straßen im Himmel sind aus purem Gold. Vieles spricht dafür, dass Tante Elise sich mehr mit dem Himmelreich und dem ewigen Leben beschäftigt hat als andere. Denn dort würde sie etwas sehen können. Hier war sie halbblind, dort würde sie sehen können. Es gibt viele Erzählungen, wonach die Straßen im Himmel aus Gold seien, sie kann in unautorisierten Kirchenliedern davon gehört haben oder in den euphorischen Predigten der Prediger über die himmlische Pracht, und sie hat die Worte in sich aufgesogen. Vor ihrem inneren Auge konnte sie den Himmel sehen. Die Straßen dort oben seien aus Gold, wusste sie zu berichten, und sie konnte nicht verstehen, wie ihr jemand in diesem Punkt widersprechen konnte.
Glaubte sie auch, sie würde dort oben mit ihrem Geliebten wiedervereint? Das kann gut sein, obwohl ich kaum glauben kann, dass von denen, die an diesem Sonntagnachmittag am Esstisch saßen und meine Familie ausmachten, jemand sein Leben unter dieser Prämisse lebte. Ich kann nämlich bei mir selbst nicht den Hauch einer solchen Vorstellung finden, und hätten sie unter dieser Prämisse gelebt, wären gewiss Fragmente davon in mich als kleines Kind eingesickert und hätten sich festgesetzt. Tante Elise war es, die am Tag, als mein Vater zum letzten Mal ins Krankenhaus von Tønsberg eingeliefert wurde, bei ihm war. Meine Mutter war bei der Arbeit gewesen, als Verkäuferin in Tønsberg, und Tante Elise war gekommen, als es meinem Vater nicht gutging. An diesem Tag fand sie, ihrem Bruder gehe es so schlecht wie nie zuvor, weshalb sie nach einem Arzt schickte, der dann einen Krankenwagen rief. Ich war nicht zu Hause, ich war nach draußen gegangen, als ich die sorgenvolle Stimmung bemerkte, und erst zurückgekommen, nachdem der Krankenwagen weggefahren war. Aber ich frage mich, ob sie sich von ihrem Bruder verabschiedet hat, der in einem Dämmerschlaf lag und kaum hören konnte, was sie sagte, sodass sie nicht befürchten musste, ihn zu ängstigen, wenn er begriff, dass sie in der Nacht mit seinem Tod rechnete, weshalb sie zum Abschied, als Trost und zur eigenen Beruhigung, gesagt haben könnte: Wir sehen uns im Himmel. Sagte sie das? Das kann ich schwerlich glauben, zumindest dass sie es laut sagte, sodass der Arzt und die Sanitäter und Frau Sørlie es hören konnten, denn das hätte bedeutet, dass sie etwas offen aussprach, was ich mir schwerlich vorstellen kann, wenn es jedoch so war, dass sie ihr Lebwohl zum Abschied laut und vernehmlich aussprach, glaubte sie dann selbst daran, im wörtlichen Sinne des Ausspruchs? Das bezweifle ich, ich kann nicht anders, ich kann unmöglich nicht daran zweifeln, dass sie selbst an das Gesagte geglaubt haben könnte. Denn wenn sie daran glaubte, sodass sie es laut und vernehmlich sagen konnte und nicht nur insgeheim flüstern, dann wäre das Leben ein anderes und auch die Gesellschaft wäre völlig anders organisiert, was wir uns schwerlich vorstellen können.