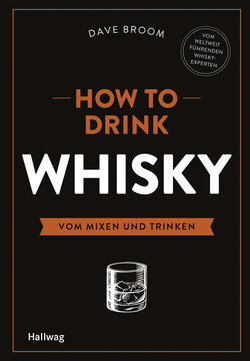Читать книгу How to Drink Whisky - Dave Broom - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
GESCHICHTE
ОглавлениеWie man Whisky am besten genießt, ist Thema dieses Buchs. In unserem geschichtlichen Abriss geht es also darum, wie Whisky im Lauf der Jahrhunderte getrunken wurde und wie er seinen Weg in den Alltag, die Herzen, Worte und Kulturen der Menschen, die ihn bereiteten und genossen, fand.
SCHOTTLAND UND IRLAND 1200-1745
Wer also war es? Wer hatte die geniale Idee, Bier in einer Brennblase zu erhitzen? Für den schottischen Autor Neil M. Gunn war es ein keltischer Schamane. Für andere ein Angehöriger des Klerus. Und für wieder andere ein Alchemist. Beginnen wir mit ihnen, den Scharlatanen, Zauberern, Quacksalbern, Wahrheitssuchern, Ur-Chemikern, Mystikern. Warum endete ihre Suche nach der Destillation, die in Persien mit den Arbeiten von Dschabir (721–815), al-Kindi (801–873) und Rhazes (865–925) begann, am Rande der keltischen Welt?
Verantwortlich dafür war unter anderem Robert von Chester, der die Texte der arabischen Alchemisten um 1144 in Segovia ins Lateinische übersetzte, aber auch der um 1175 in Schottland geborene und etwa 1235 in Italien gestorbene Michael Scotus, der in Toledo Arabisch lernte und zum Hofastrologen Friedrichs II. in Salerno aufstieg. Scotus übertrug Werke wie Rhazes’ wichtigste alchemistische Schrift Liber Luminis Luminum und hatte daher Kenntnis von der Destillation.
Obwohl vom Lebenswerk des ersten schottischen Brenners lediglich eine beiläufige Erwähnung in Dantes Inferno geblieben ist, besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass die Destillation eine keltische Erfindung ist. Richtig ist es trotzdem nicht. Der erste Hinweis auf die Destillation von Bier in Großbritannien findet sich in Chaucers Canterbury Tales (1378–1400). In der »Erzählung des Dienstmannes des Stiftsherrn« gibt der Erzähler die Geheimnisse der Alchemie preis, jener »hinfälligen … Zauberkunst«. Er berichtet von Destillierkolben und Hitze und listet etliche Zutaten auf, darunter »Weinsteinöl, Alaunglas, Hefe, Würze … «. Er destilliert Bier.
Überraschenderweise verging ein weiteres Jahrhundert, bis sich in der Literatur ein Hinweis auf die Destillation von Getreide fand. Es treten auf: Bruder John Cor, der bekannteste, wenn auch unsichtbar gebliebene Schotte der Geschichte. Sein Name erscheint nur einmal: in den schottischen Steuerverzeichnissen von Jakob IV., in denen festgehalten ist, dass der Mönch »acht Boll Malz zur Herstellung von Aqua vitae« erhielt. Wer besagter Bruder war, ist ebenso wenig bekannt wie sein Domizil, doch wissen wir zumindest, dass er aus gemälztem Getreide »Lebenswasser« erzeugte.
Alchemistisches Suchen stand am Anfang der Destillationskunst.
Es erscheint unwahrscheinlich, dass es hundert Jahre dauerte, bis die Kunst des Destillierens von Bier bis in die getreidereichen Landstriche nördlich der englisch-schottischen Grenze vorgedrungen war. Und noch unwahrscheinlicher, wenn man sich die Bedeutung der (zu Beaton anglizierten) MacBeathas vergegenwärtigt. Sie kamen um 1300 im Gefolge der aus Ulster stammenden Prinzessin Aine o’Cathain nach Islay und waren ollamhs, Gelehrte, die als Hofärzte jedem schottischen König von Robert I. (1306) bis Karl I. (1625) dienten. Ein Beaton war Leibarzt von Jakob IV.
Die Beatons orientierten sich an der kräuterbasierten, alchemistischen Medizin von Avicenna und Averroës, die als Erstes von Michael Scotus ins Lateinische und im 14. Jahrhundert von den Beatons selbst ins Gälische übersetzt wurde. Für die Beatons waren Destillate Arznei. Sie machten den Anfang. Bruder Cor war nur eine Fußnote.
Hector Boece, erster Rektor der Universität von Aberdeen, nennt in seiner Geschichte Schottlands 1527 allerdings einen anderen Verwendungszweck:
»Als meine Ahnen sich dem Frohsinn hinzugeben gedachten, verwendeten sie eine Art Aqua vite [sic] gänzlich ohne Gewürz und lediglich mit Kräutern und Wurzeln, die in ihrem Garten gediehen.«
In der »autorisierten Version« der Whiskygeschichte heißt es, dass Whisky zunächst eine Arznei gewesen sei und es Jahrhunderte gedauert habe, bis man es als Getränk genutzt habe. Aber Boeces Chronik beweist das Gegenteil. In ihr beschreibt er eindeutig ein Lebenswasser, das dem Genuss diente und nach überliefertem Verfahren hergestellt wurde. Seine Altvorderen tranken es um des Genusses willen – vermutlich zur selben Zeit, als Klosterbruder Cor seine acht Boll Malz verarbeitete.
Boece und seine Vorväter destillierten wohl kaum teuren Importwein, wenn Bier vor Ort verfügbar war. Sie versuchten, die Kosten gering zu halten, indem sie keine Kräuter aus fremden Ländern verwendeten. Stattdessen öffneten sie einfach das Fenster zu ihrem Garten und ließen sich von dessen Düften inspirieren.
BOECES AQUA VITAE
Ich beschloss, eine moderne Hommage an Boeces Trunk zu brauen. Obwohl der Gelehrte die Ingredienzen nicht aufgeführt hatte, erbrachten Abhandlungen über mittelalterliche schottische Gärten eindeutige Indizien. Bartender Ryan Chetiyawardana und ich versuchten mithilfe eines Rotationsverdampfers einige Kräuteressenzen zu gewinnen. Das Ergebnis war nicht gerade ein Triumph. Unverdrossen setzten wir ein Kräuterrepertoire – Majoran, Basilikum, Lavendel, Salbei und Rosmarin – in New Make an und kochten das Ganze in einem Vakuumgargerät (ich weiß, beide Methoden kannte Boece nicht, aber es ging nicht anders). Das Ergebnis war ein duftendes, hellgrünes Getränk mit den entsprechenden Kräuternoten, das nur noch mit Heidehonig verfeinert werden musste.
Der von Boece angedeutete Kräutermix bestand vermutlich aus Ysop, Majoran, Lavendel, Sandthymian, Rosmarin, Vogelbeere und Heidekraut oder Heidehonig. Sein Aqua vitae ist also eine durch und durch lokale, vom Duft heimischer Blüten durchdrungene Spezialität und fest mit der schottischen Landschaft verwurzelt.
Allerdings waren es die Iren, die für diese Art von Whisky Berühmtheit erlangten. Reiseschriftsteller Fynes Moryson notiert dazu:
»Usquebaugh … [ist] unserem eigenen [englischen] Aqua vitae vorzuziehen, weil Weintrauben, Fenchelsamen und anderes hineingemischt wurde, was das Brennen milderte und den Geschmack angenehm machte … «
Moryson war der Erste einer Gruppe von Autoren, die den Weg des Whiskys nachzeichneten. Sein vierbändiges Werk Itinerary, erschienen 1617, ist der Bericht einer zehnjährigen Wanderschaft durch Europa, in deren Verlauf er in Irland zum ersten Mal mit dem neuen alkoholischen Getränk Bekanntschaft machte.
Sein Name ist fast so faszinierend wie der Trunk selbst. Aus Aqua vitae wurde in gälischer Übersetzung usquebaugh (eigentlich uisge beatha), was man später zu usky beziehungsweise whisky verballhornte. In Wirklichkeit sind Usquebaugh und Whisky zwei verschiedene Getränke: Das erste ist gewürzt, das zweite stammt direkt aus der Brennblase und ist klar und scharf.
Moryson unternahm seine Reisen während des Neunjährigen Kriegs, durch den Jakob I. die Kontrolle über Ulster gewann und dortige Machtpositionen mit Vasallen besetzte. Einer war Sir Thomas Phillips, der 1608 das Exklusivrecht zugesprochen bekam, in »o’Cahanes County« – benannt nach den Ahnen von Aine o’Cathain – eine Destillerie zu betreiben.
Übersehen wird heute, wofür Sir Thomas die Genehmigung bekam: nämlich für die Erzeugung von »acquavitae [sic], usquabagh [sic] und aqua composita«. Mit anderen Worten: Er durfte Whisky pur, Whisky, der mit aromatisierenden Stoffen noch einmal destilliert wurde, und Whisky, in den aromatisierende Ingredienzen eingelegt wurden, herstellen. Drei Stile also, nicht nur einen.
In den nächsten drei Jahrhunderten avancierte Usquebaugh zu einem begehrten, komplexen Getränk, dessen Herstellung in Destillationsanleitungen beschrieben wurde, wie die Beispiele links offenbaren. Erwähnenswert sind sie vor allem, weil eine Ingredienz dabei ist, die zum prägenden Bestandteil wurde: Safran.
Ein Getränk, für das man Safran brauchte, war nicht für das Bauernvolk gedacht, so viel steht fest. Meg Dods’ »irischer Likör Usquebaugh« (links unten) enthält jedoch einen spöttischen Hinweis darauf, was sich als Ersatz für den teuren Färberstoff anbot.
Kein Hinweis auf geschmackliche Einfärbungen enthalten dagegen Aufzeichnungen eines weiteren Reisenden namens Martin Martin, der 1703 von seinen Exkursionen auf die westlichen Inseln Schottlands berichtete. Dafür finden sich in seiner Beschreibung der Whiskys auf Lewis interessante Bezeichnungen: usquebaugh, dreifach destilliertes trestarig und vierfach destilliertes usquebaugh-baul. Während andere Teile Schottlands sich an Boece und ihren irischen Pendants orientierten, hatten die Inselbewohner ihren eigenen Kopf. Martin fand auch heraus, wie Whisky getrunken wurde:
»Sie nennen es streah, Runde, denn die Gesellschaft saß im Kreis. Der Mundschenk füllte ihre Becher, die alle geleert wurden, gleich, welcher Art der Trunk war, ob stark oder schwach. Man trank mitunter 24, ja, 48 Stunden ohne Unterlass …«
Man kann das als Besäufnis sehen oder als demokratisches Beisammensein mit dem Ziel, engere Bindungen zu schaffen. Damit war Whisky nicht mehr länger Alkohol, sondern ist Teil der Kultur einer Nation geworden. Lange war er von der Geruchs- und Geschmackswelt der schottischen Hügel beseelt, doch nun ist er fest in der Gemeinschaft verankert. Was nicht heißt, dass er nicht weiter mit Begeisterung getrunken wird.
»Manche Herren der Highlands genießen Whisky im Unmaße, trinken drei oder vier Quart bei einer einzigen Zusammenkunft … «
Das schrieb Captain Edmund Burt nieder, als er 1726 durch Schottland reiste und dabei seine Zitronen auspresste, um seinen Gastgebern Punsch zu bescheren. Er entdeckte, dass Whisky aus verzierten Muschelschalen getrunken wurde. Mit einer gewissen Erleichterung muss er festgestellt haben, dass Punsch in den Highlands des 18. Jahrhunderts als Getränk zumindest existierte, wenngleich der Zitronensaft fehlte:
»[Man] mischte ihn mit Wasser und Honig, Milch und Honig oder aus Aqua vitae, Zucker und Butter, eine Mischung, die sie flambieren, bis Butter und Zucker aufgelöst sind.«
Die von Captain Burt genannten Trinkmengen deuten darauf hin, dass ein Verdünnen an der Tagesordnung war. Dr. Johnson schrieb einige Jahrzehnte später:
»Ein Mann der Hebriden nimmt, kaum da er des Morgens erschienen ist, ein Glas Whisky zu sich … sie sind kein Volk von Trinkern … gleichwohl ist kein Mann so enthaltsam, dass er dem frühen Schluck entsagen würde, den man gemeinhin skalk nennt [von Gälisch sgailc, Schlag auf den Kopf].«
Whisky wird inzwischen vor Anbruch der Dämmerung und vor dem Einschlafen am Abend genossen. Man reicht ihn in Quaichs (Trinkschalen) aus Holz oder Horn oder in Muschelschalen bei Feiern herum. Das Trinken ist zum Ritual geworden – Sakrament, Zahlungsmittel und Eckpfeiler der Gastfreundschaft zugleich.
ZWEI USQUEBAUGHS
ROYAL USQUEBAUGH (The Complete Distiller, A. Cooper, 1757)
»Man nehme jeweils drei Unzen Zimt, Ingwer und Koriandersamen, viereinhalb Unzen Muskatnuss sowie jeweils eineinhalb Unzen Mazis, Gewürznelken und Kubebenpfeffer, zerstampfe alles, gebe es mit elf Gallonen fünfzigprozentigem Weingeist und zwei Gallonen Wasser in einen Alambic und destilliere es, bis der Nachlauf zu steigen beginnt, wobei viereinhalb Unzen englischer Safran in einem Tuch an das Ende der Kühlschlange gebunden werden. Nunmehr nehme man viereinhalb Pfund Rosinen, drei Pfund Datteln, zwei Pfund geschnittene Süßholzwurzel, lege sie zwölf Stunden lang in zwei Gallonen Wasser ein, seihe die Flüssigkeit ab, gebe sie zu jener hinzu, die durch die Destillation gewonnen wurde, und süße das Ganze mit Zucker. (Ergibt zehn Gallonen.)«
USQUEBAUGH, DER IRISCHE LIKÖR (The Cook and Housewife’s Manual, Meg Dods, 1829)
»Auf zwei Quart Whisky ohne rauchigen Geschmack gebe man ein Pfund Rosinen, eine halbe Unze Muskatnuss, eine Viertelunze Gewürznelken und dieselbe Menge Kardamom und zerstoße alles im Mörser. Nun nehme man die Schale einer Pomeranze, reibe sie auf mehrere Zuckerstücke und ein halbes Pfund braunen Kandiszucker. Man schüttle den Aufguss vierzehn Tage lang täglich und seihe ihn danach ab. Hinweis: In irischen Likör sollte kein Tropfen Wasser kommen. Mitunter wird er mit Spinatsaft [anstatt Safran] zartgrün eingefärbt.«
Im 18. Jahrhundert ist das Whiskytrinken bereits zum gesellschaftlichen Ritual geworden.
SCHOTTLAND UND IRLAND 1745-1850
Und doch waren die ländlichen Rituale in Gefahr. Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts verlagerte sich die Whiskyproduktion in Schottland und Irland von kleinhandwerklicher Erzeugung hin zu gewerblicher Destillation. Es folgte eine Schwemme von Gesetzen, mit denen der Staat – letztlich erfolglos – versuchte, den übermäßigen Verbrauch einzudämmen und gleichzeitig die Steuereinnahmen zu maximieren.
Ende des 18. Jahrhunderts ging es den Brennern in den Lowlands – viele waren Mitglieder der miteinander verbundenen Haigs and Steins – ganz prächtig. Sie richteten ihr Augenmerk auf den Export minderwertiger Spirituosen nach London, wo sie zu Gin verarbeitet wurden.
1786 allerdings sahen sich die Brennereien in den Lowlands gezwungen, mit ihren Verkaufspreisen bis unter die Herstellungskosten zu gehen, was natürlich für viele das Aus bedeutete. Hinzu kam, dass sich die Besteuerung nach dem Fassungsvermögen der Brennblasen richtete. Das versuchte man zu umgehen, indem man tellerartige Stills mit hohen, schlanken Hälsen konstruierte, die alle zwei bis drei Minuten geleert werden konnten. Dass dabei ein widerliches Gebräu entstand, war nebensächlich, solange es zum Rohstoff für Gin taugte. Als jedoch der Exportmarkt zusammenbrach, blieb als einzige Alternative, die illegalen Kaschemmen in den Lowlands damit zu überschwemmen.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden in Schottland und Irland große Whiskyfabriken.
1788 schrieb Robert Burns: »Der Whisky [der Lowlands] ist eine fast schurkische Flüssigkeit und wird folglich nur von den schurkischsten Einwohnern getrunken.« Burns stufte die Lowlands und Highlands (und die Inseln) zu Recht als unterschiedliche Länder ein. 1784 trennten die Steuerbehörden Schottland in zwei Teile mit jeweils eigener Besteuerung. Nördlich der Highland Line versuchte man einem System, das die Domäne von Bauern war, mehr schlecht als recht eine industrielle Fertigung aufzuzwingen. Hatten Farmer bis dato ihre eigene Ernte für die Whiskyerzeugung in eigenen Brennblasen verwendet, so wurde dem nun ein Riegel vorgeschoben.
Obwohl der Highland-Whisky von besserer Qualität war als der aus den Stein’schen Tellern und stärker nachgefragt wurde, verbot man den Export in den Süden. Darauf gab es nur eine Antwort: Die Brenner gingen in den Untergrund. Landbesitzer verschlossen ihre Augen vor den Aktivitäten der Pächter, um sie auf ihrem Land zu halten. Glen Livet, Kintyre und Islay – alle entlegen und schwer zu kontrollieren, aber mit guten Verkehrsverbindungen zu den Lowland-Märkten – wurden zu Hochburgen der Schwarzbrenner.
Ähnlich die Lage in Irland. 1779 gab es 1228 angemeldete Brennereien, aber in dem Jahr, da die Regierung die Besteuerung von Brennblasen nach Kapazität einführte, verschwanden 982 von heute auf morgen von der Bildfläche. Die übrigen »offiziellen« Häuser erzeugten ein ungenießbares Gesöff und befeuerten damit die Nachfrage nach Schwarzgebranntem noch.
1823 änderte sich in beiden Ländern die Lage, nachdem man sich darauf geeinigt hatte, dass die Landbesitzer künftig gesetzestreuer brennen würden, wenn eine angemessenere Besteuerung eingeführt würde. Die Highland Line wurde abgeschafft und die Besteuerung halbiert. Wer ausschließlich gemälztes Getreide verwendete, bekam eine Rückvergütung, die Brennblasen mussten ein Fassungsvermögen von mindestens 40 Gallonen, umgerechnet 180 Liter, haben, die Lagerung war steuerfrei und der Export erlaubt. Das führte dazu, dass vermehrt Kapital in die Brennereien floss. Whisky war ein Geschäft geworden. Während die Spirituose zum Lieblingsgetränk der urbanen Unterschicht avancierte, bekam Highland Whisky ein Upper-Class-Flair. Nichts macht dies deutlicher als die Forderung Georgs IV. während seines Besuchs in Irland 1821 und Schottland im Jahr darauf. In Dublin erklärte er:
»Ich versichere Euch, meine lieben Freunde, dass ich ein irisches Herz habe. In dieser Nacht werde ich Euch meine Zuneigung beweisen … indem ich mit einem vollen Glas Whisky-Punsch auf eure Gesundheit trinke.«
(Man beachte: nicht mit Whisky pur.)
Als der König in Edinburgh weilte und wieder ein Glas Whisky verlangte, schickte man nach einer Flasche Glenlivet (der damals noch nicht legal gebrannt wurde). Die verdrießliche Elizabeth Grant kam diesem Wunsch äußerst widerwillig nach. Sie schrieb:
»Auf Geheiß meines Vaters … plünderte ich meinen Lieblingsposten, der aus lange in Holz und unverkorkten Flaschen gereiften, milchmilden Whiskys mit echtem Schmugglergeschmack bestand.«
Was immer die wahren Beweggründe für Georges Forderung gewesen sein mögen, der Whisky Toddy wurde zum Getränk des Gentleman. 1864 notierte Charles Tovey in British and Foreign Spirits:
»Man findet den Toddy als Digestif auf den Tafeln der Aristokratie, wo sich sein Aroma mit dem Bukett von Lafitte [sic] oder Romanee Conti vermischt. Es hat sich eingebürgert, nach dem Essen Whisky, heißes Wasser und Zucker aufzutragen, die jeder nach eigenem Gutdünken mischt.«
WHISKY-PUNSCH
DER HOT WHISKY-PUNSCH DES SCHÄFERS VON ETTRICK
(Noctes Ambrosianae Teil drei, 1828–1830)
Noctes Ambrosianae ist eine Sammlung fiktiver Gespräche, die zu Anfang des 19. Jahrhunderts von Professor John Wilson mithilfe weiterer Persönlichkeiten aus Edinburgh wie dem Dichter James Hogg alias »Schäfer von Ettrick« verfasst wurden. Diskutiert wird darin über den Lauf der Dinge und die Merkwürdigkeiten des Lebens.
Die Anleitungen für die Zubereitung von Whisky-Punsch finden sich in einer Fußnote zu jener Passage, in denen Hogg eigentlich einen Toddy mixt: »Ich mache Toddy inzwischen, ohne auch nur im Geringsten darüber nachzudenken. Während unseres törichten Gesprächs rührte ich die Flüssigkeit und ließ ein paar Stücke Zucker hineinfallen.« In der Fußnote heißt es: »Das Geheimnis der Zubereitung von Whisky-Punsch erschließt sich mit zunehmender Übung. Der Zucker sollte zunächst in etwas Wasser aufgelöst werden, das, um mit den Iren zu sprechen, brüllend heiß sein muss. Als Nächstes gibt man den Whisky dazu, dann etwas Zitronenschale und zuletzt das restliche Wasser, sodass das Alkoholische noch ein Drittel ausmacht. Nun heißt es: trinken! Zitronensaft hingegen ist gesundheitsschädlich und sollte nicht hinzugefügt werden.«
Auf die Gründe für die kaledonische Aversion gegen Zitronensaft wird im Cocktail-Kapitel eingegangen (>->).
HIGHLAND BITTERS
BITTERS: EIN VORZÜGLICHES TONIKUM
(The Cook and Housewife’s Manual, Meg Dods, 1829)
»Man nehme zwei Unzen Wacholderbeeren, eineinhalb Unzen Enzianwurzel oder eine viertel Unze Koriandersamen, eine viertel Unze Calamus aromaticus, ein Dram Schlankenwurzel und ein halbes Dram Kardamomsamen. Man schneide die Enzianwurzel in kleine Stücke, zerstampfe die übrigen Ingredienzen in einem Mörser und gebe das Ganze zusammen mit fünf Flaschen des besten Malt-Whiskys mit einer Stärke von 42 Prozent Alkohol in eine große Flasche oder einen Krug. Man schüttle die Flasche direkt nach dem Hineingeben der Ingredienzen eine Weile, später jedoch nicht mehr, lasse alles zwölf Tage lang sorgfältig verschlossen stehen, seihe es danach ab und fülle es gebrauchsfertig in Flaschen.«
Eine geringfügig veränderte und daher nicht mehr ganz so haarsträubend bittere Version findet sich im Cocktail-Kapitel (>).
Whisky-Punsch, auch warm serviert – wir sind schließlich in Schottland! – wurde nach wie vor getrunken. Dem Mangel an Zitronen wiederum begegnete man mit schottischem Erfindungsreichtum. 1772 berichtete ein Reiseschriftsteller namens Thomas Pennant, dass der Geschmack mit Vogelbeeren aufgepeppt wurde:
»Die Menschen auf den Hebriden gewinnen aus den Beeren der Eberesche eine saure Zutat für Punsch.«
Der Dritte und Letzte im schottischen Whisky-Bunde ist der Bitter. Er wurde erstmals 1808 in Jamiesons Wörterbuch der schottischen Sprache als »in den Highlands viel verwendeter Magenbitter aus Whisky und aromatischen Kräutern« definiert.
Dass Whisky nicht nur pur getrunken wurde, beweist auch Meg Dods The Cook and Housewife’s Manual, ein Koch- und Haushaltsbuch. Es liefert die Rezepte für Scotch Noyau (mit Mandeln), Cherry Whisky, Usquebaugh, Norfolk Punch, Bitter sowie Scotch Het-Pint (Whisky, heißes Bier, Zucker und geschlagene Eier werden »rasch von einem Gefäß in das andere gegossen, bis alles cremig und hell ist«, und schließlich in einen heißen Kupferkessel gegeben).
Warum aber gelangte Whisky in seiner Heimat zu so hohem Ansehen? Der »Schmugglergeschmack« hatte etwas Faszinierendes. Tovey schreibt:
»Bis zum Verbot des Whiskybrennens in den Highlands wurde er nie an den Tafeln der hohen Stände getrunken.«
Gleichzeitig hatte die Spirituose Einzug in den Kulturschatz der Nation gefunden. Im Ossian-Epos erfand James Macpherson um 1760 durch Zusammenfügen und Sentimentalisieren von Mythen ein altes Schottland. Der Erfolg der Saga offenbarte eine Leerstelle in der schottischen Psyche und die Sehnsucht, eine verlorene Vergangenheit – oder ein Palimpsest davon – wiederzuentdecken. Whisky war eine flüssige Metapher dieses romantischen Schottlandbildes. Wer ihn trank, nahm den Mythos in sich auf.
Ein Kernpunkt in den Schriften von Fergusson, Burns, Hogg und Scott war die Debatte darüber, was es hieß, Schotte zu sein. Whisky wurde Bestandteil dieser Auseinandersetzung.
Solche philosophischen Überlegungen indes fochten die neuen, legalen Brenner nicht an. Sie wollten ihren Whisky an den Mann bringen. Nach 1823 traten etliche neue Destillerien auf den Plan, doch obwohl der Inlandsverbrauch ebenso stieg wie die Exportmenge, wurden die Kapazitäten nie voll ausgeschöpft.
Nachteilig auf die Whiskyproduktion in den Highlands wirkten sich die um 1830 einsetzende Wirtschaftskrise und die Clearances aus, die Vertreibung der Kleinbauern. Die Lowlands hingegen produzierten wegen der verbreiteten Einführung von Patent bzw. Continuous Stills (>) Überkapazitäten. Scotch war einfach nicht beliebt genug.
Schotten und Engländer tranken lieber Whiskey aus Irland, wo die großen Brennereien die durch das Gesetz von 1823 eröffneten Möglichkeiten genutzt hatten. 1826 hatte die Pot Still von Midleton ein Fassungsvermögen von 31 500 Gallonen – mehr als 140 000 Liter – und auch in Dublin tätigten John und William Jameson, George Roe und John Power Investitionen zur Produktionssteigerung. Um 1850 wurde deutlich: Scotch befand sich am Scheideweg. Entweder er arbeitete an seinem Geschmack oder er ging unter.
Als Georg IV. Dublin einen Besuch abstattete, verlangte er nach einem Whisky-Punsch.
AMERIKA UND KANADA 1700-1920
Warum stellten die Bauern im 18. Jahrhundert überhaupt Destillate her? In erster Linie, weil der Brand gut schmeckte, Geld einbrachte – oder sogar Zahlungsmittel war – und sich als Bestandteil der Kultur etabliert hatte. Man verwendete Getreide aus eigenem Anbau. Sowohl in Schottland als auch in Irland war das nicht nur Gerste, sondern auch Weizen, Hafer und Roggen.
In einer ähnlichen Lage waren die Farmer im 18. Jahrhundert in Nordamerika. Sie hatten Deutschland, den Niederlanden, Ulster, Schottland, Irland und England aus verschiedenen Gründen – einer war Hunger – den Rücken gekehrt und wollten nun eine neue Heimat finden, nicht nur eine physische, sondern auch eine kulturelle.
Die Auswanderer waren ein anpassungsfähiger Menschenschlag. Wären sie aus der Karibik gekommen, hätten sie Rum gebrannt – was die Schotten an Kanadas Ostküste auch taten. Die Deutschen und Holländer am Monongahela River in Pennsylvania pflanzten Roggen, um daraus Brot und Spirituosen zu machen. Letztere wurden gleich so berühmt, dass der Fluss sogar Amerikas erstem Whiskey-Stil seinen Namen gab.
Den Brennern ging es gut. So gut, dass Alexander Hamilton 1791 eine Steuer auf Hochprozentiges einführte, um die Schulden seines noch jungen Landes abzubezahlen. Der anschließende Aufstand der Brenner um Pittsburgh konnte erst durch den Einsatz einer 15 000 Mann starken Armee niedergeschlagen werden.
Einige der Destillierer hatten sich da bereits nach Kentucky davongemacht, wo sich schottische und irische Farmer ansiedelten. Sie brannten eine andere Art von Whiskey. Nicht Roggen, sondern Mais war ihre Feldfrucht. Schwarzgebranntes wurde ab Hof verkauft, als Tauschobjekt genutzt und in jenen Kneipen hinuntergespült, in denen, wie wir bereits wissen, Gemeinschaften zusammenwachsen.
Das Geschäft lief gut, sodass Whiskey irgendwann in Fässern über die Dorfgrenzen hinausgelangte. Nach dem Kauf von Louisiana im Jahr 1801 transportierte man ihn den Ohio und Mississippi hinunter nach New Orleans. Mitunter war er von der Destillation bis zur Ankunft beim Verbraucher neun Monate unterwegs, wie der Autor Gaz Regan herausstreicht. In dieser Zeit hatte er genügend Muße, Farbe zu bekommen und seine schärfsten Kanten abzuschleifen. So wie der Monongahela einem Stil seinen Namen gab, so wurde dieser neue Whiskey nach Bourbon County benannt, das sich damals über einen Großteil von Nord-Kentucky erstreckte.
Ein weiterer Reiseschriftsteller, Charles Janson, war 1807 überhaupt nicht einverstanden mit der Art und Weise, wie die Einheimischen in Virginia, North und South Carolina sowie Georgia in den Tag starteten:
»Der Europäer nimmt erstaunt zur Kenntnis, dass es den Amerikaner morgens als Erstes nach einem feurigen Brand namens Sling dürstet, den er mit Zucker, Minze oder anderen scharfen Kräutern würzt.«
Janson hatte eindeutig seinen Johnson nicht gelesen.
Schon um 11 Uhr hatte er erneut Grund, die Nase zu rümpfen. Der Trinker, so musste er feststellen, genehmigte sich den nächsten Sling in einer Bar. Am Abend wiederum war der zeitgenössischen American Encyclopedia zufolge ein »seltsam mit Äpfeln gewürzter Whiskey« als Essensbegleiter üblich.
Dieser gesüßte, mit Minzeblättern garnierte Energydrink ist als Julep bekannt. Er gelangte wohl mit französischen Siedlern in die Südstaaten und basierte ursprünglich auf Weinbrand. Whiskey kam erst dazu, als diese Spirituose allgegenwärtig wurde und im Preis sank.
Für Schotten war Julep alias Sling ein kalter Whisky Toddy mit Minze. Als man in Amerika Bitter hinzuzufügen begann, wurde daraus der Bittered Sling oder, wie die Wochenzeitschrift Balance and Columbian Repository am 6. Mai 1806 darlegte, ein Cocktail (wenngleich diese Passage nicht, wie gemeinhin angenommen, die erste schriftliche Erwähnung des Cocktails ist).
Als sich Charles Dickens und Washington Irving 1842 bis weit in die Nacht hinein bei »einem enormen Julep« unterhielten, war Whiskey nicht nur eine feste Größe geworden, sondern hatte sich auch qualitativ gebessert.
Zu verdanken war das dem jungen Schotten James Crow, der 1824 bei der Oscar Pepper Distillery einstieg. Er ging die Destillation mit forensischer Detailliebe an und führte Sauermaische, Hydrometer und Trennpunkte, kurzum: moderne Qualitätskontrolle ein.
Im gleichen Jahr errichtete Thomas Molson in Kanada neben seiner Familienbrauerei in Montreal eine nur für die Destillation gedachte Brennerei und läutete damit das Ende der kleinbäuerlichen Whiskyproduktion ein. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts legten Müller meist englischer Abstammung den Grundstein der kanadischen Whiskyindustrie. Sie verwendeten gelegentlich Gerste, in erster Linie aber Weizen mit etwas Roggen.
Damit konnten sich die kanadischen Whiskytrinker nicht anfreunden. Dem Whiskyhistoriker Davin de Kergommeaux zufolge genossen sie gefärbte, nicht ausgebaute Versionen aus einem einzigen Durchlauf, der anschließend verdünnt und ab den 1820er-Jahren durch Filterkohle geschickt wurde.
Die Filtration ist ein weiterer Faktor, durch den sich Nordamerikas Whiskeys von anderen unterscheiden (>). Sie war von entscheidender Bedeutung für die Erzeugnisse einer halb vergessenen Gruppe auf dem Kontinent: der Rectifier. Diese Broker und Händler kauften frische Brände und machten daraus Blends, die sie dann unter eigenem Namen verkauften. Unter ihnen waren viele ehrbare Geister, die zur Entstehung der ersten Whiskeymarken beitrugen. Nicht alle aber hatten lautere Absichten. Während die einen den Basisbrand mitunter neu destillierten, filterten, verschnitten und das Endprodukt färbten, schütteten die anderen lediglich mehrere Ingredienzen zweifelhafter Qualität zusammen.
Schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts genoss man in Amerika Whiskey-Cocktails.
Der Bürgerkrieg (1860–1865) hatte für die kleineren Brenner in den Südstaaten verheerende Folgen. Nach dem Krieg wurde das Destillieren eine Spezialdisziplin. Als Kernland kristallisierte sich Kentucky heraus, das die Kriegswirren etwas besser überstanden hatte als die Nachbarstaaten, in erster Linie, weil es anfangs neutral geblieben war. Aus den Umwerfungen ging die Industrie verändert hervor. Manche alten Hasen wie Pepper, Beam und Dant überlebten, doch traten auch Neueinsteiger wie Brown-Forman, Taylor und (in Tennessee) Jack Daniel auf den Plan. Der Ausbau in Fässern setzte sich durch, obwohl Rectifier nach wie vor kratzigen, gefärbten Fusel auf die Waggons luden, die ab 1869 den Kontinent durchquerten.
Das hieß nicht, dass ganz Amerika plötzlich nur noch Bourbon und Rye der Premiumklasse trank: Ende des Jahrhunderts stammten immer noch 75 Prozent des konsumierten Whiskeys von Rectifiern. Außerdem hatten inzwischen die Kanadier im Sektor Fuß gefasst und die Unterversorgung während des Bürgerkriegs für eine Ankurbelung der Exporte genutzt. Tatsächlich erwies sich der Konflikt für die kanadische Whiskyindustrie als Segen: Erst 2010 wurde in den Staaten wieder mehr einheimischer Whiskey verkauft als kanadischer.
Zu den (honorigen) Rectifiern gehörte Hiram Walker in Detroit, der 1858 eine Mühle/Brennerei im kanadischen Windsor erwarb. Allerdings traten auch neue heimische, oft Weizenmühlen angegliederte Destillerien auf den Plan, etwa 1859 die von Henry Corby im späteren Corbyville. Schon im Jahr davor hatte in Prescott J. P. Wiser den Betrieb aufgenommen. Und 1878 kaufte ein junger Mann namens Joseph Seagram die Brennerei Hespeler & Randall in Waterloo, Ontario.
Sinkende Preise für Mais und Importe aus den Staaten veranlassten die kanadischen Brenner, auf einen anderen Whiskystil umzusteigen. Sie begannen ihren Weizen-, Roggen- und Maisbrand zu einem komplexeren, beständigeren Produkt zu verschneiden. Ende der 1880er-Jahre bewiesen Hochkaräter wie Hiram Walkers Canadian Club sowie der sherryartige Seagram 83, zu welcher Blending-Meisterschaft es die Kanadier gebracht hatten. In den Bars standen sie neben amerikanischen Marken wie Old Crow, Old Taylor und Old Forester (dem ersten abgefüllten Bourbon).
Whiskey wurde immer populärer. Man konnte ihn in Bordellen und Spelunken finden oder ihn in mehr oder weniger zweifelhaften Saloons antreffen. Welche Art von Whiskey man bekam, hing vom Etablissement ab. Während man in einer Schwemme schon gehörigen Mut haben musste, um einen Cocktail zu verlangen, bekam man ihn in feineren Lokalen, Clubs und Hotelbars problemlos.
In seinem 1865 erschienenen Bartenders Guide führte Jerry Thomas 22 Mixgetränke auf Whiskeybasis auf. Zur gleichen Zeit nannte Harry Johnson den Whiskey-Cocktail »zweifellos eines der beliebtesten amerikanischen Getränke« – ein klarer Beleg für den Beginn des goldenen Whiskeyzeitalters. Noch mehr Auftrieb bekam die Spirituose, als die Reblaus dafür sorgte, dass Weinbrände aus dem Arsenal des Barkeepers verschwanden. Ihren Höhepunkt erreichte die Whiskeyära mit dem amerikanischen Cocktail schlechthin, dem Manhattan.
Man sollte sich nicht von der Vielzahl der Rezepte blenden lassen und daraus schließen, dass alle wie wild experimentierten, denn selbst während dieser Blütezeit blieben der Sour, der Old-Fashioned, der Julep und der Manhattan die beliebtesten Whiskey-Cocktails – alles simple Kompositionen. Überhaupt wurden die meisten Whiskeys pur oder mit etwas Wasser getrunken. Bourbon, Rye und Canadian hatten ihre Legitimation, aber nach wie vor dominierten die Erzeugnisse der Rectifier.
Dennoch war nicht alles eitel Sonnenschein. Obwohl der Konsum von Hochprozentigem ab Mitte des 19. Jahrhunderts beständig zurückging, stieg der Ruf nach einer weiteren Eindämmung. Zur Jahrhundertwende war daraus die unverhohlene Forderung nach einem Verbot geworden. 1915 lagen bereits 20 US-Bundesstaaten trocken, darunter Kentucky und Tennessee. Am 17. Januar 1920 um null Uhr trat der 18. Zusatzartikel zur Verfassung in Kraft: Das »ehrenhafte Experiment«, wie die Prohibition auch genannt wurde, hatte begonnen.
WIE MAN OHNE DESTILLATION WHISKEY ERZEUGT
WER BRAUCHT BRENNBLASEN?
(The Manufacture of Liquors, Wines and Cordials Without the Aid of Distillation, Pierre Lacour, 1853)
Lacour stammte aus Bordeaux, lebte aber in New Orleans und war, nach dem Ton seines Werks zu urteilen, ein eifriger Verfechter der Herstellung gesundheitsfördernder alkoholischer Getränke ohne lästige Getreidemischungen und Reifephasen.
»Irish Whiskey: vier Gallonen Neutralalkohol, drei Pfund Raffinadezucker in vier Quart Wasser, vier Tropfen Kreosot, das Ganze mit vier Unzen karamellisiertem Zucker färben.
Scotch Whiskey [sic]: vier Gallonen Neutralalkohol, eine Gallone alkoholische Stärkelösung, fünf Tropfen Kreosot, vier Weingläser Cochenilletinktur, eine viertel Pinte Zuckerkulör.
Old Bourbon Whiskey: vier Gallonen Neutralalkohol, drei Pfund Raffinadezucker, in drei Quart Wasser gelöst, eine Pinte Schwarztee, drei Tropfen Wintergrünöl in einer Unze Alkohol, zwei Unzen Cochenilletinktur, drei Unzen karamellisierter Zucker.
Monongahela Whiskey: vier Gallonen Neutralalkohol, drei Pinten Honig, in einer Gallone Wasser gelöst, eine Gallone alkoholische Stärkelösung, eine halbe Gallone Rum, eine halbe Unze Ethylnitrat, nach Belieben färben.«
SCHOTTLAND UND IRLAND 1850-1920
Mit dem Aufkommen des »kapitalistischen« Grain Whisky veränderte sich die Scotch-Industrie schlagartig. Lowland-Brennereien sahen sich gezwungen, mehr Whisky zu geringeren Kosten herzustellen – und konnten mit der von Stein 1827 entwickelten und von Coffey 1834 verbesserten Still (>) ihre Träume schließlich sogar erfüllen. Ihre Whiskys waren wegen der großen Bandbreite eingesetzter Getreidesorten – gemälzte und ungemälzte Gerste, Weizen, Hafer und Roggen – schon immer anders gewesen. Mit dem neuen »Grain« nutzte man diese Rohmaterialbasis nun, um einen leichteren Brand zu bereiten.
Obwohl Scotch nach wie vor um Anerkennung in allen Schichten kämpfte, erlaubte ein neues Gesetz ab 1853 das Blenden von Malt Whiskys unter Zollverschluss, also in Lagern vor der Zahlung der Steuern, was den Destillierern die Produktion größerer Mengen und konstanterer Qualität ermöglichte. Fast von heute auf morgen erschienen Vatted Malts wie Ushers OVG (Old Vatted Glenlivet), ein Gemenge aus Malts unterschiedlicher Brennereien in Strathspey, wie Speyside im 19. Jahrhundert noch hieß. Die größte Veränderung brachte sieben Jahre später die Zulassung des Vatting von Grain und Malt unter Zollverschluss mit sich: Das Verschneiden in großem Stil war fortan wirtschaftlich tragfähig. 1860 schlug somit die Geburtsstunde der Scotch-Industrie, wie wir sie heute kennen.
Mit den geänderten Bedingungen erschien eine neue Kaste von Whiskymachern auf der Bildfläche: die Blender. Unbekannt war deren Metier aber nicht: ED&F hatte bereits 1784 Rum für die britische Navy verschnitten und schottische Marken wie Mortons OVD (Old Vatted Demerara) gab es schon zwanzig Jahre vor Ushers OVG.
Trotzdem mussten Schottlands Blender noch von den Erfahrungen der Konkurrenz lernen. Im Jahr 1860 schrieb Charles Tovey:
»Whisky wird [in England] im Allgemeinen recht bald nach dem Brennen in Umlauf gebracht. Was bei Brandy oder Rum gang und gäbe ist, sollte auch bei Whisky möglich sein.«
Vorausschauende Brenner und Händler hatten zwar Whisky schon vorher gelagert, doch von nun an musste das gängige Praxis werden.
Zum Glück tranken die Schotten reichlich gespritete Weine und Rum, sodass in den Häfen viele leere Fässer herumlagen. Sie konnten von Whiskybrokern wie den Herren Robertson & Baxter, deren Labor in Glasgow zur Blending-Schule für viele Whiskypersönlichkeiten wurde, sowie WP Lowrie, dem Pionier der Sherryfassreifung und der Qualitätskontrolle von Holz, nutzbringend eingesetzt werden.
Nicht minder wichtig aber waren die Lebensmittelhändler. Männer wie die Chivas-Brüder in Aberdeen, John Walker in Kilmarnock und William Teacher in Glasgow. Oder Weinhändler wie Matthew Gloag und John Dewar in Perth. Nicht zu vergessen George Ballantine in Edinburgh. Sie alle verkauften Whisky von Anfang an. 1825 lagerte Walker aqua (vermutlich frisch gebrannten Whisky) und Islay. In den 1860er-Jahren hatten die Chivas-Brüder bereits Royal Glen Dee und Royal Strathythan in ihr Sortiment aufgenommen – beide waren wohl Vatted Malts. Dewars erster Blend und Walkers Old Highland kamen ebenfalls um 1860 auf den Markt.
Die besseren Lebensmittelhändler in Großbritannien nannten sich werbewirksam »italienische Lageristen«. In ihren Läden entstand mancher Scotch Blend. Hier der Shop der Chivas Brothers in der King Street von Aberdeen.
Die frühen Blends waren kräftig und reich. Schwere Malts verdünnte man oft mit nicht ausgebautem Grain. Allmählich kristallisierten sich – geografisch bedingt – Hausstile heraus: Walker in Kilmarnock schuf seine Blends mit den reichen, rauchigen Whiskys aus dem Westen, während die Gebrüder Chivas ihr Material aus Strathspey und Dewar das seine aus Perthshire bezogen.
Es ist kein Zufall, dass viele Blender Lebensmittelhändler waren. Blends entstanden nicht nur, weil man Malts trinkbarer machen wollte, sie waren auch eine Reaktion auf Verbraucherwünsche. In den Kochbüchern des 19. Jahrhunderts finden sich etliche Zutaten, die heute als exotisch gelten. Die Blender waren vom Duft der großen weiten Welt umgeben und machten sich die veränderten Geschmacksvorlieben zunutze.
Inzwischen war Scotch auch in Amerika gelandet. Auf ihm basierte beispielsweise der von Bartender Jerry Thomas erfundene Blue Blazer Cocktail. Im Bartenders Guide von 1862 werden Glenlivet oder Islay als Ingredienz für Scotch Whisky Skin und Hot Scotch Whisky Punch empfohlen. Für den Spread Eagle Punch brachte man Islay mit Monongahela Rye zusammen –ein Beweis, dass nicht nur Blends verkauft wurden. Das ganze 19. Jahrhundert hindurch blieben Single Malt und Vatted von Bedeutung. Glen Grant wurde 1853 sogar in Sierra Leone getrunken.
Ab 1860 veränderte Glenlivet (die Bezeichnung für Whisky aus Strathspey) seinen Geschmack. Als die Bahn in der Region gebaut wurde, konnten sich die Brennereien Kohle beschaffen, was ihre Abhängigkeit von Torf verringerte und ihren Whisky leichter machte. Mit einer zweiten Welle von Neugründungen traten Brennereien auf den Plan, die diesen leichteren Stil erzeugten. Er war von den Blendern vorgegeben worden, die inzwischen das Sagen hatten, weil sie den Geschmack in den Mittelpunkt rückten.
Barhandbücher wie der Bariana aus dem späten 19. Jahrhundert enthielten viele Cocktails auf Whiskybasis.
Ende des 19. Jahrhunderts hatte Sir Alexander (Alec) Walker seine enormen Bestände nach Namen und Stil geordnet – nicht nach der Herkunft. Seine Blending-Rezepte sind eine simple Angelegenheit: Vorgegeben werden einfach die jeweiligen Anteile geschmacksprägender Posten. Nach Ansicht von Walkers derzeitigem Master Blender, Jim Beveridge, deutet dies darauf hin, dass sein Vorgänger vor dem Blenden Vats mit bestimmten Geschmackseigenschaften vorbereitete.
Die schottischen Blender mussten innovativ sein, denn ihr Whisky hatte noch nicht die Popularität des irischen erreicht, dessen goldenes Zeitalter das 19. Jahrhundert war. Zu verdanken war der Höhenflug den Brennereien in den Städten, die ungemälzte Gerste zu gemälzter hinzufügten, um die Malzsteuer zu umgehen, und damit unbeabsichtigt einen neuen Whiskystil kreierten: den Single Pot Still.
Aber Schottlands Blender erzielten einen Durchbruch: Sie versuchten herauszufinden, welchen Whiskygeschmack ihre potenziellen Käufer bevorzugten. Seit Langem war bekannt, dass Londons Gaumen leichtere Whiskys mochten als die Glasgower. Also schufen Blender wie James Buchanan (Buchanan’s, Black & White), James Greenlees und Tommy Dewar Whiskys, die diesem Geschmack entsprachen.
Das Glück war ihnen hold. 1877 verwüstete die Reblaus die Weinberge von Cognac in Frankreich. Ein Vierteljahrhundert sollte es dauern, bis die Anbauflächen wieder bestockt waren. In dieser Zeit zog Scotch mit Soda an Brandy mit Soda vorbei. Der Highball, eine britische Schöpfung, brachte den Durchbruch für Blended Scotch Whisky – und hatte zudem den Ruf eines respektablen bürgerlichen Trunks. Blends wurden nun nicht mehr nur auf Verbraucher zugeschnitten, sondern auch auf Mixgetränke abgestimmt.
Johnnie Walker wurde zur Weltmarke – auch weil die Brennerei sehr stark auf Werbung als neues Medium setzte.
In der 1900 erschienenen Ausgabe seines Bartenders’ Manual listet der New Yorker Bartender Harry Johnson sieben Scotch Blends und noch einmal genauso viele Cocktails auf Scotch-Basis auf. Der 1896 in Paris veröffentlichte Bariana nennt 32 Whiskygetränke, von denen 22 Scotch (oder Irish) Whisky erforderten. Die größte Überraschung aber bot William Schmidts Werk The Flowing Bowl von 1892, enthielt es doch ein Rezept für ein französisches Getränkekonstrukt namens scubac. Unser alter Freund Usquebaugh hatte den Ärmelkanal überquert und seinen Namen geändert!
Die internationalen Verkaufszahlen gingen nach oben, auch mithilfe erster erfolgreicher Reklame. 1898 gab Tommy Dewar den ersten Werbefilm der Welt in Auftrag. Zehn Jahre später engagierte Johnnie-Walker-Pionier James Stevenson den Werbefachmann Paul E. Derrick, der das gezeichnete Firmenlogo des »Striding Man« in Auftrag gab. Scotch war nun nicht länger ein sonderbares Produkt aus einem kleinen, feuchten Land, sondern eine Marke.
Der Erste Weltkrieg war eine harte Zeit für den schottischen Whisky – Zwangsschließungen, Steuererhöhungen und Mindestpreise beutelten den Sektor. Dennoch konnte sich Scotch in den 1920er-Jahren besser neu positionieren als die beiden Hauptrivalen, denen ihre größte Krise noch bevorstand.
ZWEI SCUBACS
IRISH SCUBAC
(The Wine and Spirit Merchants Own Book, C. C. Dornat, 1855)
Extra Fine »Die Schale von 4 Zitronen, jeweils 4 Drachmen Engelwurzsamen, Koriander und grünen Anis, 9 Drachmen Zimt sowie 2 Drachmen Mazis und Gewürznelken nehmen, zerstoßen und 5 Tage in 6 Quart Alkohol legen, dann im Wasserbad destillieren. Jeweils 4 Drachmen Jujube, Datteln und Malaga-Rosinen entkernen, pressen und den Saft zum Destillationsprodukt hinzufügen. 24 Tropfen Neroli-Essenz dazugeben und das Ganze vor dem Filtern zwei Wochen ziehen lassen.«
Irish Usquebaugh, in Frankreich Scubac genannt (The Flowing Bowl, »The Only William« alias W. Schmidt, 1892)
»Dieser berühmte Digestif, den die Franzosen Scubac nennen, wird auf mehrere Arten zubereitet. Man nehme eineinfünftel Unzen Muskatnuss, ebenso viel Gewürznelken und Zimt, zweieindrittel Unzen Anis, ebenso viel Kümmel und Koriander in zerstoßener Form und gebe alles mit vier Unzen Süßholzwurzel, dreiundzwanzig Quart reinem Alkohol und einem halben Quart Wasser in den Destillationsapparat, färbe die kondensierte Flüssigkeit mit Safran und süße sie mit Zuckersirup.«
JAPAN
Als Captain Perrys schwarze Schiffe 1854 in die Bucht von Yokohama segelten, um die Türen nach Japan gewaltsam aufzustoßen, brachte er ein flüssiges Beruhigungsmittel mit: Whisky. Am 15. März des Jahres wurde dem Kaiser ein Fass mit amerikanischem Whiskey oder Scotch überreicht. Es waren letztlich aber die Schotten, die von der Öffnung Japans gegenüber dem Westen profitierten. Kaum hatten die Briten mit Japan ein ähnliches Abkommen abgeschlossen wie die USA, eröffnete das Handelshaus Jardine Matheson eine Dependance in Yokohama und begann mit dem Verkauf von Scotch und Irish – zum Teil über Japans erste Cocktailbar westlichen Stils im Grand Hotel der Stadt.
1873 brachte die Iwakura-Delegation von ihrer zweijährigen Mission zur Knüpfung von Handelsbeziehungen mit dem Westen eine Kiste Old Parr in die japanische Heimat mit. Um 1890 kartografierte Captain Albert Richard Brown aus Glasgow erstmals Japans Küsten. Sie wurden bald von Leuchttürmen bewacht, die Ingenieur Henry Brunton aus Aberdeen geplant hatte, und von Kriegsschiffen gesichert, die der »schottische Samurai« Thomas Blake Glover bauen und mit Bewaffnung aus Glasgower Fabriken hatte ausrüsten lassen.
Kein Wunder also, dass es in Japan bald die meisten großen schottischen Blends zu kaufen gab. 1907 wurde James Buchanan & Co. vom japanischen Kaiser zum Hoflieferanten ernannt – der Royal Household des Unternehmens erscheint bis heute nur in Japan. Unterdessen hatten bereits mehrere Firmen begonnen, westliche Spirituosen (yo-shu) nachzuahmen, indem sie ähnlich wie die amerikanischen Rectifier Basisdestillaten Gewürze und Essenzen hinzufügten. Im Nonjatta-Blog über japanischen Whisky findet sich ein unterhaltsamer Bericht über amerikanische Soldaten, die während eines Landgangs auf Hokkaido im Jahr 1918 schwer angeschlagen auf ihr Schiff zurückkehrten, nachdem sie einem japanischen yo-shu-Whisky namens Queen George allzu begeistert zugesprochen hatten.
Masataka Taketsuru (hier mit seiner schottischen Frau Rita) gehörte zu den Gründervätern des japanischen Whiskys.
Nicht von yo-shu, sondern von einem in Japan gebrannten Whisky träumte ein junger Japaner namens Shinjiro Torii. 1919 hatte er bereits einen Plan, wie sich sein Vorhaben in die Tat umsetzen ließ. Allein war er damit nicht. Schon im Jahr davor war Masataka Taketsuru aus Hiroshima von seinem Arbeitgeber Settsu Shizo nach Glasgow geschickt worden, damit er dort in die Kunst des Whiskybrennens eingeführt wurde. 1920 kehrte er mit einer Schottin als angetrauter Frau zurück, nur um feststellen zu müssen, dass Settsu Shizo wegen finanzieller Schwierigkeiten die Pläne zum Bau einer Brennerei ad acta gelegt hatte.
Inzwischen hatte Torii allerdings ein Stück Land in Yamazaki bei Kyoto erworben und errichtete dort eine Brennerei, für die er natürlich Taketsuru engagierte. 1929 brachte das Unternehmen – heute heißt es Suntory – Japans ersten eigenen Blend namens Shiro Fuda (White Label) heraus. Er floppte, denn für japanische Gaumen war er zu schwer und rauchig. Bald darauf gründete Taketsuru auf Hokkaido eine eigene Firma, die noch heute existiert, aber inzwischen Nikka heißt.
Torii erkannte, dass japanischer Whisky an japanische Empfindsamkeiten angepasst werden musste. Er sollte leicht sein, zum Essensbegleiter taugen und in den schwülheißen Sommern erfrischende Wirkung entfalten. Die Lösung war der Kakubin. Er debütierte 1937 und ist bis heute Japans meistverkaufter Blend.
Erst nach 1945 aber kam Japans Whiskyindustrie in Gang. Anfangs deckte sie vor allem die Nachfrage der amerikanischen Besatzer nach Hochprozentigem. Als die Wirtschaft jedoch Fahrt aufnahm, wurde Whisky in den unterschiedlichsten Erscheinungsformen ein flüssiges Symbol des neuen Japan.
1952 gründete Torii die Barkette Tory’s, über die er seine Whiskys verkaufte. In den nächsten beiden Jahrzehnten traten weitere Brennereien (Hombu, Karuizawa, Shirakawa, Kawasaki) und Marken wie Ocean, King und Nikka’s Black auf den Plan. Ein Motor des neuen Whiskybooms war der Mizuwari, ein unkompliziertes Getränk: hohes Glas, Whisky, Eis, viel kaltes Wasser, dreimal umrühren. Torii hatte den richtigen Riecher. Mit dem Mizuwari ließ sich Whisky nun zum Essen trinken. Er wurde zum Diesel des Büroangestellten.
Die Mizuwari-Generationen bescherten dem japanischen, aber auch dem importierten Whisky eine fast 40-jährige Blütezeit. Neue Brennereien wie Miyagikyo und Hakushu entstanden – Letztere war eine Zeit lang die größte Malt-Destillerie der Welt. In den 1980er-Jahren wurden vom Suntory Old allein in Japan 12,4 Millionen Kisten jährlich verkauft.
Als 1991 Japans Wirtschaftsblase platzte, folgten zwei Jahrzehnte Stagnation. Whisky wurde zum Getränk der Vergangenheit, der Väter und Großväter. Brennereien verschwanden, Markenlinien wurden verschlankt. Gleichzeitig aber wurde der Ruf japanischer Erzeugnisse immer besser und die Bars des Landes zu den größten Fundgruben der Welt. Kenner reisten von weither, um in all diesen spärlich beleuchteten Schreinen dem Whisky zu huldigen.
Der Niedergang hatte aber auch einen Vorteil: Japans Brenner mussten zum ersten Mal exportieren. Ihr Single Malt wurde sogleich als Klassiker begrüßt. Im neuen Jahrtausend begann sich auch der heimische Markt wieder mit Whisky anzufreunden. Als Rettung erwies sich ein Getränk, von dem man es überhaupt nicht erwartet hatte: der Highball.
Trotz eifriger Alkoholpolizisten stieg der Verkauf von Whisky während der amerikanischen Prohibition.
WHISKY 1920-2000
Dass die Prohibitionszeit in Amerika ein einziges großes Besäufnis war, ist eine Legende. 1929 lag der Gesamtverbrauch alkoholischer Getränke unter dem von 1915, als man die Staaten trockenzulegen begann. Allerdings waren die Verbraucher von Bier auf Hochprozentiges umgestiegen und stoppten damit den 75-jährigen Niedergang von Spirituosen. 1922 liefen die illegalen Stills in den Appalachians heiß, um die Nachfrage zu decken. Ende der Zwanzigerjahre hatte sich ein Netzwerk aus städtischen Schwarzbrennern, alky cookers – »Alkoköche« – genannt, etabliert. Sie wurden von einer Traubenzuckerindustrie beliefert, deren Ausstoß unerklärlicherweise von rund 70 Tonnen im Jahr 1921 auf fast 500 Tonnen stieg. Mit 50 Cent Aufwand produzierte ein Schwarzbrenner etwa fünf Liter, die er für zwei Dollar an einen Zwischenhändler verkaufte, der sie für 40 Dollar an illegale Kneipen weiterreichte. Schwarzbrennen war leicht verdientes Geld – und äußerst lukrativ.
Auch Industriealkohol wurde abgezweigt und verarbeitet. Wie die anrüchigen Rectifier des 19. Jahrhunderts panschten die Bootleggers »Scotch«, indem sie etwas Karamell, Pflaumensaft und – je nachdem, wie rauchig die anspruchsvolle Spelunkenklientel ihren »Whisky« haben wollte – Kreosot dazugaben.
Gleichzeitig sickerte importierter Scotch durch die porösen Grenzen Amerikas. Damit der Ruf seiner schottischen Marken nicht litt, versuchte der größte Hersteller, DCL, den »Spezialhandel« zu kontrollieren, indem er für seine Erzeugnisse eine erste und zweite Kategorie einführte. Zudem gab das Unternehmen die Preise vor und prüfte »Importeure« auf Herz und Nieren, damit ihr Scotch nicht in die Hände der Gangs gelangte.
Während der Prohibitionszeit gab es in den illegalen Kneipen immer mehr Hochprozentiges – und weibliche Kundschaft.
Kanadische Importeure wie Henry Hatch und Sam Bronfman verkauften zwar ebenfalls Whisky in die Staaten, galten aber nicht als Schwarzhändler. Hatch hatte 1923 Gooderham & Worts gekauft und 1926 Hiram Walker übernommen. »Hatch’s Navy« schipperte des Nachts whiskybeladen über den Ontariosee.
Sam Bronfman stieg 1923 mit seinem Bruder Harry als Blender, Zwischenhändler und Verteiler von DCL-Marken in das Whiskygeschäft ein. Auch sie schmuggelten Hochprozentiges über die Grenze. Ihre De-facto-Übernahme von Seagram 1928 war die Geburtsstunde eines der mächtigsten Getränkekonzerne des 20. Jahrhunderts. Aus Sicht der kanadischen Behörden taten Hatch und Bronfman nichts Verbotenes, solange sie ihre Steuern in Kanada zahlten.
Die Iren waren die Einzigen, die bei der Prohibitionsparty fehlten. Ihr Land war Anfang der 1920er-Jahre damit beschäftigt, sich als unabhängige Nation zu etablieren. Die neue Regierung brauchte dringend Geld und besteuerte Whiskey bis an die Grenze des Erträglichen. Weil gleichzeitig der Export nach Großbritannien zusammenbrach, mussten viele Brennereien aufgeben. Joe Kennedy, Vater von John F., stattete Dublin in den Zwanzigerjahren einen Besuch ab, um mit Jameson & Power einen Zulieferervertrag für Amerika abzuschließen, doch die Brenner stuften das Geschäft als illegal ein und lehnten ab. So konnte Scotch seine Chance nutzen. Überraschenderweise steigerte Kanada seine Verkaufszahlen während der Prohibition nicht so stark wie Schottland.
Die Zeiten waren gut. 1929 gab es schätzungsweise doppelt so viele illegale Flüsterkneipen wie zehn Jahre zuvor legale Saloons. Hinter den Türspionen jedoch änderte sich allmählich das Trinkverhalten. Die Menschen genossen Schwarzgebranntes, Joints und Kokain. Zumindest die Betuchten. Da die Alkoholpreise um das Zehnfache gestiegen waren, konnten nur sie sich noch das Kneipenleben leisten. So tranken sie sich in den hedonistischen Schreinen einem neuen Zeitalter entgegen, in dem Trunkenheit wie ein Ehrenabzeichen zur Schau getragen wurde.
The Savoy Cocktail Book entstand nach 1930. Es enthält Rezepte des legendären Bartenders Harry Craddock, darunter viele Varianten mit Whisky.
Eine neue Welt nahm Formen an – und Jazz diente als ihr Soundtrack. Die Eiswürfel im Shaker waren mit ihrem Klirren die Rhythmusgruppe, das Gelächter zahlender Frauen der Chor. Während der Prohibition kristallisierte sich zum ersten Mal eine rebellische Jugendkultur heraus. Es war eine Zeit der unbegrenzten Möglichkeiten – für die, die das Geld dafür hatten. Für die anderen blieb immer noch der Fusel der Alky Cookers.
In Schottland dagegen wurde rationalisiert. Das wichtigste Ereignis der Zeit war 1925 die Fusion zwischen DCL und den drei großen Blendern Buchanan, Dewar und Walker. Das Partyvolk, das Blended Scotch und andere Drinks in angesagten Londoner und Pariser Nachtclubs schlürfte, kümmerte das nicht. 1933 listete Harry Craddock in seinem Savoy Cocktail Book 45 Getränke auf Scotch-Basis und 40 mit Canadian Rye als Bestandteil auf. 1937 hatte das Londoner Café Royal 33 Scotch-Drinks auf der Getränkekarte, genauso viele Variationen mit Bourbon und 34 mit Canadian.
Die Aufhebung des Alkoholverbots in Amerika fiel mit der Weltwirtschaftskrise zusammen. Viele Brenner ließen den Blick über das verwüstete Land schweifen – und warfen hin. Wer einen Neuanfang wagte, hatte oft Whisky im Blut, etwa die Familien Beam, Samuels und Brown. Andere, etwa die Shapiras von Heaven Hill, hatten zumindest eine Vision. Aber alle mussten sie von vorn beginnen – und das, während Scotch immer mehr Marktanteile eroberte und die großen kanadischen Akteure hereindrängten. Auf dem Höhepunkt seiner Macht besaß Seagram 13 US-Destillerien, einschließlich Four Roses, das 1943 zum Portfolio hinzugefügt wurde.
Kaum hatte sich die US-Whiskyindustrie halbwegs aufgerappelt, begann der Zweite Weltkrieg und versetzte dem Sektor wieder einen Stoß. Auf der anderen Seite des Atlantiks dagegen hielt die britische Regierung Schottlands Brennereien zum Export an. Durchschnittlich 14 Millionen Liter Scotch gingen jährlich über den Teich. Auch nach dem Krieg setzte man die exportorientierte Strategie fort. 1945 erklärte Winston Churchill:
»Keinesfalls darf die Gerstenproduktion für Whisky gedrosselt werden. Er braucht Jahre, um zu reifen, und ist ein Exportgut und Dollarlieferant von unschätzbarem Wert.«
Blends retteten nicht nur die Scotch-Industrie, sondern halfen dem ganzen Land wieder auf die Beine.
Marken wie Cutty Sark wurden speziell auf den amerikanischen Geschmack zugeschnitten, der Leichteres bevorzugte.
Zum Glück wollte Amerika Scotch, selbst wenn der Geschmack sich seit der Prohibition gewandelt hatte. Rye war weg vom Fenster, Straight Bourbon im Niedergang begriffen. Man verlangte nach sauberen, leichten Spirituosen, amerikanischen Blends wie 7 Crown, kanadischen wie Canadian Club oder Crown Royal und Scotch wie Cutty Sark, den 1923 ein Blender namens Charles H. Julian für die Berry Bros. ersonnen hatte. 1933 wiederholte er das Ganze für Justerini & Brooks und kreierte den J&B Rare, wie wir ihn heute kennen.
Diese Blends und die Etiketten, die sich während der Prohibition und des Krieges einen Namen gemacht hatten (allen voran Peter Dawson, Dewar’s und Walker Red), expandierten rasch. 1954 bekamen sie Gesellschaft vom Chivas Regal 12 Year Old, einer Kreation von … Charles H. Julian. Die größte Tugend des Blended Scotch war seine Anpassungsfähigkeit. Deshalb beherrschte er auch Amerika – mit einem Spritzer Soda.
In den 1950er-Jahren wurde Amerika seriös und konzentrierte sich auf seine Wirtschaft. Scotch galt nicht mehr unbedingt als erste Wahl für Mixgetränke, ein Ruf, den er nur schwer wieder loswurde. 1958 befand Cocktailexperte David Embury:
»Die meisten Scotch eignen sich wegen ihrer ausgeprägten Rauchnote nicht so gut für Cocktails wie Rye oder Bourbon. Man sollte sie straight oder als Highball trinken.«
Zudem hatte Scotch den Markt zwar erobert, sich damit aber gleichzeitig als sicherer Drink für den leicht angegrauten »Gentleman« etabliert. Kein gutes Omen.
Den letzten Auftritt als Trendgetränk hatte Scotch in Ian Flemings James-Bond-Romanen. In ihnen war Bonds Lieblingsdrink nicht der Martini, sondern Scotch mit Soda. In Feuerball spielt sein Kater nach elf Gläsern eine wichtige Rolle. Als der mondäne Geheimagent es in den 1960er-Jahren auf die Leinwand schaffte, war er bereits auf weiße Spirituosen umgestiegen – ein klares Zeichen für den Imagewandel von Scotch.
Scotch blieb zwar das Standardgetränk für Führungskräfte, doch in den Siebzigerjahren geriet er in den Ruch des Drinks für Depressive und Gauner.
J. R. Ewing trank Whiskey, Bobby Ewing nicht. In der Country- und Bluesmusik wurde er zur Zuflucht der Verlorenen, Verbitterten, Verlassenen. Willie Nelson sang:
»Whiskey-Fluss, nimm meinen Geist und die quälende Erinnerung an dich. Whisky-Fluss, trockne nicht aus, ich hab nur dich, kümmer dich um mich.«
Guter Song, aber nicht unbedingt eine gute Werbung.
Hippies hielten nichts von Whisky, obwohl mancher Rockstar sein Rebellen-Image mit einer kantigen Flasche aus Tennessee in der Hand pflegte.
Ende der 1970er-Jahre gingen die Verkaufszahlen auf den wichtigsten Scotch-Märkten zurück, obwohl die Brennereien die Augen davor verschlossen. Die Produktion blieb selbst dann hoch, als die Jugend sich vom Getränk ihrer Väter abwandte. Es bildete sich ein Whiskysee, der immer größer wurde. Bis 1982 stieg der Rationalisierungsbedarf, und als man mit Einsparungen begann, traf es die Industrie mit voller Wucht. Brennereien wurden massenhaft stillgelegt.
Wie so oft aber gab es am Tiefpunkt erste Anzeichen für ein Licht am Ende des Tunnels. Diesmal stammte es nicht von Blends, sondern von Single Malts. Es gab sie zwar schon seit dem 18. Jahrhundert, doch erst ab Ende der 1970er-Jahre wurden sie vermarktet. Glenfiddich, Glenlivet, Macallan, Glen Grant und Diageos Classic Malts veränderten die Whiskylandschaft. Single Malt erzählte eine neue Geschichte von Herkunft, Vergangenheit und Intensität, die nur mit einem Spritzer Wasser, wenn überhaupt, aufgenommen werden durfte. Die Ära des Whisky pur war gekommen. Eingeläutet wurde sie von Malts.
Der Trend blieb Bourbon-Erzeugern nicht verborgen. Kraftstrotzende, dichte Premium-Bourbons erschienen. Die Bühne war frei für die neueste und vielleicht erstaunlichste Wandlung der Whiskylandschaft.
WHISKY HEUTE
Ihren Ausgang nahm die neue Bewegung im Spanien nach Franco, wo eine junge Generation sich von den Gewohnheiten und Brandys ihrer Väter ab- und Blended Scotch mit Cola zuwandte. Whisky-Cola galt zwar als viel zu extravagant für die Traditionsmärkte, doch erfasste die Mode auch das postkommunistische Russland, das demokratisierte Südafrika und das wirtschaftlich aufstrebende Brasilien, Venezuela und China.
In jedem der neuen Märkte steht Whisky für Erfolg – und jeder hat seine eigene Art gefunden, ihn zu genießen: Brasilien trinkt ihn mit Kokoswasser, Südafrika mit Cola oder Appletiser, China mit grünem Tee, Russland mit Cola. Blends sind wieder in. Selbst in Japan entdeckt die Jugend ein altes Getränk neu: den Highball.
Gleichzeitig setzt sich in den Traditionsmärkten der Single-Malt-Boom fort. Vom Sog dieses Trends profitieren Bourbon, Rye, eine neu erstandene Kategorie Irish Whiskeys und seit Kurzem auch Canadian Whisky.
Die Generation, deren Eltern Whisky ignoriert hatte, kommt wieder auf den Whiskygeschmack. Sie hat keine vorgefertigten Meinungen, wie er getrunken, gemixt oder gemacht werden muss. Der Beginn des neuen Jahrtausends brachte nicht nur den größten Zuwachs an Verkaufszahlen in der Whiskygeschichte mit sich, es entstanden auch Destillerien rund um den Globus. Sie alle brennen Whisky, der vom Terroir durchdrungen ist. Sie kopieren nicht, sie schaffen etwas Eigenes.
Eine neue Generation handwerklich arbeitender Kleinbrennereien (hier Kings County in Brooklyn) hat die amerikanische Whiskeyszene im Sturm erobert.