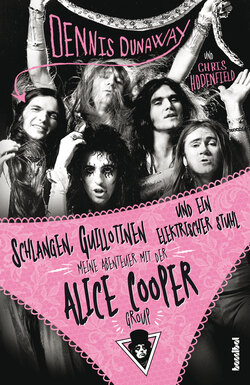Читать книгу Schlangen, Guillotinen und ein elektrischer Stuhl - Dennis Dunaway - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление„Wenn aus verrückten Menschen Massen von verrückten Menschen werden, sind wir berühmt.“
– Vince
Vince’ Stuhl rutschte mit einem quietschenden Geräusch über den mit Farbe verdreckten Linoleum-Boden. Wir saßen im Kunstkurs, und überall schossen die Köpfe in die Höhe, ähnlich wie bei einer aufgeschreckten Antilopenherde. Lachen war strengstens untersagt, und so musste man es mit Mühe unterdrücken. Vince schaute hoch, um zu sehen, ob es Mrs. Sloan bemerkt hatte. Er blickte direkt in ihre funkelnden Augen, die ihn über die Lesebrille hinweg anstarrten, ihn regelrecht ins Visier nahmen und dabei signalisierten, dass sie hier das Kommando führte.
Vince eilte der Ruf voraus, seinen Kopf durch Scherze und Witzeleien aus der Schlinge zu ziehen. Und nun wartete die Klasse gespannt. Mrs. Sloan war attraktiv und allgemein beliebt, doch auch für ihre unnachgiebige Haltung bekannt. Und nun wurde sie herausgefordert.
Vince’ Augen vergrößerten sich bei der Imitation des Fernsehstars Barney Fife. Er hauchte ein stimmloses „Sorry“. Im Moment ähnelte er einem Schauspieler im grellen Scheinwerferlicht, der sich mit Leichtigkeit in einen Inspektor Clouseau, Stan Laurel oder einen weiteren Charakter seines Repertoires aus gut einem Dutzend Darstellern verwandeln konnte. Aber er spielte den ängstlichen Gesetzeshüter, hob den Stuhl unmerklich an und rutschte über den Boden zu mir herüber. In einer entfernten Ecke des Raums hörten wir jemand losprusten. Es war Maurice Kluff, ein Junge, der ständig knallig orangefarbene Socken trug. Mrs. Sloan würgte ihn mit ihrem tödlichen Starren augenblicklich ab.
Die Klasse beruhigte sich wieder. Vince und ich blätterten in einem schweren Schinken über moderne Kunst. Für uns war es eine Art Piratenschatz. Wir stießen auf ein Sigmund-Freud-Gemälde von Salvador Dalí, im surrealistischen Stil gehalten, lebhaft und anregend. Vince schaute zur nächsten Abbildung und deutete mit dem Finger auf jedes einzelne Wort des Titels: „Weiche Konstruktion mit gekochten Bohnen – Vorahnung des Bürgerkriegs“. Er lachte und murmelte: „Gekochte Bohnen?“
Ich legte den Kopf auf die Faust und studierte das Werk aus der Nähe. Vince machte es mir nach, womit wir ideale Modelle für die Skulptur „Der Denker“ abgegeben hätten.
Bevor ich zu einer großartigen Schlussfolgerung gelangte, nickte Vince mit dem Kopf. Er ähnelte einem der Wackel-Dackel, die unvermeidlich auf der hinteren Ablage eines Chevy standen.
„Geschickt“, sagte er.
„Wirklich geschickt“, ergänzte ich seine Einsicht.
Auf der nächsten Seite zeigte ein weiteres anregendes Dalí-Gemälde eine grotesk verformte Struktur, die wie ein zusammengeworfener Haufen Körperteile anmutete. Auf ihr ruhte ein abgrundtief hässlicher Kopf. Doch sofort entdeckte Vince die Figur von Freud. Sie glich dem des vorigen Gemäldes, war nur kleiner. Der winzige Freud wirkte im Kontext der ausgearbeiteten Vision Dalís noch beeindruckender.
Was geschah in dem Moment der Entdeckung? Ich möchte behaupten, wir wussten, dass etwas Großes stattgefunden hatte. Etwas hatte sich verändert.
Ich wurde im Herbst 1961 in die Cortez High eingeschult. Die gerade erst eröffnete Schule lag am nördlichen Rand von Phoenix und besaß noch keine Klimaanlage. Jedes Klassenzimmer glich einem Hochofen. Die Schulregeln waren noch nicht festgeschrieben, woraufhin die Kids die ganze Zeit die Grenzen austesteten und sie zu überschreiten versuchten.
Ich trat dem Leichtathletik-Team bei. Coach Emmett Smith bemerkte sofort mein Talent für den Langlauf. Glorreiche Zeiten. Schnell fand ich heraus, dass Geländerennen genauso beliebt waren wie die Wettkämpfe auf der Aschenbahn, bei denen wir uns abrackerten. Zuschauer? Nein, während des Trainings schaute niemand zu – mal abgesehen vom Hausmeister und seinem Hund.
Im Team begegnete ich einem meiner zukünftigen Musikerkollegen. John Speer hatte lockiges dunkles Haar, einen großen und breiten Brustkorb und den Körperbau eines Bullen. Ihn zeichnete ein Gespür für Humor aus, obwohl dieser von dunklen Wolken des Pessimismus getrübt wurde. Zwischen uns entwickelte sich eine kollegiale Rivalität.
Nicht jeder auf der Cortez kam so gut über die Runden wie die Jungs unseres Teams. Oftmals regelten die Schüler ihre Differenzen mit den Fäusten nach dem Unterricht. Jeder, der sich einen Ruf erkämpfen wollte, wenn auch einen fragwürdigen, musste sich regelmäßig auf dem Schulparkplatz beweisen.
Der schlimmste Unruhestifter der Schule war ein stämmiger, Hulk-ähnlicher Typ namens Ruben. Er hatte drei ältere Brüder, die ihn nach dem Unterricht abholten. Wenn die sich in den weißen Corvair drängten, hing die Karosserie fast auf dem Boden. Die Brüder warfen stechende boshafte Blicke aus dem Wagen, der einem Nest voller Klapperschlangen glich.
Rubens Lieblingsschikane lief folgendermaßen ab: Er kam mit ausgestreckter, nicht abzuschlagender Pranke auf dich zu, quetschte dann deine Hand, bis du voller Qualen auf die Knie gingst, zog dich zum Mülleimer und stopfte dich da rein. Deine Schmerzen bereiteten ihm Freude.
Dann aber tauchte ein spindeldürrer Neuling namens Vince Furnier auf. Er war mit Sicherheit der ungefährlichste Mensch auf dem ganzen Planeten. Ruben fand das lustig. So rekrutierte er Vince als „Zwangs-Freiwilligen“ seines Terrorregimes des brutalen Händedrucks. Wenn die beiden Seite an Seite standen, ähnelten sie den Comic-Figuren Tweety Bird und Spike. Ruben versuchte sich hinter Vince zu verbergen, seiner knochigen Gestalt, die die unschuldige Beute anlockte.
Vince stellte den vorbeigehenden Kindern Ruben vor, der mit erhobener Hand grinsend aus seinem Versteck kam. So lange Ruben genügend Unterhaltung hatte, war sein Knecht vor dem „Handschlag aus der Hölle“ sicher. Er schien Spaß an der Rolle als Lockvogel für nichtsahnende Kinder zu haben. Es war ja nicht seine Schuld, denn letztendlich wurde er von Ruben gezwungen.
Auf der Schule betrachtete man den Journalismus-Kurs als „Mädchen-Ding“. Natürlich meldete ich mich dazu an, was zugleich das Verfassen von Beiträgen für die Studentenzeitung Tip Sheet bedeutete. Die Mädchen sahen mich als merkwürdigen „Abweichler“ und ließen mir die spezielle Behandlung zukommen, die da überschwängliche Fürsorge lautete. Oh ja, ich war ein böser Junge. Sie wollten nicht, dass ich mich angesichts des bevorstehenden Redaktionsschlusses stresste, und schrieben demzufolge die Storys für mich. Für einen Text gewann ich sogar einen Preis.
Auch die Jungs auf dem Campus verordneten mir eine Sonderbehandlung: Sie schimpften mich einen Homo. John Speer nahm mich besonders aufs Korn. Doch nach einiger Zeit, in der ihnen klarwurde, was für ein kuschliges Leben in einer Klasse voller süßer Mädels ich führte, realisierten Speer und die anderen Gammler mein Genie. Vince meldete sich natürlich so schnell wie möglich für den Kurs an und leitete das Sport-Ressort des Tip Sheet.
Obwohl ein Jahr jünger, war Vince ein ausgeprägter Charakter, zu dem ich mich augenblicklich hingezogen fühlte. Freunde zu gewinnen, schien für ihn mühelos zu sein. Er begab sich nicht auf die Suche, musste nicht mal einen Raum durchqueren. Er zog die Menschen mit seinem Magnetismus förmlich an.
Als wir uns begegneten, war seine Familie gerade aus Detroit nach Phoenix gezogen, was nur den letzten Umzug in einer ganzen Reihe von Wohnortwechseln bedeutete. Ein Junge, dessen Familie ständig umzieht, auf permanenter Durchreise ist, der lernt, wie man alte Freunde schnell vergisst und neue gewinnt. Doch manchmal ist die Anpassung auch überaus schwierig: Vince’ ältere Schwester Nickie etwa verarbeitete die Umzüge durch das Vermeiden jeglicher Form von Freundschaft. Damit verringerten sich die traurigen Abschiede, die sie ertragen musste.
Vince hingegen verhielt sich konträr zu seiner Schwester. Egal, wo auch immer er sich befand, behandelte er alle wie Freunde. Er unterhielt sich mit jedem über jedes beliebige Thema. Blitzschnell erkannte er, was sein Gegenüber hören wollte, und plauderte es aus, auch wenn er die Wahrheit ein wenig strapazierte. Man könnte sogar behaupten, dass ihm Übertreibungen zusagten. In seiner Welt war die gute alte Wahrheit viel zu langweilig, und so kleidete er sie in ein schilderndes Kostüm. Jedoch wusste er genau, wie weit er mit den Ausschmückungen gehen konnte.
Man muss bedenken, dass sich sein Vater, ein Luftfahrtingenieur, auch als Pfarrer engagierte. (Er war aber trotzdem ein cooler Typ, mit einer höchst interessanten Frisur und einem bleistiftdünnen Oberlippenbart, der ihn wie einen Spieler auf einem Schaufelraddampfer erscheinen ließ. Witzig: Auf vielen von Vince gezeichneten Skizzen trugen die dargestellten Personen Oberlippenbärte!) Von Haus aus mit einer gehörigen Portion Religion konfrontiert, glaubte Vince an ehrliches Verhalten und hätte demzufolge niemals gelogen. Das war jedoch nicht nur Folge des Respekts vor seinem Vater, auch Vince teilte denselben Glauben. Dennoch – ich habe schon darauf hingewiesen – hatte Vince ein ständiges Bedürfnis nach Übertreibung, was er als einfachen Weg empfand, um die Wahrheit ein wenig interessanter zu gestalten. Da ist nun mal nichts Verwerfliches dran!
Um seine Überzeichnungen glaubhaft wirken zu lassen, sprach er mit lässigem Selbstvertrauen und lachte oft dabei. Man gewann dabei den Eindruck, dass er ausdrücken wollte: „Wow, das kann ich selbst kaum glauben.“ Sein Lachen signalisierte allen – und möglicherweise auch ihm selbst –, dass es sich hier um schelmisches Gelaber handelte, nicht um ein ernsthaftes Gespräch. Und es gab noch einen Grund, warum man Gespräche mit Vince bis zum Ende genoss: Er stellte sich niemals über andere, wollte sich nie als einen besseren Menschen herausputzen.
Wir reden hier über den Teenager namens Vince und nicht über die bedrohliche Bühnenrolle namens Alice, also über den spindeldürren Jungen und sein entspanntes, aber trotzdem energisches Gebaren, den witzigen Typen mit einem unbeschränkten Repertoire an Storys.
In dem unaufhörlichen Schwall wundervoll übertriebener Geschichten wurzelt ein Teil meiner großen Sympathie für ihn. In dieser Fähigkeit liegt der Grund, warum er die Welt mit seinem Charme verzauberte.
Vince’ offenes Wesen und seine allgemeine Zugänglichkeit verstärkten unser enges Verhältnis. Wir waren beste Freunde. Uns verband das gemeinsame Interesse am Surrealismus und der Pop Art. Dadurch wirkten Vince und ich sogar so untrennbar, dass die Leute kaum über uns als Individuen sprachen, sondern uns als Gemeinschaft anerkannten.
Auch die Mädchen mochten uns, obwohl Vince und ich hinsichtlich des weiblichen Geschlechts verdammt schüchtern waren. Meine Wenigkeit verhielt sich damals mitleidserregend verklemmt. Als introvertierter Mensch schloss ich Freundschaften über andere. Dennoch wurde ich in die Kategorie „Netteste Persönlichkeit“ gewählt und stehe seitdem im Cortez-Highschool-Jahrbuch 1965. Allerdings fiel es mir schwer, das nachzuvollziehen, denn ich fühlte mich nie so beliebt. Ich bin mir sicher, dass der Football-Quarterback sich seitdem vor Verwunderung immer noch am Helm kratzt.
Im Kunstkurs schmiedeten Vince und ich Pläne für die Revolution. Wir saßen weit hinten und redeten leise über Künstler und Kunststile. Eines Tages zeigte mir Vince das berühmte Magritte-Gemälde von dem Geschäftsmann, dessen Gesicht von einem Apfel verdeckt wird. Jetzt ist mir klar, wie sehr das Werk Vince’ Stil der Darstellung schräger Charakter-Porträts beeinflusste. Doch es war auch gut möglich, dass wir uns in der nächsten Sekunde über den neusten Hit unterhielten, wie zum Beispiel „Surfin’ Safari“.
Ich stand auf Hot Rods, während Vince sportliche Autos favorisierte wie Volkswagens Karmannn Ghia. Egal, welches Traumauto man fahren würde, wir stimmten in einem Punkt überein: Auf dem Beifahrersitz musste Brigitte Bardot sitzen und diese spitz zulaufende Harlekin-Sonnenbrille sowie ein mit Punkten getupftes Kleid tragen, wobei ihre blonden Haare in der lauen Brise wehten.
Vince’ Redeschwall war von Fernsehreferenzen durchzogen. Er schaute alles: The Steve Allen Show, Twilight Zone – Unwahrscheinliche Geschichten, The Ernie Kovacs Show, Peter Gunn, die Serie Die Unbestechlichen, Ozzie and Harriet, The Andy Griffith Show, Meine drei Söhne und die Dick Van Dyke Show. Wenn das Programm um 22 Uhr endete, kam zuerst das Testbild eines Indianerhäuptlings, wonach man auf den verschneiten Bildschirm starrte. Vince behauptete, er sehe sich sogar das Testbild an.
An besagtem Tag im Kunstkurs wurden wir jäh in die Realität zurückbefördert, da wir die hinter uns lauernde Mrs. Sloan bemerkten.
„Ich hoffe, ich störe euch beide nicht“, grinste sie und stöpselte dabei einen tragbaren Plattenspieler ein. „Ihr beide denkt, ihr seid so hip. Ich möchte, dass ihr ruhig sitzt – falls das möglich ist – und euch das hier anhört.“
Sie reichte Vince ein Cover, auf dem ein Bohème-Pärchen mitten über die Straße einer verschneiten Stadt schlenderte. Der Typ schien gerade eine Runde „Taschen-Billard“ zu spielen, während sich das Mädchen bei ihm untergehakt hatte. Der Titel des Albums lautete The Freewheelin’ Bob Dylan.
Mrs. Sloan setzte die Nadel auf die Platte auf, und wir hörten eine angeschlagene Akustik-Gitarre und eine froschähnliche Stimme, die sozial bedeutende Fragen ansprach.
Wir hatten niemals zuvor so eine Ernsthaftigkeit in einem Song wahrgenommen. Vince lachte über die Stimme des Sängers, gab jedoch zu, dass es sich anscheinend um etwas Wichtiges handle.
Außerdem mussten wir uns geschlagen geben, denn unsere Kunstlehrerin hatte uns in puncto Coolness übertrumpft.
Nach all den Jahren trifft mich die Erkenntnis wie ein Blitz, dass diese Frau uns aus der Balance warf und auf einen recht eigentümlichen und wirren Pfad lenkte.
Mrs. Sloan war unbarmherzig und direkt. So eine Frau gab ihren Schülern keinen wohlwollenden und aufmunternden Klaps auf den Hinterkopf. Sie zeigte uns in aller Deutlichkeit, dass wir nicht unser volles Potenzial ausschöpften. Möglicherweise ließ sie sich gar nicht von unseren Stunts beeindrucken. Einmal kehrte Vince von der Toilette zurück, hatte sich von Kopf bis Fuß in Toilettenpapier eingewickelt und wankte wie eine unheimliche Mumie in die Klasse, die in schallendes Gelächter ausbrach. Mrs. Sloan nahm sich in aller Seelenruhe eine auf dem Tisch stehende Karaffe mit Eiswasser, schüttete sie ihm über den Kopf und meinte lapidar: „Touché!“
Den Rest des Tages fielen Streifen nassen Toilettenpapiers von Vince ab, der damit seinen Ruf als schick gekleideter Junge eingebüßt hatte. Aber auch Mrs. Sloan brachte einige Stunts. Eines Tages präsentierte sie der Klasse eine schwarze Tasche. „Stellt euch vor, ihr seid stockblind“, sagte sie und erklärte uns, wir sollten in die Tasche fassen, den Inhalt ertasten und dann unsere Empfindungen in einer Zeichnung ausdrücken.
Vince tastete sich behutsam vor und riss die Hand blitzschnell zurück: „Wow, was ist das?“, fragte er angeekelt. Er streckte die Hand von sich ab, als sei sie kontaminiert.
Ich starrte dann auf meine Hand, die in der Tasche verschwand. Booaah! Was sich auch immer darin befand, war verdammt eklig. Es fühlte sich wie getrocknetes Leder an, hatte ein verdrehtes Rückgrat, einen Schwanz und einen Kopf mit messerscharfen Zähnen.
Die Schüler ließen einer nach dem anderen das fiese Ritual über sich ergehen, während Mrs. Sloan wie die sprichwörtliche Cheshire-Katze grinsend auf dem Stuhl thronte.
Erst am nächsten Tag – wir hatte alle unsere Interpretationen auf Papier festgehalten – zog sie das Objekt unseres Horrors hervor.
„Es ist ein getrockneter Teufelsfisch aus dem Golf von Mexiko“, erklärte sie mit einem strahlenden Gesichtsausdruck und konfrontierte uns mit dem labberigen Ding.
Diane Holloways Arm schoss in die Höhe: „Darf ich mir die Hände waschen?“, bettelte sie. Von einer Sekunde auf die andere standen alle Mädchen am Handwaschbecken. Glauben Sie, dass dieses Experiment spurlos an Vince und mir vorüberging? Glauben Sie das tatsächlich?
Vince mochte das Zeichnen. Seine Charakter-Skizzen stellten eine Gemengelage aus Magritte, Peter Gunn und dem Mad-Magazin dar. Die Figuren waren stark stilisiert und ähnelten ihm häufig. Manchmal trat er als Beatnik auf, woraufhin man beinahe einen begleitenden Bongo-Rhythmus vor seinem „geistigen Ohr“ hörte.
Meine eigenen Bilder zeichneten sich durch eine großzügige farbige Pinselführung aus. Meist erkannte man kein konkretes Thema. Ich mochte es, mir freien Lauf zu lassen. Die Auswüchse meiner künstlerischen Orgasmen glichen einer Explosion in einer Schal-Fabrik.
Mrs. Sloans Malstil war auf eine bestimmte Art sehr lebendig, und so ließ ich mich von ihr denn anleiten. Eines Tages sah ich sie vor meiner Leinwand stehen. In nervenaufreibender Stille rieb sie sich mit der Hand am Kinn. Schließlich drehte sie sich um und urteilte: „Wenn alles schreit, schreit nichts mehr.“
Der Kommentar verwirrte mich einige Tage lang. Doch als mein Pinsel das nächste Mal über die Leinwand strich, erlaubte ich den Schreien Stille zum Verklingen.
Das sind die kleinen Lektionen, die man im Leben lernt. Den Ratschlag übertrugen Vince und ich später auf Songstrukturen, die Reihenfolge der Song auf den Alben, das Live-Programm und die Inszenierung der Bühnenpräsentation.
Ein weiteres Element von Mrs. Sloans Weisheit leitete sich von ihrer Methode ab, einen neuen und möglichst unvoreingenommenen Blickwinkel bei einer problematischen Bildkomposition einzunehmen. „Haltet das Bild vor einen Spiegel“, erklärte sie. „Manchmal zeigt sich dann das fehlende Gleichgewicht der Arbeit.“ Sie erläuterte uns, dass sich die Problematik einer malerischen Komposition dem Künstler zunehmend verberge, da sich die Wahrnehmung an Missverhältnisse gewöhne, wodurch man die Objektivität verliere.
Das war eine zusätzliche Lektion fürs Leben, die wir auch in der Welt der Musik anwendeten. Wenn man einen Song schreibt und er problematisch anmutet oder man nicht weiterkommt, sollte man ihn auf einem anderen Instrument spielen, durch einen winzigen Lautsprecher plärren lassen, ihn in umgekehrter Harmoniefolge testen und ihn dann mit unvoreingenommenen Ohren hören.
In jenem Jahr beeinflusste der Film West Side Story den Kleidungsstil von Vince und mir. Wir legten uns weiße Sneaker zu und verschmierten sie mit Dreck, als hätten wir entweder bei den Sharks oder den Jets einsteigen wollen. Eines Nachts versteckten wir uns hinter einem Gebüsch am Ende meines Blocks. Als sich ein Auto näherte, sprangen wir hervor und täuschten eine Schlägerei vor. Der Wagen fuhr mit schneller Geschwindigkeit davon, und wir ließen lachend die Handknöchel knacken, überzeugt, dass unsere kleine Aufführung den Fahrer zu Tode geängstigt hatte.
Kleine Streiche wie dieser zählten zu den Highlights unserer trostlosen Existenz. Wir waren keine kalifornischen Surfer. Unser Sexualleben beschränkte sich – mit etwas Glück – auf die Seiten des Playboy. Doch wir wussten, dass da draußen mehr war. Vince erkannte die Vorzeichen.
Die täglichen Gespräche ähnelten einem bunten Flohmarkt aus Popkultur-Ergüssen, vorgebracht mit fachwissenschaftlichen Termini, und Diskussionen zur Musik, wobei Letztere einen zunehmend höheren Stellenwert einnahmen.
Hinsichtlich der Musik hatte ich schon drei bedeutende Schlüsselerlebnisse hinter mir. An einem brütend heißen Tag mit fast 40 Grad Celsius in Phoenix, dem „Tal der Sonne“, wurden mir die Augen (und die Ohren) geöffnet. Ich saß zufrieden auf dem Balkon eines Kinos mit Klimaanlage, ließ mir das Popcorn schmecken und zog mir eine Doppelvorstellung von Peter Pan und Herkules und die Königin der Amazonen rein. Während der Pause schloss sich der rote Vorhang, und einige Typen bauten ein Schlagzeug und Verstärker auf der schmalen Bühne auf. Dann klopfte der Ansager gegen das Mikrofon.
„Und nun“, rief er, „präsentiert das Fox Theater voller Stolz (quiiiietsch – Rückkopplung!) Duane Eddy and the Rebels aus unser Stadt.“
Plötzlich füllte sich der Raum mit dem elektrifizierenden Sound des Twang-Meisters persönlich. Der Begriff „Twang“ wird immer benutzt, um Duane Eddys tiefen, mit einem Vibrato-Arm modulierten Sound zu beschreiben, kann aber nicht den mächtigen Donnersturm einfangen, den er mit Hits wie „Rebel Rouser“ und „Forty Miles Of Bad Road“ auf den Hörer losließ. Man muss wissen, dass das viele Jahre vor Acid Rock oder Heavy Metal stattfand. Duane Eddy war einer der ersten wichtigen Vertreter des brettharten und lustvollen Gitarren-Sounds. Musiker wie Duane Eddy, Link Wray und Bo Diddley legten schon früh das Fundament für kommende Musikergenerationen.
Duane Eddy – schon sein Name klang wie ein Gitarren-Lick – stolzierte von der einen auf die andere Seite der Bühne, während sein sich die Seele aus dem Leib spielender Saxophonist den entgegengesetzten Weg nahm. „Los, packt sie euch!“, brüllte der Drummer. „Go! Go! Go!“
Ein Junge auf der gegenüberliegenden Seite des Balkons krakeelte ein markerschütterndes „Hiiii-ya!“ Die Rebels rockten ihre drei Instrumental-Hits, winkten uns dann wie Helden zu und verschwanden hinter dem Vorhang.
Anschließend begann der Herkules-Film, mit all den Szenen von Muskelprotzen, die sich aus Ketten befreiten. Für mich hatte der Streifen keine Chance gegen die Echos der Twang-Gitarre, die immer noch in meinem nun erleuchteten Kopf hin- und herbangten. Was ich auch immer von dem Kinoabend erwartet hatte, war wie weggeblasen. Phoenix – Stadt der neuen Wege.
Doch ich hatte Musik schon vor dem Duane-Eddy-Konzert als ein großartiges Erlebnis wahrgenommen, das unbegrenzten Spaß versprach. Als kleiner Junge – damals wohnte ich noch in Creswell, Oregon – lauschte ich schon den Klängen meines Dads, der Familie und von Freunden, die in den Abendstunden musizierten. Sie liebten den alten, traditionellen Country, mit authentischer Geige und dem Gitarren-Picking, zu denen alle eine Art selbstgedichteter Texte sangen.
Man verstreute Salz über Großmutters Holzfußboden, damit die Schuhe beim Tanzen des Two Step ein kratzendes Geräusch hinterließen. Einige der Frauenzimmer runzelten die Stirn bei dem Gelage, doch als es später wurde, erkannte man mühelos, wer sich einige Schlückchen runtergespült hatte. Die Männer waren voll wie die Haubitzen und stritten sich darüber, wer den Frauen gerade schöne Augen machte. Ich fühlte mich wie gebannt.
Die Lust. Sie ist doch am wichtigsten, oder? Natürlich war Elvis der Anführer der Rock’n’Roll-Lüsternheit. Als Kind beobachtete ich meine Babysitterin, die jedes Mal unglaublich scharf wurde, wenn sie den King hörte. Ich erlebte das mit heruntergefallener Kinnlade. Meist tauchten dann ihre Freundinnen mit der neusten Scheibe auf, und sie tanzten den Dirty Bop mit wehenden Pudelröcken, diesen Faltenröcken mit einem aufgestickten „Pudel“.
Beim Dirty Bop wurden einige anzügliche Beckenbewegungen in die Choreographie integriert, woraufhin man ihn natürlich im ganzen Land zensierte. Von einem ortsansässigen Rowdy hatte ich eine interessante Geschichte gehört: Er polierte ständig seinen schwarzen 53er-Ford mit der gemalten Aufschrift „C.C. Rider“ auf dem Kotflügel. „Mädchen“, steckte er mir im vertraulichen Ton, „tragen keine Höschen beim Dirty Bop.“ Mit Stilaugen musste ich schleunigst herausfinden, ob das stimmte.
Bislang hatte ich all die Versuchungen nur lüstern aus der Ferne erlebt, aber dann geschah es: in der achten Klasse. Washington Elementary School. Ein Lehrer gab bekannt, dass die Zeit für den Spotlight Dance gekommen sei, der ersten Tanzveranstaltung für Teenager. Ich sollte ihn eröffnen, was mir einen verdammten Schock versetzte. Noch erstaunlicher war die Ankündigung, dass meine Tanzpartnerin eine nette junge Dame namens Sharon sein würde. Sharon? Die Sharon? Dank ihrer aufblühenden Figur hatte ich sie schon längst bemerkt. Sharon brachte die Keimdrüsen sämtlicher Jungen auf allen Schulfluren zum Überkochen.
Sie schwebte unter dem grellen Spotlight auf mich zu, presste ihre gottgegebenen Vorzüge an meine Brust und führte mich über den Tanzboden innerhalb eines Kreises aus Gaffern. Sie tanzte wesentlich langsamer als die Tempovorgabe durch die Musik.
„In The Still Of The Night“ von den Five Satins verzauberte mein Herz, während der reine Duft ihrer gestärkten Bluse mich paralysierte und in eine himmlischen Trance versetzte. Plötzlich wurde aus meinem Schlaffen ein Knallharter. Oh nein! Nicht das! Nicht hier! Und nicht jetzt!
Voller Verzweiflung versuchte ich an etwas anderes zu denken: Zum Beispiel an die Autounfälle in den Lehrfilmen des Automobilclubs. Als ich mich abplagte, das „Holz aus der Hölle“ niederzuringen, endete der Song. Die glorreiche Frau nahm den Arm von meiner Schulter, flüsterte ein „Dankeschön“ und ließ mich mit weichen Knien stehen. Langsam bemerkte ich das Starren der geifernden Freunde. So entstand also die Analogie Musik = Sexualkraft.
In der Rangfolge der Coolness lagen Langstreckenläufer weit abgeschlagen hinter Baseball-Spielern und Ringkämpfern. Doch John, Vince und ich lernten den Wert und die Vorzüge kennen, Teil eines Teams zu sein. Wir mühten uns mit den gleichen Qualen ab – zogen Kakteennadeln aus den Füßen, schwitzten ungemein, stanken wie die Hölle und übergaben uns sogar gemeinsam. Voller Stolz nannten wir uns „The Pack“.
Als Vince und John auch beim Tip Sheet mitmachten, war es nur normal, dass das Langstreckenteam redaktionell all die Anerkennung bekam, die es sich so mühevoll erkämpft hatte.
Trotzdem darf man uns nicht als Hochstapler bezeichnen. The Pack stellte einen Saison-Rekord von neun Siegen und keiner Niederlage auf. Wir gewannen die Division II Cross-Country Championships. Zum Ende der Saison kamen wir auf über 450 gelaufene Meilen. Und ich stellte sogar einen Rekord für den 20-Meilen-Lauf auf, der noch Jahre nach meinem Abgang unerreicht blieb.
Was als Nächstes geschah, ähnelt einem ekligen Highschool-Streich, doch durch das Ereignis kamen die Räder ins Rollen, die uns in die glorreiche Zeit und die Gefilde der Verrufenheit beförderten.
Dank unserer Heldentaten als Geländeläufer qualifizierten John, Vince und ich uns für die Aufnahme in den Lettermen’s Club. Die Mitgliedschaft in so einer prestigeträchtigen Organisation wurde keinesfalls automatisch gestattet. Wir waren also verdammt nervös wegen der damit einhergehenden widerlichen Streiche, von denen man immer hörte.
Möglicherweise wurde man mitten in der Wüste abgesetzt (nackt), mit nur einer Wahlmöglichkeit, was man auf dem strapaziösen Rückweg tragen durfte – Schuhe oder ein Suspensorium.
Vielleicht musste man sogar aus einem nicht abgezogenen Urinal trinken? (Erst später erfuhren wir, dass es sich bei dem „Urin“ um mit Lebensmittelfarbe behandeltes Wasser handelte …)
Eventuell band man dir einen Strick ans Ende der „Nudel“, wobei jeder wusste, dass er an einem Klemmbrett mit der Aufschrift „FESTE ZIEHEN“ endete. Ein Letterman platzierte dann das Brett in der Mädchenumkleide, während man draußen hinter einem Busch am langen Ende des Seils hockte und auf den schicksalsträchtigen Zugriff wartete.
Als potenzielle Opfer zitterten John, Vince und ich wie nasse Chihuahuas. Die Lettermen hatten ein ausgeprägtes Gespür für sich zuspitzende Dramen, und wir mussten wirklich einige Torturen überstehen, doch schließlich nahm man uns auf. Plötzlich waren wir die coolsten Typen in der coolsten Verbindung auf dem Campus. Dann machte ich folgenden Vorschlag: „Hey, warum sollte man nicht – so zum Spaß – eine Talent-Show veranstalten?“
Die Jungs murrten zuerst, gaben dann aber widerwillig nach. Denn zu unserer Überraschung kamen die anderen Clubs der Schule auf so viele beeindruckende Ideen, dass wir plötzlich in der Gefahr schwebten, von ihnen ausgestochen zu werden. Ein Notfalltreffen wurde einberufen.
„Erklär ihnen deine Idee, Dunaway“, drängte John Speer.
„Wir haben ja nicht viel Zeit“, schnitt ich das Problem an. „Wie wäre es da mit einer Überraschung. Vielleicht könnte man irgend so eine Verarsche abziehen. So eine Show, bei der wir die Beatles hochnehmen und veralbern.“
Ich trug meine Idee vor, als hätte mich die Inspiration gerade wie ein Blitz erwischt, doch das gehörte alles zu meinem Plan. Ich hatte Duane Eddy and the Rebels gesehen. Seitdem wusste ich, was man für einen Tumult auf der Bühne abziehen konnte. Von John durfte ich keine große Hilfe erwarten, doch Vince unterstützte mich.
Die Verbindungsleute waren schnell überzeugt, denn sie mochten die Vorstellung, einen Joke auf Kosten der langhaarigen Beatles zu reißen. Es war zu Beginn des Jahres 1964, und die Fab Four durchquerten die USA und räuberten wie eine Gang auf der Spritztour mit einem geklauten Auto. Nach der Abstimmung ernannten sie Vince, John und mich zu den Organisatoren des Auftritts. Die älteren Schüler schauten skeptisch und drohend auf uns herab und rieten uns, bloß gut genug zu sein.
Ich muss zugeben, dass der Gruppe beim Versuch, die Beatles zu kopieren, einige entscheidende Fähigkeiten fehlten. Bis zu dem Zeitpunkt hatte sich unser Talent auf das Trällern einiger Beatles-Stücke bei Langläufen beschränkt. Um die Langeweile zu unterbrechen, sangen wir eigene Texte: „I’ll beat you/Yeah, yeah, yeah.“
Doch zuerst gingen wir nun mutig zu Woolworth und kauften uns wuschelig wirkende Beatles-Perücken. Danach lieh ich mir die Gitarre von Dad, und Vince schnappte sich die Ukulele seines Vaters. Natürlich beherrschten wir die Instrumente nicht.
Während der folgenden Wochen nahmen uns verschiedene bullige Lettermen auf dem Flur zur Seite und erklärten unmissverständlich, wie sehr unsere zukünftige Gesundheit von dem Erfolg abhänge.
Ja, wir brauchten nun dringendst jemanden, der ein Instrument spielen konnte. Wir mussten den merkwürdigen Einzelgänger aus dem Fotografie-Kurs ansprechen. Er war einer dieser Typen, der gerne in der Dunkelkammer abhing, da er wusste, dass kein Lehrer reinkäme, wenn draußen das Rotlicht brannte. Somit hatte er genügend Zeit, um einige Züge an der Kippe zu machen – und allein zu sein.
Er hieß Buxton. Eines Tages drängten Vince und ich Buxton in eine Ecke und stellten uns vor.
„Alles klar?“, fragte er und reichte uns beiden die Hand. „Glen.“
Für einen Wüstenbewohner hatte Glen eine ungewöhnlich blasse Hautfarbe. Obwohl er dünn und schmächtig war, wirkte er aber wie ein harter Typ. Bei seinen herabfallenden Haaren erkannte man am Hinterkopf den Versuch eines Elvis-Entenschwanzes. Auf der Nase trug er eine dicke Hornbrille im Buddy-Holly-Stil, die auf Schläger wie die Einladung zur Attacke wirkte. Das Haar, die Körperhaltung, das Aussehen und die Einstellung – ich glaube, er hatte das von James Deans Rolle in … denn sie wissen nicht, was sie tun. Dank des Ignorierens von „Attraktivitäts-Klischees“ wirkte Glen furchtlos.
„Wir haben gehört, dass du eine Gitarre hast“, eröffnete ich das Gespräch.
„Yeah, eine Epiphone Halbakustik.“
Das klang schon mal besser als die Klampfe Dads. Wir erzählten ihm von unserem Talentwettbewerb und der Suche nach einem Gitarristen.
„Na klar“, entgegnete er. „Ich werde es mal versuchen.“
Am nächsten Tag trafen wir ihn im Kurs. Er saß an seinem Tisch, zu seinen Füßen ein brauner Gitarrenkoffer.
„Hey, wie geht’s so? Ich habe die Gitarre mitgebracht.“ Er kniete sich hin und öffnete die Metallverriegelungen. Als er den Deckel hochhob, sahen wir sie – eine wunderschöne helle Gitarre in Sunburst, die in dem mit Samt ausgekleideten Koffer ruhte.
Wir fragten, ob er den Beatles-Song „Please Please Me“ kenne.
Glen nahm die Gitarre hoch und begann, die Akkorde zu schrubben.
Mit leisen, schüchternen Stimmen sangen Vince und ich: „Last night I ran four laps for myyy coach …“
Glen war ähnlich weit von einer Aufnahme bei den Lettermen entfernt wie von seiner Heimatstadt Akron, Ohio. Er fand die Idee mit den Beatles cool, wollte aber nur die Rolle des Mitläufers spielen. Abgesehen von den Beatles-Perücken gehörten die schwarzen Cortez-High-Letterman-Jacken zur Garderobe. Obwohl Glen das als nicht sonderlich originell empfand, stand er auf den Gedanken, in einem Outfit aufzutreten, das ihm niemand zutraute.
Eine Tages frohlockte er: „Ich kenne einen Typen, der Rhythmus-Gitarre spielt. Er kann auch Bier besorgen.“
Vince und mir war das mit dem Bier egal, doch die Vorstellung zusätzlicher „musikalischer Munition“ klang großartig.
John Tatum war der zweite Gitarrist, ein selbstbewusster, gutaussehender Typ, der eine Menge Gitarren-Akkorde kannte. Seine blonden Haare ähnelten der Frisur Glens. Beide waren so stolz darauf, dass sie sich weigerten, die Beatles-Perücken zu tragen.
Glen wartete jedoch mit einem Styling-Tipp auf. Er reichte Vince eine Sonnenbrille und sagte: „Wir müssen unbedingt Sonnenbrillen tragen. Mit der richtigen Einstellung wirkst du dann viel zu cool für die Schule.“
Vince und ich fanden zudem den Letterman Phil Wheeler, der ein Schlagzeug besaß und sogar einige Stunden Unterricht genommen hatte. Wir baten ihn, auszuhelfen.
„Das kann ich machen, aber ohne Perücke! Ich werde alles schlicht halten und benutze nur eine Snare und ein Becken.“
Egal. Hauptsache, wir hatten einen Drummer.
Bei den Geländeläufen brachten wir John die Texte bei. Die Liste der verfälschten Beatles-Stücke war recht kurz. Aus „She Loves You“ wurde „I’ll Beat You“. Dann gab es noch „Please Beat Me“ zur Musik von „Please Please Me“. (Last night I ran four laps for myyy coach/He said I didn’t even tryyy much.)
Als ich den Song „Foot Stompin’“ erwähnte, einen Hit der R’n’B-Gruppe Flares, den ich sehr mochte, zuckte Glen bloß mit den Achseln.
„Kinderleicht. Das ist nur eine Abfolge mit drei Akkorden.“ Tja, er hätte mir genauso gut E = mc2 erklären können. Doch als er mit der Begleitung begann, sangen wir einfach mit. Dann wünschte sich Vince, den knalligen Contours-Hit „Do You Love Me (Now That I Can Dance)“ zu spielen. Ohne mit der Wimper zu zucken, schaffte sich Glen die Nummer drauf. Klasse! Nun hatten wir zwei zusätzliche Songs.
In der Geschichte des Rock’n’Roll tauchen einige Band mit Insektennamen auf: zum Beispiel Buddy Hollys Crickets und die Beetles, natürlich mit einem a. Ich schlug das fieseste Insekt vor: den Ohrwurm, und das im Plural, also Earwigs. Es ist ein sich windendes kleines Insekt, mit Zangen am Schwanz. Jeder, der in der Wüste kampierte, fürchtete sich davor, dass ihm eins der Ungeheuer ins Ohr kriecht und dann für immer in seinem Gehirn hängt. Aber ist das nur ein Gerücht, denn die Viecher sind harmlos.
„Und wenn du drauflatschst, stinken die voll widerlich“, ekelte sich Glen. „Mit denen kannste nix anfangen.“
Ich mochte die Idee, dass die Earwigs Perücken [engl.: wigs] trugen. Schien logisch zu sein. Und so wurden wir die Earwigs, für uns ein exzellenter Rock’n’Roll-Name.
Dann war es so weit. Endlich konnte der als Überraschung geplante Lettermen-Talentwettbewerb starten. Es war mal wieder ein typisch heißer Abend im „Cafetorium“ der Cortez, einer Kombination aus Cafeteria und Auditorium. Vom Backstage-Bereich aus beobachteten wir nervös die Auftritte der von purpurnen Spotlights angestrahlten Gruppen. In jenem Jahr stand ein Hauch von internationaler Musik im Mittelpunkt. Man führte einen philippinischen Tanz auf sowie Musik aus Spanien und Frankreich. Auch drei Lehrer versammelten sich unter dem Banner der Singer/Songwriter und gaben einen Anti-Atombomben-Song zum Besten.
Schließlich fiel der Vorhang, woraufhin Phil Wheeler in aller Eile das Schlagzeug aufbaute. Als sich Vince, John und ich die Perücken und die Sonnenbrillen aufsetzten, hörten wir drei Mädchen vom Pep-Club, die sich einen abkicherten und mit den Fingern auf uns zeigten. Vince schnappte sich die Ukulele; John und ich posierten mit den Gitarren.
„Und nun kommt eine besondere Überraschung“, hörte ich die Ansage durch das Mikrofon. Wir klopften die Füße im Takt des ersten Songs. „Direkt aus Cesspool, England! The Earwigs!“
Der Vorhang öffnete sich, und wir starrten in ein Meer verblüffter Gesichter. John Tatum unterstützte Glen bei seinem brettharten Gitarrenspiel, und alle sangen die umgeschriebenen Texte: „Listen to my track shoes/Stomping all over you …“
Über die Strahler der Direktbeleuchtung hinweg erkannte ich die Gesichter von Freunden, Lehrern und Eltern, die sich alle vor Lachen bogen. Sogar der Hund des Hausmeisters schien zu lachen.
In der Hochstimmung des Augenblicks dachten wir nicht im Entferntesten daran, dämlich auszusehen. Die lauten Gitarren, das Schlagzeug und unsere Stimmen donnerten über die Lautsprecher und elektrifizierten uns emotional, ein unglaubliches, kaum zu beschreibendes Gefühl.
Die ganze Band rockte, stampfte mit den Füßen auf und sprang durch die Gegend, als wüssten wir, wie man das macht. Die Zuschauer da draußen waren sprachlos, aber auch gut unterhalten.
Die Beatles machten am Ende jedes Konzerts eine tiefe Verbeugung, eine Art Markenzeichen. Als Earwigs verwandelten wir das natürlich in eine alberne Geste.
Der Vorhang schloss sich. Von draußen hörte man die tobenden und applaudierenden Zuschauer aus dem Cafetorium. Wir sahen uns schockiert an. Diese Ekstase – die hatten wir ausgelöst. Das Ganze war viel besser gelaufen, als man sich je hätte vorstellen können.
Mrs. Axelrod, unsere Chemie-Lehrerin, huschte auf uns zu und schwärmte: „Ihr Jungs müsstet in der Ed Sullivan Show sein!“
Dieser Ohrwurm hatte uns gebissen, mit dem Fieber des Entertainments infiziert und klammerte sich nun am Gehirn fest. Wie das „todbringende“ Insekt setzte er sich dort für alle Ewigkeit fest.
Unsere verruchte Reputation überdauerte die nächsten Wochen. Natürlich bliesen wir den Auftritt durch eine Titelstory in der nächsten Ausgabe des Tip Sheet auf, ergänzt durch eine gefälschte/humorvolle Story über die frühen Tage in Cesspool, Großbritannien.
Die Popularität der Earwigs schoss schon bald zu den Sternen. Football-Spieler mussten mürrisch anerkennen, dass wir nun zur selben Attraktivitäts-Spezies gehörten. Die Lehrer begrüßten uns mit einem anerkennenden Nicken, doch es gab noch einen größeren Schoooock: Mädchen lächelten uns tatsächlich an!
Lächelnde Mädchen. Sie sind die hocheffektiven Atomkraftwerke, die jeden Rockmusiker mit Energie versorgen, für einen Stromstoß sorgen, der ihn vom Boden des Wohnzimmers zu höheren Gefilden katapultiert. „Das Mädchen da hinten – sie sah mich eben so nett an …“
Über Nacht waren wir berühmter geworden als das beliebte Automodell Edsel von Ford.
Doch Moment mal – wir waren doch gar keine richtige Band, oder doch? Vince und ich dachten da nicht lange nach. Klar waren wir eine richtige Band, verdammt noch mal. Auch John Speer wollte das Spielchen fortsetzen. Schönling Phil Wheeler muckte nicht in einer albernen Combo, um an Mädels zu kommen, doch fürs Erste wollte er ebenfalls bei der Fake-Truppe mitmachen, einfach so aus Spaß. Allerdings mussten wir Einiges an Überzeugungsarbeit leisten, um die beiden „echten“ Musiker Glen und John – „das coole Duo“ – zum Einstieg in eine Täuscherband zu überreden. Nach der Schule ging ich auf Glen zu und fragte, ob er mitmachen wolle.
„Na, klar! Willst du morgen zu mir kommen? Wir können einige Platten anhören. Bring doch deine Gitarre mit, und ich zeige dir einige Akkorde.“
Am nächsten Tag sprang ich aufs Fahrrad und folgte Glens auf einen Zettel gekritzelter Wegbeschreibung zu seinem Haus. Es lag wie auch mein Zuhause in einer Mittelschicht-Siedlung, gekennzeichnet durch einige einstöckige Beton-Blockhäuser, und war limettengrün angestrichen.
Ich klingelte. Nach langem Warten öffnete eine Frau, zweifellos Glens Mutter. Sie war dünn, wirkte jedoch keineswegs gebrechlich. Ihre Mimik vermittelte den unmissverständlichen Eindruck, dass sie keine Albernheiten durchgehen ließ. Mit meiner besten Sonntags-Stimme fragte ich säuselnd nach Glen.
„Komm rein“, meinte sie. „Er ist in seinem Zimmer.“ Sie deutete auf das Ende des Flurs und verschwand in der Küche. Ich hatte das Gefühl, gerade einem Bewährungshelfer aus einem B-Movie über missratene Jugendliche begegnet zu sein, und klopfte schnell an Glens Tür. Aus der Küche hörte ich Mrs. Buxtons Stimme: „Geh rein. Er ist da.“
Langsam öffnete ich die Tür. Durch die mit Aluminiumfolie abgedeckten Fenster in dem Zimmer fielen nur stecknadelgroße Sonnenstrahlen. Ich stolperte über das Kabel einer Tischlampe. Die schwache, orange angemalte Glühbirne erleuchtete den Raum nur spärlich und sorgte für eine Begräbnis-ähnliche Atmosphäre. Mich beschlich das Gefühl, wieder in der Dunkelkammer der Schule zu stehen. Als sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, schaute ich mich um. Was war er wohl für ein Höhlenbewohner?
Auf dem Boden lagen verstreut Ausgaben der TV Issue, ein Gitarrenkoffer und die Überreste verschiedener Elektrogeräte. Dann entdeckte ich Glens nackte Füße, die unter der Bettdecke hervorlugten. Ich blickte von dem in das Laken gehüllten Körper zu den an der Wand angebrachten Fotos von Ozzie und Harriet aus der gleichnamigen Sitcom, die nur provisorisch befestigt worden waren. Dort hing zudem ein kleineres Foto von Eddie Haskell, dem Sidekick aus Erwachsen müsste man sein. Auf Glens Gitarrenkoffer ruhte ein geöffnetes Chet-Atkins-Songbook. Auch andere Bücher lagen herum, darunter eine Biografie von W.C. Fields und eine abgenutzte Ausgabe von Der Fänger im Roggen. Auf einigen Gegenständen klebte noch das Preisschild. Später erfuhr ich den Grund dafür, denn Glen war beim Einkaufsbummel ein böser Flitzefinger.
„Glen“, versuchte ich ihn zu wecken. „Es ist Nachmittag. Wollen wir ein paar Platten hören?“
„Ohhh-ahh“, hörte ich als Antwort unter der Bettdecke. „Hau ab.“
Nach einiger Zeit der Diskussion auf höchstem intellektuellen Niveau quälte er sich aus dem Bett und latschte wie ein Zombie in die Küche. Ein Tasse schwarzen Kaffees erweckte ihn langsam zum Leben.
Nachdem Glen den Gitarrenkoffer geöffnet hatte, erhöhte sich seine Aufmerksamkeit rapide. Mit großer Liebe legte er seine Hände auf die in burgunderfarbenem Samt ruhende Epiphone. Das Stimmen des Instruments brachte mich auf eine wichtige Frage. „Welche Note ist das?“
Er schaute hoch, lächelte und erklärte mir, was er da gerade so anstellte. Seine Gesichtsfarbe hatte sich verändert, denn er wirkte ganz und gar nicht mehr blass. Nun schimmerte ein gesundes und wunderschönes Rot auf seinem Antlitz. Der Kerl liebte Musik. Mich überkam das Gefühl, einen zutiefst gläubigen Menschen in einem erhabenen religiösen Moment zu beobachten.
Er fragte mich, wo ich meine Gitarre hätte. Ich erklärte ihm, dass ich mit dem Fahrrad gekommen sei, woraufhin er mit einem Achselzucken reagierte und danach einen Plattenstapel durchwühlte.
Das war also die erste Session mit Glen. Ich kann mich nicht nur glasklar daran erinnern, weil er so ein ungewöhnlicher Mensch war, sondern auch, weil ich das Treffen als einen bedeutenden Moment in meinem Leben erkannte. Im Laufe der Jahre wiederholte sich diese kleine Szene unzählige Male.
Glen zog mich in eine reale Welt, die bislang nur in meiner Phantasie existiert hatte. Das war Glen – scheinbar verloren in einem Traumland aus zerbrochenem Kitsch, doch wiedererweckt durch das Musikmachen. Wenn er mit den Fingern Noten hervorzauberte, betrat er eine Übergangszone, in der sich sein Weltklasse-Talent zeigte.
Er warf mir einen verschwörerischen Blick zu. „Wenn Gerry fragt“, begann er, damit seine Mutter Geraldine meinend, „erzählst du ihr einfach, wir würden Hausaufgaben machen.“
„Euer Wohnzimmer sieht nett aus“, lenkte ich ab.
Er sah mich an: „Man darf aber nicht direkt auf den Möbeln sitzen. Die Plastikabdeckungen sind dazu gedacht, dass sie niemand mit dreckigen Händen berührt. Gerry kauft alles in bar. Es soll für immer und ewig halten, und somit darf niemand das Mobiliar benutzen. Meine Eltern haben die meisten Anschaffungen noch in Akron gemacht, aber sie sehen noch nigelnagelneu aus. Fliegen müssen auf der Hut sein, bevor sie sich dorthin setzen. Weißt du, was ich meine?“
Ich wusste, was er meinte, hatte jedoch noch nie jemanden so reden gehört.
Dann ging es zur Sache. Er zeigte mir die Grundlagen, die jeder Anfänger draufhaben muss: Die Namen der Noten, wo man die einzelnen Töne auf dem Griffbrett fand, wie sich ein Akkord zusammensetzte und welche Wirkung er erzielte. Glen beruhigte mich und versicherte mir, alles so oft zu wiederholen, bis ich es kapiere. Ich war inmitten von Gitarristen aufgewachsen, doch das hier stellte eine neue Erfahrung dar. Der Typ wusste, wie man rockte.
Bislang war Glen immer der Junge in der Klasse gewesen, der so wenig wie möglich machte, abgesehen von einigen Witzeleien, die er leise aus der letzten Reihe von sich gab. Doch nun hatten Vince und ich ihn entdeckt, womit er zum inneren Kreis gehörte. Glen stieg zum Hauptfotografen des Tip Sheet auf, woraufhin wir uns alle in die Dunkelkammer verdrückten und vorgaben, wir würden an einem wichtigen Foto arbeiten.
Er nahm auch am Sportunterricht teil. Seine durchgedrückten Beine ähnelten zwei Albino-Schlangen. Nach dem Kurs verhüllte er sie wieder mit der zerrissenen Jeans. Auch die Arme blitzen schneeweiß, was in Arizona so gut wie nie vorkam. Er versteckte sie immer in langärmeligen Hemden.
Beim nächsten Besuch brachte ich meine Duane-Eddy-Platte mit. Glen hörte in kürzester Zeit die Noten heraus und spielte zum Song. Dann reichte er mir die Gitarre. Ich sah, dass er ein wenig ängstlich war und befürchtete, ich würde eine Macke in den perfekten Lack hauen.
„Entspann dich“, meinte er, auf einen Bund deutend. „Das ist ein G.“ Er half mir bei der richtigen Handhaltung der Linken und erklärte mir, wie ich mit der Rechten das Plektrum halten musste. Ich fand die Bespielbarkeit der E-Gitarre deutlich einfacher als das Spiel auf der Cowboy-Klampfe von Dad, was nicht zuletzt am geringeren Abstand der Saiten zum Griffbrett lag. Innerhalb weniger Minuten hatte Glen mir das zentrale Riff von „Rebel Rouser“ beigebracht.
Langsam nahm alles Form an. Vince entschied sich zum Mundharmonika-Spiel und John Speer für das Schlagzeug. Für mich blieb der Bass übrig. Eigentlich wusste ich nicht, was ein Bass war. Auf jeden Fall konnte ich kein solches Instrument auf meinem schäbigen kleinen Plattenspieler heraushören. Ein Bass schien nicht sonderlich herauszuragen. Wenn ich nun Bass spielen musste, würde ich das Instrument aber an die vorderste Stelle bringen!
Unsere Pläne wurden von der Dringlichkeit bestimmt. Doch zuerst musste ich mir einen Bass und einen Verstärker anschaffen, was aus finanzieller Sicht einer Mammut-Aufgabe glich. Die Rettung kam nicht vom Himmel herab, sondern aus einer unerwarteten, verdammt coolen Richtung. Eines Tages reichte mir Mum einen Brief und meinte: „Hier. Lies das. Es ist von deinem Großvater.“
Auf dem Papier standen folgende Sätze in perfekter Sprache und Schrift: „Du kannst gerne bei mir und deiner Großmutter wohnen. Wir werden dich durchfüttern und grüne Bohnen anbauen. Und wenn du ein guter Arbeiter bist, gehst du mit genügend Geld nach Hause, um dir diese Bass-Gitarre zu kaufen.“
Zwischen dem üppig grünen Farmland Oregons und der sonnengebleichten Wüste Arizonas lagen Welten. Ich kannte Oregon, da ich neben der Farm meines Großvaters ausgewachsen war. Als Kids rannten mein Bruder Dean und ich mit Spielzeug-Revolvern durch seine Felder, vorgebend, wir wären plündernde und um sich schießende Cowboys. Und so fuhr ich jetzt für einen dreimonatigen Aufenthalt dorthin.
Man könnte leicht der Ansicht verfallen, dass ein sommerlicher Farmaufenthalt für jeden angehenden Rock’n’Roller wie eine Zwangseinweisung in der Hölle wirkt. Doch es war ein großartiger Sommer. Ich lernte das Traktorfahren, das Pflügen einer geraden Furche und das Hochbinden junger Triebe. Nach drei Monaten, verbracht mit dem Wuchten von Säcken mit grünen Bohnen, hatte mein Muskelumfang deutlich zugenommen. Mein dunkler, von der Sonne Arizonas gebräunter Teint, die langen Haare und die Jeansjacke mit einem aufgestickten Indianer veranlassten die anderen Arbeiter zum Irrglauben, ich sei tatsächlich ein Indianer. Ich blieb ruhig und dachte viel darüber nach, wie sich die Band entwickeln könnte.
Eines Morgens lief ich die lange, schmutzige Zufahrt zum Briefkasten an der River Road hoch. Dort fand ich einen Brief von Vince. Hastig riss ich ihn auf. Er hatte sich beim Sommerschlussverkauf ein Sharkskin-Jackett zugelegt. Momentan trainierte er täglich und legte dabei drei Meilen zurück. Er schrieb, dass er nach meiner Rückkehr gerne „Mr. Moonlight“ ausprobieren würde.
Zurück in Phoenix ging es nach nur einem Tag wieder in die Vollen. Glen begleitete mich zum Montgomery-Ward-Kaufhaus, wo wir uns die Airline-Model-Bässe ansahen. Wir standen auf dem Gang, spähten zu den Instrumenten hoch und schlugen abwechselnd die Saiten an. Mit treffsicherem Blick schaute Glen den Hals eines Basses hinunter, um die Verarbeitung und Gleichmäßigkeit zu prüfen. Zufrieden reichte er ihn mir und resümierte: „Hier ist er, Mr. Bassman.“
Mich beschlich das Gefühl, er hätte mir das Zepter gereicht, mit dem ich zum König der Welt aufsteigen würde. Schleunigst drängten wir zur Kasse, an der ich den Sommerverdienst ablieferte.
Nun fehlte noch ein Verstärker. Die göttliche Vorsehung erschien mir dann in Form meiner Kusine Glynnell, die einen gewissen Tyke geheiratet hatte, der in einer Country-Band aus Oregon Steel-Gitarre spielte. Tyke vermachte mir seinen alten Fender-Verstärker. Er war mit dem braunen Material bezogen worden, das man als „Tweed“ kannte, und schien geradezu nach erdiger und urwüchsiger Musik zu riechen.
Nun war ich ganz offiziell bereit zum Rocken!
John Speer meldete sich auf eine Anzeige in der Phoenix Gazette hin und fand auf diesem Weg ein bescheidenes, aber ordentliches Drum-Set. Vince beschaffte sich ein Tamburin, Maracas und eine Mundharmonika. Obwohl man ihn nie beim Üben „erwischte“, schien er ein gutes Rhythmusgefühl zu haben. Auch entlockte er der Mundharmonika einen intensiven, klagenden Ton.
Natürlich hätte ihn niemand gefragt, ob er einen Gitarrenkoffer oder sogar ein komplettes Schlagzeug in die Höhe wuchtet. Diese Art von Frondienst schien seine Möglichkeiten witzigerweise zu übersteigen. Darüber hinaus hatte er allein schon seine Schwierigkeiten dabei, auf den Inhalt des kleinen Instrumenten-Köfferchens zu achten. Aufgrund dieser „Unfähigkeit“ hinterließ Vince auf seinem Lebensweg eine Spur verschiedenster Gegenstände, sich darauf verlassend, dass sich andere einen krummen Rücken machten, zurückrannten und das Zeug wiederbeschafften. So lebte er nun mal. Vince war mit einer Mutter aufgewachsen, die ihn ständig als kleinen Prinzen verehrte. Diese Angewohnheit lässt sich möglicherweise auf die Kindheit zurückführen, in der man ihn nach zahlreichen Operationen überfürsorglich behandelt hatte. Deshalb wandelte er durch das Leben und verließ sich darauf, dass gewissermaßen alles, was er auf den Boden warf, wieder den Weg in seine Hände fände.
Vince hatte eine dünne nasale Stimme, doch er traf die Noten und behielt die Texte. Sein wohl größter Vorzug lag in der wundervollen geselligen Persönlichkeit, die ihn zum geborenen Frontmann machte. Er war einfach ein sympathischer Typ. Hatte er Charisma? Tja, wenn man mal über den spindeldürren Körper und den riesigen Zinken hinwegsah, erkannte man sein brennendes Verlangen, in jedem sozialen Umfeld zu unterhalten. Und das war so tief verwurzelt und verlief so gleichmäßig wie der Colorado River.
Wenn Vince mit einer seiner fantastischen Geschichten begann, wechselten Glen und ich nur einen flüchtigen Blick und wussten: „Hol die Schaufel raus, er erzählt wieder einen Mist, den man schnell untergraben muss.“ Vince spulte seine Storys ab, die mich jedoch niemals langweilten, die ich ständig hören wollte – sogar bei Wiederholungen. Er hatte durchaus Recht, denn sie verwandelten das normale und routinierte Alltagsleben. Auch interessierten uns die neuen Schlenker, die er in die alten Kamellen einbaute.
Doch auch Gespräche mit Glen hatten einen hohen Unterhaltungswert, obwohl er eher einem griesgrämigen W.C.-Fields-Charakter glich. Er empfand das Leben als so absurd, dass er nicht anders konnte, als ständige Kommentare abzulassen. Wir gewöhnten uns schnell an den Redefluss des ätzenden Spottes.
Die Earwigs verfügten über keinen eigenen Proberaum, und so benutzten wir abwechselnd die Häuser unserer Eltern. Glens Zuhause stand schnell an erster Stelle, da man sich hier über die Privatsphäre einer abgetrennten Garage freuen durfte. Allerdings gleicht eine Garage in Phoenix eher einem Heizofen, und man könnte dort seitliche Schilder anbringen: BÄCKEREI, GRILL, BARBECUE.
Glens Vater arbeitete gemeinsam mit Vince’ Daddy in einer Fabrik namens AiResearch, wo Turbolader und Ausrüstung für den Raketenbau gefertigt wurden. Mr. Buxton hegte natürlich die Hoffnung, dass Glen – bedenkt man sein Interesse an technischen Spielereien – auch eines Tages dort arbeiten würde. Die Firma schien eine deutlich hoffnungsvollere Zukunft zu bieten als eine Karriere mit den Earwigs. Doch alles, was einem Wecker oder einer Stechuhr glich, löste bei Glen eine Phobie aus, die mit Begleitsymptomen wie ausgeprägtem Ekel einhergingen. Was die Stunden des Tageslichts anbelangte, war Glen immer auf der Hut.
Wie viele jüngere Geschwister stand er im Schatten eines älteren Bruders, der schon einiges erreicht hatte. Glen beschlich das Gefühl, ständig mit Ken verglichen zu werden, einem schlauen Köpfchen – und zugleich ein in praktischen Belangen höchst geschickter Mann.
Während einer unserer verschwitzten Brutkasten-Proben öffnete sich die Garagentür, und Glens Familie kündigte einen Wochenendurlaub an.
Mrs. Buxton starrte Glen mit einem stahlharten Blick an: „Wir vertrauen dir, dass du auf das Haus Acht gibst“, forderte sie mit einem bedrohlichen Unterton. Wie schon erwähnt, sah es in Glens Haus sauber, aufgeräumt und höchst ordentlich aus. Wenn wir auch nur einen Hauch von Fehlverhalten hätten an den Tag legen wollen, so stoppte uns Mrs. Buxtons unheilvoller Gesichtsausdruck von einer auf die andere Sekunde. Man nannte ihn den „bösen Blick“.
Glen machte eine lapidare Handbewegung und antwortete: „Du musst dir überhaupt keine Sorgen machen.“
Nach einigen weiteren bedrohlichen Blicken stiegen seine Eltern in den Wagen und fuhren fort.
Glen warf einen verstohlenen Blick die Straße hinunter und frohlockte: „So, wir werden jetzt im Wohnzimmer proben!“
„Bis du wahnsinnig?“, versuchte ich einzuwerfen.
„Und wie soll ich auf das Haus aufpassen, wenn ich in der Garage bin?“
Wir marschierten also vorsichtig in das verbotene Paradies des von einer Klimaanlage gekühlten Wohnzimmers. John schnappte sich den Fußabtreter von der Haustür (mit einem aufgestickten „Welcome“) und legte ihn unter das Bass-Drum-Pedal, damit das Schmierfett nicht den hellblauen Teppich verschmutzte. Dann stöpselten wir die Instrumente in die Verstärker und legten los.
In einer kurzen Spielpause riss ich gerade einen Witz, wie wir dem „bösen Blick“ Sand in die Augen gestreut hätten – als plötzlich gespenstische Ruhe herrschte. Ich drehte mich um und schaute Mrs. Buxton direkt ins Gesicht, die mit ihrem Ausdruck einen Satanisten in die Flucht geschlagen hätte. Niemals zuvor hatte ich einen so hochroten Kopf. Ich fühlte mich, als würde mir die Haut in Streifen abpellen. Entschuldigungen flogen durch den Raum, während wir eingeschüchtert wieder zum Hochofen zurückkehrten.
Hatten seine Eltern womöglich etwas vergessen? Oder kannten sie Glen besser als gedacht? Eins war klar: Wieder einmal erwies er sich als eine große Enttäuschung.
„Ich habe mich niemals so mies gefühlt. Dabei hat sie noch nicht mal geschrien“, meinte Vince kleinlaut. „Könnten wie doch diese unheimliche Energie nutzen!“
Wir nahmen die Instrumente in die Hand und beschäftigten uns mit einigen Fassungen für den Werbeclip unseres neuen – imaginären – Produkts: die „Böser Blick“-Drops.
Vince’ Vater hingegen war ein echt cooler Typ. Er stellte das unter Beweis, indem er den ersten ernsthaften – und bezahlten – Gig für die Earwigs buchte. Zwischenzeitlich hatten wir genügend Lunchtime-Konzerte in der Cortez High gegeben, und nun war es an der Zeit, berühmt zu werden.
Die Dunes Lounge war ein halbwegs anerkannter Schuppen, der an der Straße zur Schule lag. Obwohl die Lehmziegel des Gebäudes eine Art Wüstenkarawanserei vermuten ließen, handelte es sich um eine stinknormale Kneipe, auf deren Bühne kaum mehr als fünf Musiker Platz fanden. Erstmalig spielten wir vor einem Publikum, das fliehen konnte.
Merkwürdigerweise flohen sie auch.
Der letzte übrig gebliebene Gast torkelte aus der mit „SCHEICHS“ markierten Herrentoilette. Während er sich die Hände an der Jeans trockenrieb, taumelte er Richtung Bühne, fischte fünf Dollar aus der Geldbörse und lallte ein kaum verständliches „Melancholy Baby“.
Alle Blickte richteten sich hilfesuchend auf Glen. Er zuckte mit den Achseln. Der Gast ließ die fünf Dollar auf den Boden fallen und latschte unsicheren Ganges zum Ausgang. Durch die geöffnete Tür fiel ein Schwall Sonnenlicht in einen leeren Raum.
Dann entdeckten wir den an der Bar sitzenden Mr. Furnier. Er hatte die ganze Zeit über hier gehockt und warf uns nun einen ermutigenden Blick zu.
Nach Beendigung des Programms händigte er allen die Gage aus und lächelte aufmunternd. Wir sagten ihm offen heraus, dass er ein verdammt cooler Typ sei.
Nur auf Vince’ Stirn zeigten sich Sorgenfalten: „Ich kann nicht glauben, dass es Menschen gibt, die sich tatsächlich ‚Melancholy Baby‘ wünschen. Ich dachte, dass passiert nur in Zeichentrickfilmen.“