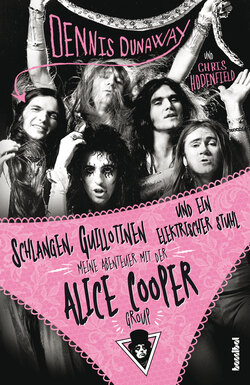Читать книгу Schlangen, Guillotinen und ein elektrischer Stuhl - Dennis Dunaway - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеTreten Sie ein: Das Rock-Theater beginnt …
Wenige Jahre später, mittlerweile waren wir die erste Band, die als Pioniere eine neue Art Bühnenshow vertraten, machten sich einige Rockkritiker über uns lustig. Sie belächelten die Theater-Darbietung von Rockmusik, hauten uns einige befremdliche Artikel um die Ohren und stellten seltsame Interpretationen an.
Was wussten wir über das Rock-Theater? Nach unserer Auffassung waren wir die Ersten, die so ein Konzept vertraten. Wir kannten die Platten (nur die Platten) von Screamin’ Jay Hawkins, dem gruseligen und mysteriösen Sänger von „I Put A Spell On You“, ahnten aber nichts von seiner Show. Auf der Bühne saß er nämlich in einem Sarg, umgeben von Voodoo-Krimskrams.
Der Ansatz des „Rock-Theaters“ (Hair, Godspell und so weiter) lag noch in der weit entfernten Zukunft, doch wir entwickelten schon eine zunehmende Tendenz, ein Spektakulum aus unseren Auftritten zu machen. Es gab drei Ereignisse, die uns etwas über die Bühnenkunst lehrten.
Inspirierender Event Nummer 1: In der Nacht des 23. Oktober 1964 spielten die Earwigs an der Cortez High bei der Halloween-Tanzveranstaltung Das Pendel des Todes!. Jemand hatte sich ganz offensichtlich von dem B-Movie-Horrorstreifen mit Vincent Price anregen lassen.
Zu diesem Anlass baute der Vater unseres Freundes Scott Ward – wir kannten ihn von der Fotografie – eine funktionierende Guillotine. Allerdings bestand das Fallbeil nicht aus Metall, sondern aus mit silbernem Lack verziertem Holz. Mr. Ward versicherte uns, dass er einige Sicherungen eingebaut habe, damit sie uns nicht die Köpfe absäble.
Die Mädels aus dem Journalismus-Kurs beauftragten wir mit dem Weben gigantischer Spinnennetze aus Wäscheleinen, die man an den Bühnenseiten anbrachte. Vince und ich bastelten einen Sarg aus Hartpappe und malten ihn in der Farbe alten Holzes an.
Inspirierender Event Nummer 2: Fernsehauftritte. Die meisten glauben, dass in den USA der frühen Sechziger alles sauber, rein und geregelt war, doch schon damals fanden sich in der Popkultur allerlei „geschmackvolle“ Absurditäten. Comedians wie Peter Sellers, Ernie Kovacs und sogar Steve Allen arbeiteten an der Grenze zum Surrealen. Auf der lokalen Ebene ging es sogar noch freakiger zu. Bevor man die Fernsehindustrie unter einem großen Hut vereinte und dabei homogenisierte, gab es im ganzen Land regionale Programme bei Lokalsendern. In Arizona war eine winzige TV-Show namens The Wallace and Ladmo Show besonders angesagt, in der sie Sketche und Zeichentrickfilme brachten. Meine Güte, sie fütterten uns täglich aus einem riesigen Kessel des Wahnsinns.
Wallace, der Normale, trug eine Beanie-Mütze mit einem Propeller. Ladmo spielte den blöden Sidekick, trug einen viel zu großen Hut und eine gepunktete Krawatte. Wallace’ und Ladmos Sketche waren überirdisch gut. Natürlich passierten einige unglaubliche Pannen – Requisiten funktionierten nicht, oder Schauspieler vergaßen den Text –, doch was mich anbelangte, konnte es bei der Show gar kein Malheur geben. Die beiden machten sich eine Katastrophe zunutze und blieben letztendlich Sieger. Im Grunde genommen wurde es noch witziger, je mehr Missgeschicke vorkamen!
Eines Tages nahm Vince seinen ganzen Mut zusammen und wählte die Nummer des Senders KPHO. Wallace nahm den Anruf höchstpersönlich entgegen. Vince erzählte ihm von den Earwigs und dass wir gerne in der Show auftreten würden.
„Na klar“, meine Wallace großzügig. „Ich werde euch mit einbeziehen.“
Während der nächsten Wochen beschäftigten wir uns nur noch mit der Vorbereitung der uns zugestandenen zwei Songs. Vince bemalte das Fell von Johns Bass-Drum. Wir trugen schwarze Rollkragenpullover und dazu passend goldene Cordsamt-Jacketts ohne Kragen. Trotzdem gelang es uns, noch gammelig auszusehen.
An dem Tag, an dem die Band das Fernsehstudio betrat, sahen wir voller Überraschung Wayne Newton. Er war ein junger Sänger aus der Gegend, der sich auf alte Standards spezialisiert hatte und uns beim Aufbau beobachtete.
„Stellt euch eng zueinander“, riet uns der zukünftige Mr. Las Vegas mit seiner samtweichen hohen Stimme. „Das hat auf dem Bildschirm eine bessere Wirkung.“ Allen war klar, dass er wusste, wovon er sprach, denn wir hatten schon die Newton Brothers bei Lew King Rangers gesehen.
Da standen wir also, vor unserer Nase die Aufzeichnungskameras, so groß wie Luftschiffe. Als sich Schweinchen Dick verabschiedete („Th-th-that’s all, folks!“) wurde uns kurz und bündig das Prozedere erklärt, und schon donnerten die nervösen Earwigs in das erste Stück. Wir waren so aufgedreht, dass die Nummer einem schnell laufenden Charlie-Chaplin-Film glich. Das zweite Stück verwirrte uns so sehr, dass wir aufhören mussten. Glücklicherweise rettete uns Vince, indem er in die Kamera winkte und „Yabbada-yabbada, that’s all, folks!“ intonierte.
Die Beleuchtung wurde abgedimmt. Unsere Herzfrequenzen näherten sich wieder dem unteren Hunderterbereich an. Wayne schritt locker-lässig an uns vorüber und sagte: „Gut aus der Affäre gezogen.“
1964. Längere Haare waren angesagt. Dadurch wurden wir für die strengeren Lehrer und ihre „Spitzel“, die Flur-Aufsichten, die uns nur allzu gerne verpetzten, zu geeigneten Angriffszielen. Jeder Typ mit langen Haaren musste ganz einfach ein Drogenfresser sein. Was noch hinzukam und die Situation verschlimmerte: Ganz Arizona schien voller mieser Typen zu stecken, denen es einzig und allein darum ging, sich an den Wochenenden bis zum Schielen volllaufen zu lassen und dann andere zu vermöbeln. Einige Langhaarige grün und blau zu schlagen, schien daher ein nettes Freizeitvergnügen zu sein.
Die Parkplätze der Teenager-Clubs verwandelten sich in regelrechte Schlachtfelder. In unserem Fall klappte es aber nicht immer mit dem blöden Anmachspruch der Cowboys: „Bist du ein Junge, oder bist du ein Mädchen?“ Einige der Typen lagen Sekunden später auf dem Boden, alle viere von sich gestreckt und mit blutigen Zähnen, während unser athletischer Freund John Tatum mit einem teuflischen Grinsen über sie gebeugt stand. Auch Glens Fäuste richteten einigen Schaden an.
Wir waren noch nicht so alt, dass uns die Eltern erlaubt hätten, diese Läden zu besuchen, hatten aber schon viel vom beliebtesten Club in Phoenix gehört, der VIP Lounge. Eines Abends tauchten wir dort unangekündigt auf und stellten uns dem Besitzer Jack Curtis vor, der sich zu einem Vorspielen überreden ließ. Jacks Stil ähnelte ganz und gar dem des höchst sympathischen Dick Clark.
Am nächsten Tag hörte er sich nur einige Stücke an und engagierte uns sofort. Doch der Bandname musste seiner Meinung nach gestrichen werden.
„Wir hätten es ohne den Namen nicht so weit gebracht“, warf Glen ein.
„Und wie wäre es mit Spiders?“, schlug Jack vor. „Das hört sich auch im Radio gut an.“
„The Spiders!“, frohlockte Vince. „Ist immer noch ein Insekt. Ich mag es.“
Jack schlug einen neuen, zum Namen passenden Bühnenaufbau vor, der „Spider Sanctum“ [dt. „Das Sanktuarium der Spinne“] heißen sollte.
„Ich habe zwar nicht die leiseste Idee, wie das aussehen soll“, sagte Jack, „doch wir werden es uns zurechtzimmern.“ Einige Tage später traf sich die Band im VIP zum Bau der großartigen Bühnendekoration. In unserem Arbeitseifer ähnelten wir einem Rudel Schimpansen. Mr. Ward, der Dad, der die Guillotine gebaut hatte, kam mit einem Transporter voller Holz. Sogar Mr. Furnier und Mr. Buxton rafften sich auf, um einige Tipps der hohen Ingenieurskunst vom Stapel zu lassen.
Ähnlich wie bei der Das Pendel des Todes!-Tanzveranstaltung auf der Cortez nutzte man Wäscheleinen zur Darstellung von Spinnenweben. Ich malte eine gigantische Spinne auf Johns Bass-Drum-Fell. Glen fand einen mit Pailletten bestickten funkelnden Teppich in verblassendem Braun, den er am Bühnenhintergrund befestigte. Er nannte ihn „Die große Scheißeritis“. Ich befestigte einige Spots in Indigo und Magenta. Wir gingen ein paar Schritte zurück und bewunderten die Höhle der Verdammnis.
Jack hatte sich zwischenzeitlich um einige Radio-Jingles gekümmert, in denen er mit einem Echo „Das Spider Sanctum-sanctum-sanctum“ ankündigte.
Zu diesem Zeitpunkt machten wir eine bedeutende musikalische Entdeckung. Glen besuchte mich und brachte das Yardbirds-Album For Your Love [Compilation mit den Gitarristen Jeff Beck und Eric Clapton] mit. Die Gitarre brachte die einzelnen Songs zum Explodieren. Schneidende Triolen unterstützten die Hauptmelodie und verschwanden mit einem Echo, als glitten sie durch einen Canyon. Glen und ich konnten es gar nicht erwarten, den anderen davon zu erzählen, entschieden uns jedoch zuerst zum Erlernen einiger Songs. Wir verbrachten den Nachmittag damit, die einzelnen Teile abzuhören, hoben die Nadel von der Vinyl, setzten sie wieder auf und spielten jeden Part so lange, bis wir ihn draufhatten. Besonders eine Nummer, ein Song von Mose Allison mit dem Titel „I’m Not Talking“, erforderte unzählige Wiederholungen.
Später, als wir Vince die Scheibe vorspielten, lernte er die Mundharmonika-Parts von Keith Relf recht zügig. Die nasalen Teenager-Stimmen der beiden ähnelten sich, ja, stimmten fast überein.
Da uns eine Gage vom Horizont aus anblinzelte, gingen wir ins Arizona Music Center und kauften neue Fender-Verstärker. Glen legte sich seine Traum-Gitarre zu, eine Gretsch Chet Atkins Tennessean, eine Halbakustik mit einem Single Cut-Out. Vince erwarb Mundharmonikas für alle Tonarten, wobei er nicht auf die schicken chromatisch angelegten abzielte, sondern auf die 3-Dollar Hohner Marine Bands, die auch Paul Butterfield benutze. Er behauptete, die Blues-Noten klängen auf billigen Harps besser. Er stand darauf, „Harps“ zu sagen.
Ich war der stolze Besitzer eines nigelnagelneuen Fender-Bassman-Amps mit zwei hochbelastbaren 12“-Lautsprechern. Der Verstärker roch sogar noch neu. Mir lief ein kalter Schauder den Rücken runter, als mir die voluminösen fetten Noten entgegenschallten. In meiner Vorstellung machte mich allein schon der Amp zu einem waschechten Profi.
Jack schwebte die Idee vor, in seinem Club Nonstop-Entertainment zu präsentieren. Für die Hauptbühne plante er Headliner wie die Byrds oder die Lovin’ Spoonful. Nach deren Auftritten musste sich das Publikum nur umdrehen und sah schon in das dunkle und düstere Spider Sanctum am anderen Ende.
Als die Premiere an einem Freitagband immer näher rückte, stellten wir uns die Ankunft in Limousinen vor. Die Realität? Stattdessen quetschten wir uns an dem Abend in einen Mercury 1956. Da wir vier Stunden zu früh aufliefen, gingen alle in den nahegelegenen Jack-in-the-Box und kauften sich eine Tüte Tacos.
Unser erster Auftritt sollte ganz und gar nicht bescheiden wirken. Jack hatte zwei Suchscheinwerfer gemietet, die er in den nächtlichen Himmel strahlen ließ. Er engagierte sogar zwei Go-Go-Girls, die in den Bühnenecken einen heißen Tanz abzogen.
Langsam füllte sich der Parkplatz. Ein knallrot lackiertes Hot Rod cruiste auf dem Asphalt. Dann kam ein Kleintransporter mit einem Surfboard auf dem Dach. Als Nächstes kreuzte ein staubiger schwarzer Pick-up auf. Aus dem Fenster ragte der Kopf eines Typen, der sich wahrscheinlich mit Whiskey hatte volllaufen lassen und nun brüllte, dass er auf eine Schlägerei aus sei.
Tja, eine ganz normale Nacht in Phoenix eben.
Einige Beamte des Maricopa County Sheriff’s Office schoben hier Dienst und waren bereit, Schlägereien aufzulösen. Zudem hielten sie die Augen nach beschlagenen Autofenstern offen, um ritterlich die Ehre (und besonders die Unschuld) junger Damen zu retten.
Der Einlass begann um 19 Uhr. Peanut Butter, eine lokale Band mit psychedelischen Anklängen, betrat die Bühne. Als sie ihr Programm mit dem Beau-Brummels-Hit „Laugh, Laugh“ beendet hatten, war das VIP bis zum Bersten gefüllt.
Die Lichter verdunkelten sich. Im Spider Sanctum glühte ein Spot. Ich zählte den ersten Song wie bei einem Pferdewettrennen an, und schon galoppierten Johns Drums davon. Die Go-Go-Girls zuckten und tanzten wie Wahnsinnige. Das Publikum drehte sich schnell um, wollte wissen, wer denn den ganzen Krawall machte.
Wir kannten einige der Gesichter, auf denen die Verblüffung über unsere Transformation geschrieben stand. Die unbeholfenen und laienhaften Earwigs gehörten der Vergangenheit an, und an ihrer Stelle stand nun eine frischere und professionellere Band auf der Bühne. Die coolen, super schicken neuen Jacketts und die uns zur Verfügung stehende Lichtanlage halfen dabei, eine selbstbewusste Show zu bringen. John und Glen hatten die blonden Haare modern gestylt – John ahmte Brian Jones von den Rolling Stones nach –, und die Spots ließen sie wie nordische Götter aussahen.
Was mein neues, mysteriöses Image anbelangte: Ich hatte mir die Haare über die Augen gekämmt. Allerdings hoffte ich nur, mysteriös zu wirken, denn ich sah überhaupt nichts mehr.
Eigentlich waren wir daran gewöhnt, von den Cops wegen der langen Haare angemacht zu werden, doch als Glen beim Yardbirds-Song „Shapes Of Things“ eine leidenschaftliche Gitarren-Arbeit ablieferte, entdeckten wir einen über beide Ohren grinsenden Police Officer, der Glen sein Lob mit hochgestreckten Daumen signalisierte. Hey, das war hier kein Cowboy-Song, sondern die kosmische Hymne für den Weltfrieden, angeheizt durch Jeff Becks brennende Gitarren-Soli, die ihn über den Umweg Jupiter direkt nach Marokko führten. Und da stand tatsächlich ein Cop, der groovte und den Sound mochte.
Nach dem Set gratulierte Jack der Band und prophezeite, dass uns eine lange Zukunft als VIP-Hausband bevorstehe. Darüber hinaus durfte die Gruppe den Club zum Proben nutzen. Am meisten freuten wir uns über die Zusage regelmäßiger Schecks.
Von da an spielten wir die VIP Lounge jeden Freitag und Samstag in Grund und Boden, und immer kam der Cop, deutete mit seinem Gummiknüppel in Richtung Glen und bestellte uns eine Runde „Shapes Of Things“.
Der Club war offiziell für 800 Personen zugelassen, doch an guten Abenden drängelten sich hier 1.000 Gäste. Nun schwammen wir in Knete, doch verdammt noch mal – alle Musiker lebten noch bei den Eltern. John Speer legte sich eine alte, spritzige Corvette zu, bei der die Lackierung schon verblasste. Vince kaufte sich einen brandneuen Ford Fairlane Convertible in knalligem Gelb. Er taufte ihn den „Chick-Pleaser“.
Doch dann geschah es: Die Blonde tauchte auf.
Das denkwürdige Ereignis trug sich beim „Back to School Bash“ auf dem Gelände der Arizona Fair zu. The Turtles traten als Headliner auf, und wir gehörten zum Haufen der lokalen Vorbands. Um die lästigen Umbaupausen zu vermeiden, verabredeten wir, dasselbe Equipment zu nutzen. Alles lief reibungslos ab, bis eine Surf-Band mit Namen Laser Beats die Bühne betrat. Die Instrumente mussten zur Seite gestellt werden, um das gigantische Schlagzeug-Podest des Drummers mit dem „güldenen“ Haar aufzubauen.
Ich fand das lächerlich, stand im Publikum und ließ einige dumme Sprüche ab. „Was für eine Knallbirne“, meckerte ich lauthals. „Wozu braucht der denn ein Schlagzeug-Podest? Damit er ‚Wipe Out‘ spielen kann?“ Um den Unmut adäquat auszudrücken, rief ich das mit einer tuntigen Stimme.
Ein vor mir stehendes Mädchen drehte sich blitzschnell um und starrte mir direkt in die Augen. Sie war wunderschön, aber unglaublich sauer. „Er ist keine Knallbirne“, blaffte sie mich an. „Er ist mein Bruder, und er ist der beste Drummer auf der ganzen Welt.“
Und so stand ich zum ersten Mal von Angesicht zu Angesicht vor Neal Smiths schöner Schwester. Sie warf mir einen vernichtenden Blick zu und drehte sich um.
Ich fühlte mich wie ein Trottel und hielt während der langen Verzögerung lieber den Mund. Endlich spielten die Laser Beats ihre Surf-Nummern. Als Neals Schlagzeug bei der Fassung von „Wipe Out“ förmlich glühte, rastete das Publikum aus.
Ich dachte unaufhörlich an die große, coole Blondine, sogar dann noch, als wir auf ihren Bruder warteten, der das Podest mühevoll auseinandernahm.
Und dann kamen wir an die Reihe. Nie zuvor waren wir auf einer größeren Bühne aufgetreten, und die Halle beeindruckte mich durch den mächtigen Sound. Erbarmungslos rockten wir fremde Hits und begannen mit einem von Rachegefühlen auf die Vorband angeheizten „Road Runner“ (Bo Diddley). Vince’ Mundharmonika entwich ein klagender und heulender Sound. In der Vorstellung sahen wir uns schon wie Popstars.
Vielleicht lag darin unsere Stärke. Nach der Show fing uns ein elektrisierter Jack Curtis am Bühnenrand ab und schwärmte: „Was es auch immer ist – ihr Jungs habt es.“
An einem heißen Abend tauchten die Yardbirds zu einem Konzert in der VIP Lounge auf. Sie mochten sehr wohl unsere persönlichen Helden gewesen sein, hatten sich jedoch noch nicht einmal landesweit durchgesetzt. Damals konnte Jack erstklassige Acts noch mühelos und zu einem annehmbaren Preis buchen.
Als Vorband begrüßten die Spiders unsere Gäste auf eine nette Art und zollten ihnen damit Respekt. Wir spielten ein Set ausschließlich aus Yardbirds-Nummern! Erst als die Yardbirds die Leute mit ihrem Programm förmlich umbliesen, kam uns der Gedanke, dass wir ein wenig trottelig gewesen waren.
Glen hatte seine Show mit einigen Neuerungen bereichert – nämlich Essbesteck mit einbezogen! Er schlug Löffel gegen die Schenkel und spielte sogar mit einem Löffel Slide-Gitarre. Jeff Beck, der Gitarrist der Yardbirds, fand die Löffel-Aktion urkomisch. Nach Ende des Sets schlich sich Beck ins Spider Sanctum und „beschlagnahmte“ Glens Besteck-Tablett. Während der Yardbirds-Show spielte Beck dann eins seiner beeindruckenden und aufwühlenden Soli. Mit der linken Hand schlug er die Noten an, während er mit der rechten Löffel unter die Saiten klemmte. Einen nach dem anderen schoss er sie dann in den Zuschauerraum.
Nach dem Konzert gingen Glen und ich in den Backstage-Bereich, wo sich ein Gespräch mit dem Yardbirds-Sänger Keith Relf entwickelte.
„Ich schätze mal, ihr hättet niemals erwartet, dass eine Band all eure Songs kennt“, prahlte ich.
„Nein, wir mussten bislang noch nie nach so einer Gruppe auftreten“, gab er zu.
„Wir mögen eure Band“, warf Glen ein. „Besonders den Gitarristen!“
Relf nickte amüsiert. „Ihr hättet mal den Kerl hören müssen, den wir vor ihm hatten.“
Glen und ich lachten, fest davon überzeugt, dass er uns auf den Arm nehmen wollte. Besser als ein Jeff Beck? Na, komm schon. Beck war wahrscheinlich der originellste, verwirrendste und kreativste Gitarrist der Welt. Erst später – als wir Cream hörten – fanden wir heraus, dass Eric Clapton seinen Durchbruch mit den Yardbirds gehabt hatte. Relf hatte uns nicht verarscht!
Die wohl größte Attacke auf meine Sinnesorgane ritt jedoch ihr Bassist Paul Samwell-Smith. Sein experimenteller Stil glich einer Offenbarung. Glen Buxton lehrte mich die ersten Noten, Bill Wyman und sein berühmtes Framus-Spiel auf den frühen Stones-Scheiben boten mir die Grundlagen hinsichtlich der Blues-Abläufe und der Songstrukturen, doch Samwell-Smiths originellen Stil zu hören, entfachte in mir das brennende Verlangen, auf dem Bass so individualistisch wie möglich zu sein.
Während der Proben und auf Minitourneen gewöhnte sich Vince zunehmend an die Rolle als Hauptsänger – und die des Leaders. Wenn wir zusammen über einen Parkplatz zu einem Taco Bell schlenderten, ging Vince immer als Erster in den Laden und gab die Bestellung auf. Es schien so, als würde der spindeldürre kleine Junge von einer anderen Person unterstützt, was dem Ruben-Lukie-Intermezzo zu Schulzeiten ähnelte.
Während der Gigs im VIP zog Vince sein Selbstvertrauen aus der Imitation der jeweiligen Sänger der Coverstücke, zum Beispiel Mick Jagger, Eric Burdon von den Animals oder Ray Davies von den Kinks. Er imitierte nicht nur die Bühnenbewegungen, sondern auch ihr Selbstbewusstsein. Ohne diesen imaginären Schutzschild blieb er bloß Vince.
Fröhliche und beschwingte Songs gefielen uns nicht, denn wir hatten einen knackigen und harten Ansatz und brachten ihn mit Faktor 5 verstärkt rüber. Der Band lag viel daran, die Menge an der Rückwand festzunageln, und das gelang uns als musikalische Einheit. Die Waffen? Verstärker, bis zum Maximum hochgejagt!
In kürzester Zeit verlängerten wir die Liste der „ersten Male“. Nicht nur hatten wir professionelle Anerkennung durch die Yardbirds erfahren, auch ging es auf die erste richtige „Tournee“. Zuerst standen drei Abende als Vorband der Byrds im VIP auf dem Plan, die wir dann bis Tucson begleiteten, wonach es zurück ins Phoenix Coliseum ging.
Die Byrds hatten einen Roadie, der einzig und allein die Verstärker aufbaute. Das beeindruckte uns. Unverzüglich ernannten wir Mike Allen, einen guten Freund, der sowieso bei den Gigs abhing, zum Equipment-Schlepper ehrenhalber. Er war ein ruhiger, eher passiver Zeitgenosse, sprang aber sofort auf den Spirit der Band an und begann, sich schräg zu kleiden, jedoch war seine Vorstellung von schräg – wie soll man es am besten ausdrücken – wirklich schräg. Er trug einen schwarzen Rollkragenpullover (von der TV-Spionageserie Solo für O.N.C.E.L. kopiert) und einen Umhang aus Samt. Darüber hinaus balancierte er ständig ein kleines Kissen auf einer Schulter. (Das musst du erst mal übertrumpfen, Mr. Salvador Dalí!) Wir nannten ihn Amp Boy.
Eines Tages im Jahr 1966 tauchte Jack bei einer Probe auf und verriet uns, eine Aufnahme-Session für die Band arrangiert zu haben. „Ihr müsst eine A-Seite und eine B-Seite aussuchen“, sagte er.
Niemand wusste, was am günstigsten war, und so drängten wir Jack zu einer Entscheidung. Er schlug den zuckersüßen Love-Song „Elusive Butterfly“ von Bob Lind vor, den man in dem Jahr ständig im Radio hörte.
Wir lachten natürlich wie die Hyänen. Jack lief hochrot an.
Als wir uns wieder beruhigt hatten und ernsthaft nachdachten, kam Vince auf die Idee, Marvin Gayes energiereichen Soul-Groover „Hitch Hike“ zu covern. Hinsichtlich der B-Seite drängte ich die anderen zur Zustimmung für „Why Don’t You Love Me“ von den Blackwells. Es war ein treibender Popsong mit heulenden Harps, und er stammte aus dem britischen Film Ferry Across The Mersey über Post-Beatles-Bands wie Gerry and the Pacemakers.
Einige Tage später standen wir im Studio, und John Speer donnerte die charakteristische Drum-Passage von „Why Don’t You Love Me“ mit unglaublicher Wucht in die Felle. Danach spielten wir die beste jemals aufgenommene Fassung von „Hitch Hike“ ein. Na ja, natürlich darf man nicht das Original von Gaye mitzählen. Und auch nicht die Coverversion der Rolling Stones. Egal, es war auf jeden Fall der beste Take, der jemals die Stadtgrenzen von Phoenix überschritt. Trotz aller Freunde und den Familien, die die Single pflichtbewusst kauften, setzte die Gruppe jedoch lediglich 200 Einheiten ab.
Zwischenzeitlich schoss „Elusive Butterfly“ auf den ersten Platz der Charts. Egal, wo man hinging – man konnte sich des Songs nicht erwehren.
Manchmal blickt man auf die dramatischen Wendungen des Lebens zurück und kommt zu dem Schluss, dass es keine Zufälle gibt. Ja, das Schicksal verpasst dir einen Schlag, wenn es das so will.
Wir kommen nun zum inspirierenden Event Nummer 3. Was die Kreation des Rock-Theaters anbelangt, fand für uns die bedeutendste Offenbarung 1966 statt. In dem Jahr debütierten wir im Phoenix Star Theater in einer Roadshow-Version des Hit-Musicals Bye Bye Birdie. Jack hatte das arrangiert, wohlwissend, dass der Beitrag zur Show unserer Popularität steigern und damit sein VIP füllen würde.
Bye Bye Birdie ist ein sentimentales, aber unterhaltsames Musical über die Verwerfungen in einer Stadt der Mittelklasse, die von einem berühmten, „gefährlichen“ und Elvis-ähnlichen Rockstar (Conrad Birdie) besucht wird. Man hatte uns die Rolle der Backup-Band zugewiesen, den Birdies. Als Star der Show trat Jan Murray als aufgebrachter Dad auf.
Wir gingen zur Probe und wurden vom Choreographen Michael Bennett ins Visier genommen. Jahre später – in den späten Siebzigern bis in die Achtziger hinein – sollten sich noch zahlreiche Möglichkeiten bieten, sich an den Typen zu erinnern, da er durch revolutionäre Shows wie A Chorus Line und Dreamgirls zum König des Broadway avancierte. Dieser dünne Kerl, der uns 1966 in Phoenix über die Bühne scheuchte, kann damals höchstes 23 Jahre alt gewesen sein, hatte jedoch das Feuer eines Menschen, der die Karriereleiter hochfällt. Damals hätte niemand ahnen können, dass er später an einem frühen Burnout leiden und an Aids versterben würde. Wir sahen ihn an und wussten augenblicklich, wer hier das Sagen hatte.
Mit seinem kurzen schwarzen Haar, der hautengen schwarzen Tanzkleidung und dem an den Nerven zerrenden Energiepegel eines New Yorkers rief uns Bennett auf die Bühne und kommandierte, dass wir uns in eine Reihe bezaubernder Tänzerinnen stellen sollten. Er zählte die Schritte aus und demonstrierte eine Drehung, was die ausgebildeten Tänzer sofort kapierten. Die Spiders bewiesen hingegen, dass die Erfahrungen als Athleten hier überhaupt nichts brachten. Wir ähnelten Steinklötzen.
„Timing! Timing!“, brüllte Bennett, dabei den Takt klatschend. Er beobachtete uns, während wir wie Weinsäufer über das Parkett torkelten, und stöhnte entsetzt: „Ihr Kerle seid Musiker?“
Bennett erstarrte, tief in Gedanken versunken. Alle warteten regungslos.
„Okay, ich möchte, dass ihnen je zwei Tänzerinnen zur Unterstützung unter die Arme fassen.“ Er gab ein kurzes Zeichen, und schon hingen zwei Miezen an meinen Armen. Bennett verdeutlichte uns seine Vorstellung, indem er über die Bühne stolzierte, zwei imaginäre Tänzerinnen an den Armen. Als er „Action“ forderte, kollabierten die Spiders und ihre zauberhaften Escort-Damen beinahe.
„Nein, nein, nein, aufhören!“, schrie er. „Hier bricht sich noch einer ein Bein oder Schlimmeres!“
Wieder warteten wir, während Bennett tief in Gedanken versunken und offensichtlich frustriert hin und her hastete. Meine haltungsbewussten Stützen standen graziös neben mir, die Nippel hoch „konzentriert“.
Während Speer einem wachsamen Marine-Rekruten ähnelte, lächelte Tatum die Damen charmant an, als kenne er sie sein ganzes Leben lang. Worüber grübelte der Choreograph?
Eine Zeitspanne lang, die der Ewigkeit glich, starrten alle im Theater feierlich auf Bennett und fragten sich, was dem Genie wohl einfällt.
„Scheiß drauf“, rief er dann abrupt. „Wir schneiden die Szene raus.“
Die Mädels ließen meine Arme fallen, als wären sie der Pyjama eines Leprakranken, und stolzierten davon.
Die Proben vergingen wie im Nu, und schon bald spielte die Band die Songs wie im Schlaf. Bei der Aufführung sollten wir die gewohnten Spiders-Jacketts tragen und schwarze Rollkragenpullover. Nicht die Garderobe wechseln zu müssen, kam uns gelegen, da wir nach der Abendaufführung quer durch die Stadt fahren mussten, um eine Spätvorstellung im VIP zu geben.
Und wie sieht es mit Zufällen aus, die einer Vorsehung gleichen? Bei einer Szene, einer Traumsequenz, standen eine Guillotine und ein Sarg auf der Bühne, ergänzt durch Sargträger.
Der Abend der Premiere war gekommen. Die Geräusche der Zuschauer glichen dem Summen eines Bienenstocks. Es roch nach einer Mischung aus Parfüm und Zigarrenrauch. Vince und ich saßen auf den Stühlen im Backstage und beobachteten das geschäftige Treiben. Jeder hier hatte in einen höheren Gang geschaltet.
Vince zog eine Mundharmonika aus der Tasche und blies ein bluesiges Riff an. Der Requisiteur warf ihm einen bösen Blick zu, woraufhin er augenblicklich aufhörte. Ein Mann von der Truppe hastete auf uns zu und flüsterte mit eindringlicher Stimme: „Birdies! Euer Zeichen! Ihr seid dran! Wo sind denn die anderen Birdies?“
„Ich hole Tatum“, meinte Glen. „Kann aber was dauern. Ich muss ihn nämlich von der heißen Tänzerin losreißen.“
Tatum kam gerade aus der Garderobe und steckte sich den Pullover unter den Gürtel. In dem schwarzen Outfit wirkte er schnittig. Er lächelte das Lächeln eines Mannes, der gerade verdammt viel Glück gehabt hatte.
Vince meinte: „Lasst uns die Charaktere verinnerlichen. Wir sind die Birdies!“
Das Theater zählte zu den modernen Gebäuden mit mittiger Bühne, die damals im ganzen Land wie Pilze aus dem Boden schossen. Vince führte uns über Rampe 4, einem hölzernen Bühnenaufgang, und wir betraten die Bühne unter großem Applaus. Conrad, dargestellt von Tom Hasson, deutete auf Speer, der den Song einzählte. Wir begannen die Nummer und verabreichten den Theaterbesuchern eine zünftige Dosis Rock’n’Roll.
Schmalzig? Ja, aber es war immer noch ein Riesenerlebnis, als Conrad auf einige Mädels zeigte, die alle schrien und in Ohnmacht fielen. Als er mit seinem Hintern lustvolle Drehbewegungen machte und dabei „leidend“ zischte, schrien alle verbleibenden Mädels wieder und fielen zu Boden.
Kommentar: „Yeah.“ Was soll man sonst noch sagen? „Yeah!“
Für uns war es ein kurzes Intermezzo, doch wir empfanden die erste Begegnung mit der Theaterwelt als durchdringend und machtvoll. Wir absorbierten das Erlebnis, saugten es förmlich auf, erlebten Zankereien zwischen den Darstellern – was ein ganz besonders Theater darstellte – und hatten unsere erste Begegnung mit schönen, halbbekleideten Tänzerinnen.
Nach jeder Birdie-Aufführung hetzte die Band zum Spät-Gig ins VIP, wo wir einige der neu gelernten Show-Liedchen wie „Honestly Sincere“ und „One Last Kiss“ ins Programm warfen. Nun pulsierte der Theater-Virus in unseren Adern. Wir, und nur wir, beherrschten die Bühne mit eigenen Gesetzen und fühlten uns stolzer und härter als noch vor wenigen Monaten. Die Band hatte sich nun bewiesen, sich quasi legitimiert.
Der Vampir des Theaters hatte uns gebissen, und – um es in lyrischen Worten auszudrücken, die jeder versteht – sein ewiger Geist labte sich nun an den Flüssen unserer Seelen.
Tja, und dann ging es wieder ins Elternhaus, wo wir in unseren Jugendzimmern schliefen.
Die Blonde? Ja, die sah ich wieder. Es war bei der Konzertmuschel im Encanto Park, der bekanntesten Grünfläche von Phoenix. Wir sahen uns die erste Gruppe namens Holy Grail an, und ich erkannte den schlaksigen Drummer mit dem sonnengebleichtem Haar. Es war der „Wipe Out“-König Neal Smith! Ganz im Gegensatz zu seiner nett lächelnden Surf-Band, den Laser Beats, wirkte die Musik von Holy Grail packender, erwachsener und aggressiver. Sie schienen keine Angst davor zu haben, den ausgelatschten Pfad zu verlassen.
Während die Band „Shake Your Money Maker“ spielte, ein Publikumsliebling der Paul Butterfield Blues Band, versammelten sich einige Cops mit versteinerten Gesichtern an den Bühnenseiten. Offensichtlich hatten die ein Problem mit einem Becken von Neal, auf dem ein riesiges FUCK in roter Farbe stand. Als die Beamten die Bühne betraten, überraschte sie Neal, indem er sein Schlagzeug in tausend Stücke zerlegte.
Neal wurde abgeführt, und ich erspähte seine liebliche Schwester in der Menschenmenge. Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und ging auf sie zu. „Würdest du meinen Hut halten, wenn ich auf der Bühne bin?“, fragte ich sie.
„Ich glaube schon“, erwiderte sie mit einem verblüfften Gesichtsausdruck.
Als wir uns hinter der Konzertmuschel versammelten, verklickerte ich den Jungs, dass wir unbedingt ein Finale bringen müssten, das jenes von Holy Grail in den Schatten stelle.
Man tauschte einige Ideen aus und entschied sich schließlich zu einer inszenierten Prügelei, die jeden davon überzeugen sollte, dass sich die Spiders auflösten. Ich gab zu bedenken, dass es nur funktioniere, wenn alle ernst und verbissen aussähen.
Mit direktem Blick in die Sonne rockten wir vor einer begeisterten Menge. Beim letzten Song angekommen, begannen sich John und Vince anzuschreien. Daraufhin rannte John an den vorderen Bühnenrand und schnappte sich Vince beim Kragen. Innerhalb einer Sekunde hingen sie wie ein Wollknäuel zusammen, schlugen sich und zerrten an allen Gliedmaßen. Dann stürmten die beiden in entgegengesetzten Richtungen von der Bühne, während wir nur mit den Achseln zuckten, den Song beendeten und mit melodramatischen und besorgten Mienen die Bühne verließen.
Abseits der Bühne erkundigte sich ein besorgtes Pärchen bei Glen nach Details. Mit ernster Miene erzählte er ihnen: „John hat Vince umgebracht, doch sie reanimierten ihn im Krankenhaus. John hat ihm daraufhin ein Gänseblümchen-Bouquet geschenkt, und nun sind sie verheiratet.“
So lief es. Der vorgetäuschte Kampf erzielte seine Wirkung. Wir übertrumpften Holy Grail.
Neals Schwester näherte sich mir mit einem wohlwissenden spöttischen Lächeln. „Ihr habt das doch nur gemacht, um die Aufmerksamkeit auf euch zu ziehen“, sagte sie, dabei den Hut aus der Tasche fischend. „Du kippst doch jetzt nicht um, oder?“
Ihr überwältigendes Aussehen machte mich sprachlos, und ich kämpfte um jede Silbe. Mit einem tiefen Griff in die Schatulle der kultivierten Konversation, meinte ich: „Heute ist es aber heiß!“
Ihrer sympathischen Mimik entwichen jegliche Emotionen, und sie entschwebte in der Ferne.
Im Sommer 1966 fällte John Tatum eine Entscheidung, an die er sich in den folgenden Jahren mit einer gehörigen Portion Wut erinnerte – er stieg aus. Er fühlte sich von einer anderen Band angezogen, die sogar wusste, wie man „Shotgun“ spielt, und „nahm“ die schönen langen Haare und die Rhythmus-Akkorde mit. Als ich ihn bei einer Show mit ihnen sah, musste ich zugeben, dass sie die Nummer perfekt spielten. Glen, der Tatum bislang für einen guten Freund gehalten hatte, war sauer.
Verzweifelt suchten wir nach Ersatz. Vince, Glen und ich erinnerten uns an eine Gruppe, die wir bei einem Bandwettbewerb in einer Shopping-Mall gesehen hatten. Sie nannten sich die Trolls und sahen wie Football-Verteidiger aus, die die Beatles imitierten. Glen spottete, dass sie nur „Mädchen-Songs“ spielten, doch ich schätzte den perfekten, mehrstimmigen Harmoniegesang. Ihr Gitarrist und Sänger hinterließ bei mir einen starken Eindruck, und ich hatte mir sogar seinen Namen notiert: Michael Bruce.
Wie die anderen Bandmitglieder bevorzugte Michael eine große, orange lackierte Gitarre.
Ich rief ihn an und verabredete mich mit ihm. Um zu beweisen, dass zwischen uns keine üble Stimmung herrschte, begleiteten mich Tatum, Glen und Vince bei der Aufklärungsmission.
Die Bruce’ bewohnten ein nettes Haus. Mrs. Bruce führte uns zu seinem Zimmer, wo wir einen breitschultrigen Michael antrafen, umgeben von einer Football-Ausrüstung und dicken Hanteln. Nicht zu vergessen den Football-Hodenschutz. Zumindest besaß er noch einige Kisten mit Schallplatten.
Frei heraus erklärte uns Michael seine Skepsis hinsichtlich eines Einstiegs bei den Spiders. Seine Erklärung lässt sich auf die Aussage kürzen, uns fehle ein schnittiges und schickes Image.
Ich wies auf den Status als Hausband des VIP hin. „Und wir werden sogar bezahlt.“
„Und wir spielen auch keine Mädchen-Lieder“, musste Glen unbedingt loswerden.
Falls uns noch Zweifel geplagt hätten, wurden sie schnell vom Winde verweht, als er uns sein Tonbandgerät zeigte sowie den draußen geparkten Equipment-Transporter.
Während der Verhandlungen übersprang Vince einen Schritt und erklärte Michael, dass er Tatums Nadelstreifenhosen kaufen müsse.
„Das ist doch dämlich“, erwiderte dieser.
„Das musst du gerade sagen“, warf ich ein. „Deine Band spielt mit orangenen Gitarren!“
„Ist das hier eine Band, oder wollt ihr mich ausnehmen?“ Er fischte drei Fünfer aus der Geldbörse und reichte sie Tatum.
„Probe morgen um drei Uhr“, verabredete Vince. „Im VIP.“
Als wir den Gehweg erreichten, brach Tatum in Gelächter aus. „Ich kann nicht glauben, dass er die verdammten Hosen gekauft hat.“
Vince schaute hoch. „Wisst ihr was? Wir haben ihn ja gar nicht gefragt, ob er einsteigen will.“
Michael erschien zur nächsten Probe, die orangene Gitarre und einen netten Fender-Verstärker im Schlepptau. Schon beim ersten Jam stellte sich heraus, dass er und Glen hervorragend zusammenarbeiteten. Beide konnten sowohl Lead- als auch Rhythmus-Gitarre spielen, und dank Michael hatten wir einen weiteren starken Sänger. Was das Ganze noch krönte: Er lernte Songs von der einen zur anderen Sekunde.
Die Band begann zu wachsen und an Stärke zu gewinnen. Damals regte Michael bei uns den Willen und die Entschlossenheit an, eigene Songs zu schreiben. Wir fuhren nach Tucson, um nahe einer Universität vorzuspielen. Bei der Rückfahrt vertrieben wir uns die Langeweile mit Vorschlägen neuer möglicher Coverversionen. Mike schüttelte den Kopf: „Nee, lasst uns doch stattdessen eigene Songs schreiben.“ Er redete so lange auf uns ein, bis allen klar war, dass man sich auf den Hosenboden setzen und eigene Stücke schreiben muss.
Als wir Phoenix erreichten, war Vince und mir ein Song mit dem Titel „Don’t Blow Your Mind“ eingefallen. Er gefiel allen. (Glen wollte ihn – wer hätte etwas anderes vermutet – „Don’t Blow Your Wad“ [slg.: Samen] nennen.) Die Nummer schien für eine Studio-Session gut genug zu sein.
In den Sixties ähnelten Studios gebrauchten Autos – man wusste nie, was einen erwartet. Meist lagen die am besten klingenden Aufnahmemöglichkeiten in den großen Städten, doch auch in der „Steppe“ gab es einige coole Studios wie die von Sun Records in Memphis oder Muscle Shoals in Alabama. Als wir in das Cooper State Recording Studio trotteten, hatte niemand den blassesten Schimmer, was uns dort erwartet.
Der Besitzer, ein gewisser Forster S. Cayce, fungierte als Produzent. Sein Assistent war ein Typ namens Frank, der nach jeder Anweisung von Cayce „Achtung!“ rief. Sie führten uns in den dunklen schalldichten Raum, wo man uns ihrer speziellen Aufnahmemethode aussetzte, die man mit „Es dauert, dauert, dauert …“ umschreiben kann.
Gelegentlich hört man von diesen legendären Rhythm’n’Blues-Acts, die schon fünf Alben vor dem Mittagessen eingespielt haben. Die Spiders hatten nicht so ein Glück. Wir verbrachten Tage damit, Cayce auf der Suche nach dem optimalen Sound beim Verrücken des Equipments zu beobachten. Dann gingen wir zu Denny’s und kauften für Cayce eine weitere Ladung getoasteter Käse-Sandwiches und Cokes. Nachts schliefen alle auf dem kalten Studioboden.
Die Tage zogen an den Musikern vorbei, nur vom Kauf getoasteter Käse-Sandwiches und zahlreichen „Achtungs!“ unterbrochen. Einmal kamen wir gerade ins Studio, wo sich unser „Produzent“ zum aus den Monitoren kommenden Fortunes-Song „You’ve Got Your Troubles (I’ve Got Mine)“ wiegte.
„Hört euch doch nur die Bläser an!“, brüllte Cayce. „Was sagen die uns, Jungs?“
Vince und ich hatten keine Ahnung. Cayce lächelte nur: „Sie drücken aus, dass ihnen alles scheißegal ist, dass sie frei heraus spielen! Spürt ihr dieses ‚Mir ist es doch scheißegal?‘“
Wir näherten uns exakt mit dieser Einstellung an „Don’t Blow Your Mind“ an.
Glen murmelte, dass ihm bald alles wirklich scheißegal sei, wenn er noch eine Nacht auf dem verdammten Fußboden schlafen müsse.
„Das ist ein toller Song“, sagte Michael, „doch überhaupt nicht unser Stil.“
In der Mittagspause ging er zum Plattenladen um die Ecke und legte sich die neue Beatles-Single „Strawberry Fields Forever“ zu. Er legte sie auf Cayces Plattenspieler.
Statt sich im Takt zu wiegen, stand Cayce wie angewurzelt da und hörte sich den ganzen Song konzentriert an, bis zum mysteriösen Fade-Out. Bewusstseinserweiterung? Keine Spur!
„Viel zu dünn“, meckerte er und ging aus der Regie.
Im Laufe der nächsten Woche nahmen wir laaaangsam einige Takes auf und achteten dabei auf zweistimmige Harmonien, nicht zu vergessen Glens verzerrte Gitarrenlinien, mit denen er Vince’ nach einer Garagen-Band klingenden Gesang unterstützte.
„Hört sich nicht schlecht an“, meinte Glen beim Vorspielen des Endresultats. Vielleicht war Cayce doch ein passabler Produzent.
Santa Cruz Records veröffentlichten die Single und bemusterten damit das Radio in Tucson und Phoenix. In der am 27. Oktober 1966 endenden Woche erreichte „Don’t Blow Your Mind“ den 11. Platz der KFIF-Boss-Radiocharts. Nicht schlecht für einen Haufen Schuljungen!
Was das Engagement im VIP anbelangte: Meiner Meinung nach konnten wir es nur mit einem sich ständig verändernden Programm verlängern und attraktiv machen. Darüber hinaus beschlich mich ein Gefühl, dass wir das Image so oft wie möglich erneuern mussten, um die Leute nicht zu langweilen. Vince, Glen, Michael, John und ich teilten diese Auffassung, und wir machten uns daran, sie wie Besessene umzusetzen.
Wir klopften jede Idee ab, egal wie dämlich sie erschien. Die Küche des VIP wurde die Hauptquelle für Bühnenrequisiten. Nach allen nur erdenklichen Küchenutensilien beinhaltete die Show Servietten, Strohhalme und Spachtel.
Charlie Carnal, unser Lichttechniker, machte bei der „Konzeptualisierung extrem“ mit und unterstützte die psychedelische Transformation. Er baute einen Kasten und betitelte das Ding als Lobster-Strobe. Es bestand aus einer Munitionskiste, die er sich in einem Army-Navy-Geschäft zugelegt hatte, aufgemotzt mit einer extrem starken Lichtquelle und reflektierender Aluminiumfolie. Ein Elektromotor trieb eine Metallscheibe mit Ausbohrungen an, wobei man einen einlullend hypnotischen und Stroboskop-ähnlichen Effekt erzielte.
Charlie konstruierte auch die sogenannten Flasher-Lights, lange hölzerne Kisten, die er am vorderen Bühnenrand platzierte und die die Decke anstrahlten. Vor den Spots hingen gebogene Folien, gefüllt mit bei Hitze verlaufender Gelatine und Ölen, wodurch über uns ein Panorama von beeindruckend intensiven Farben und Farbverläufen entstand. Die Lichtshow wurde von Charlie mithilfe einer Schalttafel angesteuert, die er die „Orgel für Arme“ nannte. (Wenige Jahre später traten wir in dem Film Tagebuch eines Ehebruchs auf. In einer kurzen Sequenz sieht man Charlie beim Bedienen der Regler.)
Ein anderer Lichteffekt basierte auf einer ca. 1,60 Meter breiten Scheibe aus Sperrholz mit Löchern. Wir nannten das Ding das „Lichtrad“. Allerdings nutzte Jack bei den Radio-Jingles für das Ding einen weitaus lautmalerischeren Namen – die „elektro-luzierende Bewusstseinsmaschine“.
Am Ende eines Auftritts geschah es häufig, dass wir die Light-Show zertrampelten, was Charlie aber kaum zu stören schien. Er sammelte die Einzelteile ein und bastelte sie für den nächsten Tag wieder zusammen. Charlie war ein wahrer Künstler, und seine Lichtshow entwickelte sich zu einem wichtigen Teil des Bühnenbildes, sodass wir abstimmten, ihm einen netten Batzen der Gage zu überlassen.
Während wir das sich ständig ändernde Spektakulum verfeinerten und perfektionierten, wurden die Shows provokanter und näherten sich den Grenzbereichen hin zum Extremen. Wenn etwas wie eine Bombe einschlug, schlug es wie eine Bombe ein – aber so richtig! Die Leute kamen, darauf wartend, was wir als Nächstes anstellen würden. Veränderungen fanden nicht im wöchentlichen Rhythmus statt, sondern manchmal von Auftritt zu Auftritt!
Die Kids berichteten ihren Freunden davon, dass wir ihnen Shows präsentierten, die von ihnen beim Nacherzählen natürlich extrem überzogen dargestellt wurden. Natürlich stand Vince darauf und setzte Gerüchte in die Welt, nur um zu sehen, wie sie sich aufblähten und wieder zu uns zurückkamen.
Eines Tages schlenderten wir ins VIP, wo uns Jack Curtis mit einer schlechten Nachricht konfrontierte: Eine japanische Gruppe mit dem Namen Spyders hätte ein neues Album veröffentlicht. Unserer laienhaften Auffassung nach war eine Veröffentlichung mit der Beanspruchung des Rechts am Bandnamen gleichzusetzen. Nachdem sich die erste Schockstarre verflüchtigt hatte, stimmten wir über einen Namen ab, den niemand – auch in einer Trillion von Jahren nicht – auswählen würde. Nach einem Schwall verschiedenster Vorschläge einigten wir uns auf Nazz. Der Begriff stammte von Glens Lieblingssong der Yardbirds: „The Nazz Are Blue“.
Am Ende der Probe war uns ein Song eingefallen, der den neuen Bandnamen unterstrich. Um noch eins draufzusetzen, planten wir, Nazz durch das Tragen von Bärten und Spitzbärten zu versinnbildlichen.
Was die Reaktion von Dad auf die Haarpracht anbelangte – das war hart und haarig. Als Kinder wurden uns die Haare ohne Vorankündigung wie bei einer Blitzattacke am Küchentisch geschnitten. Aber nun spielte sein Sohn in einer Rockband, wovon er nun mal gar nichts verstand. Obwohl sein Lebensmotto „Lerne selbst“ lautete, fühlte er sich hinsichtlich meiner Job-Perspektive berufen, mich eines Tages zur Seite zu nehmen und mir das GESPRÄCH aufzunötigen.
Zufälligerweise befanden sich in der Gesäßtasche meiner Jeans ein Bündel Dollars, die ich gerade erhalten hatte. Zwischen uns stand ein Tisch. Ich legte das Geld darauf und glättete die Scheine. Er sah es sich genau an, nickte und wechselte das Thema. Es war das letzte Mal, dass er mir seine Sorgen hinsichtlich des Musikerdaseins ausdrückte.
Mit der aktuellen „Geld-Infusion“ kaufte ich mir einen cremeweißen Ford Falcon 1964 mit Slicks und einem Tacho. Der Schlitten war cool, und demzufolge musste auch ich cool sein. Mit meinem Wagen und dem Transporter Michaels konnten wir endlich Konzerte außerhalb der Stadt spielen. Langsam rollte es an.
Wir machten eine der wohl schönsten Fahrten in einem babyblauen Mustang, der Michelle Mueller gehörte, einer Freundin der Band, die alle Toodie nannten, ein perfekter Spitzname für eine Frau, die an chronischer Fröhlichkeit litt. Sogar ihr blauer Wagen strahlte überschwängliches Glück aus. Einige Zeit später war sie Vince’ Lieblings-Bergkletterin, mit der er einige Touren veranstaltete.
Das ist ein Vorteil des Musikerdaseins in einer Band: Man zieht einige Leute an, die positive Schwingungen ausstrahlen. Und das konnte Toodie tatsächlich.
Und dann geschah es. Plötzlich erkannten wir es. Die ganz große Perspektive. Endlich enthüllte sich unser Platz im Universum.
Wir spielten in einem winzigen Coffeehouse in Tucson namens Minus One. Plötzlich flog die Tür auf, und eine Truppe mit Naziuniformen marschierte rein, blieb stehen und wartete aufmerksam. Die Gäste schauten sich ungläubig an.
Auch die Band starrte angsterfüllt in Richtung der Rechten, obwohl wir uns auf der Bühne in sicherer Entfernung befanden. Doch die „Bühne“ war tatsächlich eine neben der Bar angenagelte vier- bis sechlagige Sperrholz-Platte, auf der man aus Platzgründen auf Barhockern saß. Die Gäste standen einer nach dem anderen auf, quetschten sich durch die Nazihorde und suchten schleunigst das Weite. Ein junges Mädchen, das allein bei unserer Show getanzt hatte, schaute sich das alles mit verwunderter Neugier an.
Nach dem Gig an der University of Arizona hatten wir das Coffeehouse in der Hoffnung angesteuert, noch einen zusätzlichen Dollar zu verdienen. Eine Tasse Kaffee kostete hier 15 Cents. Die Inhaber waren an sanfte Folkies gewöhnt, doch wir hatten die beschauliche Stimmung durch den ersten Song, eine blitzschnelle Fassung von Chuck Berrys „Nadine“, weggeblasen. Vince widmete den Song allen Kaffee-Fans im Laden.
Die Nazis brüllten „Sieg Heil!“, während das Mädchen mit ausgebreiteten Armen schwebend vor der Bühne tänzelte.
Nach 20 Minuten eines Coffeehouse-Putsches in Tucson – bei dem wir todesmutig weiterspielten – ließ die Truppe die Stiefel aneinanderknallen und marschierte im zeremoniellen Stechschritt die Tür hinaus.
Wir zitterten am ganzen Körper. Vielleicht lag das aber auch nur an dem kostenlosen Kaffee, den wir kübelweise gesoffen hatten? Nach drei lauten Sets bedankte sich Vince bei dem Rest des standhaften Publikums fürs Kommen. Kaum waren wir von den Barhockern gerutscht, legte der Besitzer Joan Baez’ „Farewell, Angelina“ auf.
Dann kam ein Junge an unseren Tisch. Er erklärte, dass alle die Nazis hassten. Mit einem Nicken in Richtung des Mädchens, das getanzt hatte, lobte er uns: „Meine Freundin will, dass ich euch mitteile, dass sie die Schwingungen eurer Musik mag. Sie ist taub und tanzt direkt vor den Lautsprechern, um die Vibrationen zu spüren.“
„Oh“, brachte Vince über die Lippen. Er lieh sich einen Stift von mir und schrieb auf einer Serviette eine kurze Notiz an das Mädchen. Sie lautete: „Wir lieben es, wie du tanzt.“
Der Junge nahm das Papier und brachte es dem Mädchen. Sie lächelte, winkte uns zu und tanzte weiter.
Wie beschreibt man Außenstehenden so einen Gig? Tja, ein Haufen Nazis und ein taubes Mädchen mochten uns.
Vince lachte: „Das ist ein Zeichen unserer Breitenwirkung.“
„Wir sollten uns als die Band ausgeben, die jedem gefällt, außer den Massen“, ergänzte ich.
Vince setzte eine noble Miene auf und sagte: „Wenn aus verrückten Menschen Massen von verrückten Menschen werden, sind wir berühmt.“