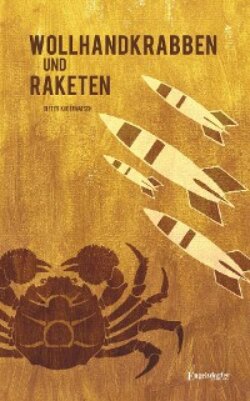Читать книгу Wollhandkrabben und Raketen - Dieter Kudernatsch - Страница 5
Kapitel 1 AUS DER HEIMAT VERTRIEBEN
ОглавлениеAls wir, meine Frau und unsere Tochter Kati, in den Herbstferien 1992 das erste Mal ins Riesengebirge fuhren, war es eine Fahrt mit Hindernissen. Es sollte nur ein Wochenende mit Schneekoppe und vielen Bergen sein, und ganz nebenbei wollte ich mein Geburtshaus in Černý Důl suchen. Die 450 Kilometer wollte ich in einem Ritt herunterreißen. Aber es sollte doch etwas anders kommen.
Als wir in die Stadt Liberec fuhren, ahnten wir nicht, dass wir ohne fremde Hilfe nicht wieder aus dieser Stadt herauskommen würden. Zum dritten Mal an derselben Stelle angekommen, ohne einen Kilometer des Weges zurückgelegt zu haben, verlor ich meinen Humor. Ich stieg aus und fragte den erstbesten Fußgänger nach dem Weg. Und er war der Beste! Er stieg in unser Auto und lotste uns aus der Stadt. Ich wollte dem freundlichen Helfer Geld geben, aber er lehnte entrüstet ab. Ein fester Händedruck, und wir trennten uns wie alte Freunde. Heilfroh verließen wir den Ort, der uns auch in den nächsten Jahren immer wieder vor Probleme stellen sollte.
Wir konnten jedoch nicht wissen, dass auf unserer weiteren Strecke eine Umleitung nach der anderen auf uns warten würde. Das bisher schlechte Wetter mit starkem Wind und Regengüssen wurde noch schlechter. Die Orkanböen rüttelten gewaltig am Auto, und Äste lagen auf der Straße. Wir hatten große Mühe, die uns völlig fremde Strecke zu erkennen. Für uns viel zu früh brach der Abend an, und es wurde stockdunkel. Eine willkommene Entschuldigung, um uns noch einmal zu verfahren und den Weg zum Ziel auf einer für PKW gesperrten Straße nach mehr als sechs Stunden zu Ende zu bringen.
Wir klopften an dem ersten erleuchteten Haus und siehe da, wir hatten Glück. Unterkunft mit Frühstück, bezahlbar und schön gemütlich. Zum nächsten Restaurant für unser Abendessen war es auch nicht weit, und so fielen wir wie halb Verhungerte und Verdurstete dort ein.
Wieder zum Leben erwacht und zurück in der Pension wollten wir nur eine kurze Ruhepause einlegen und dann den versprochenen Spieleabend mit Töchterchen Kati beginnen. Also kuschelten wir uns erst einmal in unsere Betten. Wir schliefen sofort ein und wurden gegen Mitternacht wieder wach. Den Spieleabend hatten wir total verschlafen! Schnell wechselten wir unsere Sachen und schliefen bis neun Uhr, weil uns niemand störte. Das späte Frühstück überraschte uns mit duftendem Schinken, süßer Erbeermarmelade, frischem Obst, warmen Brötchen und starkem Kaffee. Unsere Lebensgeister erwachten wieder. „Haben Sie schon einmal aus dem Fenster gesehen?“, fragte die Pensionswirtin. Wir hatten nicht. Doch was war denn das? Draußen stand zwar unser Auto, aber es war dick zugeschneit! Und das im Oktober!
Natürlich hatte ich keine Winterausrüstung mit, warum denn auch? Jetzt wusste ich es besser. Meine Frau gab mir ein Geschirrtuch und ich kümmerte mich um unser Auto, dass es „vom Eise und Schnee befreit“ war.
Wir fuhren den ganzen Tag in der Gegend umher, aber so richtig wohl fühlte ich mich nicht wegen der Glätte. Die Schneekoppe sahen wir nicht und der Lift hinauf war auch gesperrt. Zurück in Černý Důl waren wir nicht in der Lage mein Geburtshaus zu finden. Vielleicht beim nächsten Mal?
Als wir am nächsten Tag unsere Sachen packten und die Heimreise antraten, war die Sonne da. Sie zeigte das Gebirge in einer Paradeansicht, so dass wir uns schworen, bald wiederzukommen.
Viele Kurzbesuche führten uns in den folgenden Jahren zurück. Mit meinem Bruder Reinhard und seiner Frau Edda lernten wir das Riesengebirge sehr gut kennen und natürlich auch die Stadt Liberec, in der wir uns – wie hätte es auch anders sein können – wieder verfuhren. Bis zu dem Tag, an dem ich im Autoatlas eine bessere Strecke entdeckte, ohne durch Liberec zu müssen. Damit hatten wir ein Problem gelöst. Doch es gab noch ein anderes, welches ich unbedingt klären wollte.
Wir hatten den 50. Geburtstag meiner Schwägerin Ute – von uns allen liebevoll „Tante Ute“ genannt – gefeiert und ihr zu diesem Anlass einen Kurzurlaub mit Paragliding-Flug im Riesengebirge geschenkt. Nun waren wir unterwegs, um das Geschenk einzulösen. Die Autobahn gehörte uns fast allein, und so hatten wir Gelegenheit, das kommende Großereignis zu kommentieren. „Hoffentlich ist genug Wind und du kommst hoch?“, neckte meine Frau. „Eigentlich habe ich mehr Angst davor, nicht wieder runterzukommen“, lachte Tante Ute. „Na ja“, redete ich ganz schlau. „Oben geblieben ist noch keiner.“ In dieser Stimmung näherten wir uns dem Ziel. Nur das Navi nervte uns – „Bitte wenden, bitte wenden!“ – bis wir es endlich abstellten.
Das Wetter war unserer Stimmung angepasst, wir hatten uns nicht ein einziges Mal verfahren und der Blick aufs Riesengebirge war wundervoll. Wir machten eine Pause, um das Panorama zu genießen. Es war wie in einem Film: Im Vordergrund sahen wir eine unendlich lange Waldkette, an die sich steinige Gipfel im Hintergrund anschlossen, dazu ein strahlend blauer Himmel. Wir kamen uns vor, als würden wir vor einer phantastischen Kulisse träumen und hatten Mühe, uns von dieser Postkarte in Natur zu trennen.
„Du wirst es noch besser sehen, nämlich von oben“, machten wir der „Flugschülerin“ Hoffnung. „Mir wäre wohler, ich hätte es schon hinter mir“, sagte Tante Ute. Ihre Stimme verriet Unruhe. „Ich freue mich zwar riesig, aber ich habe ja keine Ahnung, was mich erwartet.“
Wir waren kaum in unserem Hotel, als der Portier zu uns kam. „Sind Sie die Flieger für die Berge?“, fragte er uns in gebrochenem Deutsch. Wir wussten sofort, was er meinte, und bejahten. „Sie möchten anrufen mit der Nummer wegen Flug!“ Er gab uns einen Zettel.
Wir wählten die angegebene Nummer. Doch der Mann am anderen Ende der Leitung hatte vielleicht schon einmal einen Touristen aus Deutschland gesehen, sprach jedoch selbst so wenig Deutsch, wie wir Tschechisch. Also baten wir unseren Portier, er möge den Termin und weitere Einzelheiten für uns telefonisch regeln, was er auch gern tat. „Ein Mann mit großen Taschen suchen an der Seilbahn, der ist Flieger“, sagte er uns. „Es ist 10 Uhr die Zeit.“ Wir bedankten uns für seine Hilfe, aber ein Scheinchen wollte er uns nicht abnehmen.
Wir verbrachten den Abend im Salon mit einigen Gläschen Rotwein und genossen den sagenhaften Sonnenuntergang mit Blick auf das Riesengebirge. Da unser Hotel nur über Serpentinen zu erreichen war, lag das Gebirge wie auf einem Teppich vor uns ausgebreitet. Die Sonne beschien die Berggipfel und tauchte sie in Goldfarben. Wir beobachteten das Gebirge, wie es schlafen ging.
Am nächsten Morgen fuhren wir zu unserem Treffpunkt nach Špindlerův Mlýn. Am Lift warteten wir auf einen Mann mit großen Taschen. Endlich kam er. Der Portier hatte ihn sehr treffend beschrieben: Er war wirklich mit riesigen Taschen beladen. Wir unterhielten uns kurz, er verteilte die Taschen auf uns, dann ging es mit dem Sessellift auf den Berg. Oben angekommen, machte er uns verständlich, dass er auf entsprechend günstigen Wind warten müsse. Er kontrollierte ständig die Windrichtung und -stärke. Dann kam die „Verkleidung“: Tante Ute musste die entsprechende Ausrüstung anziehen. Dazu gehörten ein Overall, ein Helm und jede Menge Gurte. Wir konnten ein Schmunzeln nicht unterdrücken, denn sie sah – ebenso wie der Chef – ein wenig wie ein Kosmonaut aus. Viele der Wanderer blieben stehen und warteten wie wir auf den Start.
Als sich der Pilot am Oberarm ein kleines Gerät umschnallte, fragte ich ihn: „Du willst wohl unterwegs deinen Puls messen?“ Da lachte er sich fast kaputt. „Kontakt mit der Kontrollstelle“, grinste er. Meine Schwägerin war noch immer ohne Angst und wartete auf die Dinge, die da kommen sollten. Als alle Vorbereitungen erledigt waren, standen beide startbereit und aneinander geschnallt im Gras. Sie hofften, genauso wie wir und die anderen Zuschauer, auf den richtigen Wind. Plötzlich rief der Chef: „Rennen, rennen!“ – und im Doppelpack rannten sie den Berg ein Stück hinunter. Ohne Schwierigkeiten hoben sie ab und schwebten über dem Boden. Schnell gewannen sie an Höhe. „Geil!“, rief Ute, und sie segelten in den blauen Himmel hinein. Sie flogen mehrere Kreise und genossen den Wahnsinnsblick über die herrliche Landschaft. Viel zu schnell war der Flug vorüber und sie landeten auf einem großen Platz im Tal. Meine Frau und ich waren mittlerweile mit der Gondel den Berg hinunter gefahren und freuten uns riesig, dass alles so problemlos geklappt hatte.
So richtig glücklich waren wir aber erst, als unsere Segelfliegerin uns munter und aufgekratzt im Tal mit den Worten begrüßte: „Ich lebe noch! Es war herrlich, aber viel zu kurz!“ Für unsere Ute war es eines der schönsten Erlebnisse in ihrem Leben.
Noch am selben Tag hatten wir das Glück, die Schneekoppe bei strahlendem Sonnenschein zu erleben. Es war so, als hätte sich das Riesengebirge besonders herausgeputzt. Das herrliche Wetter hatte viele Besucher angelockt und es herrschte wahre Volksfeststimmung auf dem Berg.
Wir stiegen bis zur Mittel-Station der Seilbahn ab und fuhren hinunter ins Tal. Auf unseren Stammplätzen im Hotel klang der Abend aus. Wir stellten fest: Es war wundervoll, aber auch anstrengend gewesen. Deshalb planten wir für den folgenden Tag einen halben Ruhetag. Frisch und ausgeruht würden wir einen Bummel durch meinen Geburtsort unternehmen und dabei meinem Elternhaus einen Besuch abstatten. Ich hatte vor, Tante Ute mein Geburtshaus zu zeigen. Meine Geschwister Reinhard und Maria und auch ich waren viele Male an diesem Haus vorbeigegangen, ohne Kontakt zu den jetzigen Bewohnern aufgenommen zu haben. Man wusste ja nicht, wie sie reagieren würden. Dabei war es mehr als 60 Jahre her, dass wir unser Haus verlassen mussten. Es zog mich förmlich dorthin! Dann kam der Tag, den ich nie vergessen werde.
Wir parkten an der Poststelle von Černý Důl. Das Wetter war noch genauso toll wie gestern. Heute würde ich es wagen, heute würde ich mein Geburtshaus besuchen und hoffentlich nach all den Jahren zum ersten Mal die Schwelle übertreten. Ich wollte Kontakt zu den neuen Besitzern aufnehmen und hoffte, dass es nette Menschen seien. Die beiden Frauen weihte ich jedoch nicht in meinen Plan ein.
Sie gingen zehn Meter vor mir, als wir nach einigen Minuten mein Elternhaus erreichten. So hatte ich es mir immer vorgestellt: Es lag im Tal und wurde links und rechts von Bergen eingesäumt. Die Sonne schien, als wollte sie mich ermutigen: „Geh ruhig!“ Als ich eine Frau und einen Mann im gepflegten Garten mit vielen Blumen und Obstbäumen stehen sah, tat ich es wirklich. Mein Herz schlug mir bis zum Hals. Lächelnd und mit einem flauen Gefühl im Magen ging ich auf das Grundstück zu. An der Gartentür blieb ich stehen. Die Beiden hatten etwa unser Alter und sahen mich fragend an.
„Guten Tag, ich bin … bin hier in diesem Haus geboren“, stammelte ich. Sie sahen mich einen Moment lang an, als müssten sie überlegen. Dann tauschten sie kurz einen Blick und fragten plötzlich: „Du hier Baby?“ Ich konnte nur nicken. Wir waren uns sofort sympathisch, lachten und waren glücklich. Sie stellten sich vor: Sie hieß Martha, er Stenek.
Es war auf beiden Seiten eine Riesenfreude, und als ich Martha und Stenek sagte, dass ihr Häuschen sehr schmuck sei, freuten sie sich noch mehr. Meine Frau und ihre Schwester kamen langsam auf uns zu. Auch sie wurden freudig begrüßt. Martha und Stenek baten uns in ihr Haus, und ich erlebte einen für mich historischen Augenblick: Nach mehr als 60 Jahren machte ich den ersten Schritt in mein Elternhaus. Dieser Moment rückt mir immer wieder ins Gedächtnis, wenn wir darüber sprechen. Das freundliche Ehepaar zeigte uns alle Räume. In der ehemaligen Stellmacher-Werkstatt meines Vaters wartete eine Überraschung: Hier standen noch alle Maschinen und waren voll funktionstüchtig – von der Säge bis zur Schleifmaschine.
Stenek hielt plötzlich ein Bild in der Hand. „Kennst du dieses Bild?“, fragte er mich. Es war mein Geburtshaus zu der Zeit, als wir noch darin wohnten. „Hast du noch eins davon?“, fragte ich. Er schüttelte den Kopf, lächelte aber vor sich hin. Wir unterhielten uns mit Händen und Füßen. „Kapitalisten“ und „Kommunisten“ sind internationale Begriffe, zu denen Stenek und ich sehr schnell die gleiche Meinung hatten. Martha zauberte Kaffee und Kuchen und bediente uns wie alte Freunde. Die Zeit verging viel zu schnell und wir mussten uns auf den Heimweg machen.
Beim Abschied drückten wir uns, als würden wir uns seit hundert Jahren kennen, und versprachen wiederzukommen. Es fiel uns allen sehr schwer, die Tränen zurückzuhalten.
Als wir am Abend bei einem Gläschen Wein diesen Tag noch einmal an uns vorüberziehen ließen, hing jeder seinen Gedanken nach. Tante Ute hatte einen wunderschönen Urlaub mit einem richtigen Happy End verbracht. Meine Frau und ich waren glücklich, nach über 60 Jahren in meinem Geburtshaus gewesen zu sein und nette und liebe Menschen kennengelernt zu haben.
Drei Wochen später besuchten wir Martha und Stenek erneut. Dieses Mal begleiteten uns aber mein Bruder Reinhard und seine Frau Edda. Da mein Bruder drei Jahre älter ist als ich, konnte er sich an viele Einzelheiten von damals erinnern. Stenek zeigte uns wieder voller Stolz das Haus. Mit den immer noch leistungsfähigen Maschinen unseres Vaters hatte er – ebenfalls Stellmacher von Beruf – allein die komplette Ferienwohnung im oberen Stockwerk ausgebaut. Stenek hatte alles selbst geschreinert: die Fenster, die Böden, die Türen und die Möbel.
Die Ferienwohnung war bestens in Schuss. Doch dann kam die politische Wende, und damit hatten die Urlauber aus dem Raum Halle-Leipzig plötzlich andere Ziele als Černý Důl. Nach einem gemütlichen Kaffeetrinken und Plaudereien begaben wir uns auf den Heimweg.
Zum Abschied hatten Marta und Stenek noch eine Überraschung für uns. Sie schenkten uns eine vergrößerte Fotokopie unseres Elternhauses. Das Originalbild hatten sie von einem Fotografen kopieren lassen. Deshalb hatte Stenek beim ersten Besuch so spitzbübisch gelächelt. Wir trennten uns als gute Freunde.
Auf dem Weg in das Hotel erinnerte sich mein Bruder Reinhard daran, wie wir vor dreiundsechzig Jahren das Haus hatten verlassen müssen: „Wir Kinder spielten im Garten, als plötzlich ein Mann aus dem Dorf kam und nach unserer Mutter fragte. Die Tante, die bei uns wohnte, schickte unsere Schwester los, die Mutti zu holen, die gerade auf den Heuwiesen war. Der Mann brachte eine unheilvolle Nachricht: Zwei Stunden hatten wir Zeit, um zu packen und unser Haus zu verlassen. Alle schrieen durcheinander und weinten, denn niemand wusste, was da geschah. Unsere Mutter packte das Nötigste für uns drei Kinder. Ich war sechs Jahre, unsere Schwester neun und du als Nesthäkchen drei Jahre alt. Der Vater war im Krieg. Unser Gepäck bestand aus einem Rucksack, einem Schulranzen und einem Handwagen. In einer kleinen Sportkarre hast du gesessen. Wir wurden in ein Lager in etwa vier Kilometer Entfernung eingewiesen. Die Mutter zog den Handwagen und trug den Rucksack. Unsere Schwester schob dich in der Sportkarre, und ich hatte den Schulranzen auf dem Rücken. Niemand wusste, wann wir aus dem Sammellager wieder zurückkehren würden.“
Am nächsten Tag – unser Wanderziel war die Wiesenbaude – erzählte Reinhard weiter: „Das Leben in dem Lager war kein Leben, sondern ein Abwarten, was passieren würde. Nach etwa vierzehn Tagen hieß es, wir dürfen wieder nach Hause. Alle Familien waren glücklich und machten sich auf den Heimweg, doch an der nächsten Kreuzung hätten wir geradeaus gehen müssen, um nach Hause zu gelangen, wurden aber gezwungen, eine andere Richtung einzuschlagen.“
„Wie haben die Leute denn reagiert? War das nicht schrecklich für sie?“, fragte ich erschüttert. „Ja, das war es! Unter den Menschen brach eine Panik aus, denn sie ahnten, dass es in die Stadt zum Bahnhof gehen würde. Nach etwa zehn Kilometer Fußmarsch waren wir wirklich auf dem Bahnhof in Vrchlabi zum Verladen. Hier wurden wir in offene Kohlewaggons gepfercht. Auf dem Fußboden lag Stroh. Und wir durften nur Sachen mitnehmen, die wir tragen konnten. Alles andere blieb auf dem Bahnhofsplatz zurück. Etwas Glück hatten wir aber doch. Die Familien Bock und Maiwald aus unserem Heimatort gehörten zu unserem Treck.“ So verließ unsere Familie im Juni 1945 den Heimatort, ohne zu wissen, ob der Vater noch lebte, wie er uns jemals finden würde und was aus uns werden sollte.
Von Vrchlabi ging es über Zittau nach Dresden. Manchmal wurden die Waggons einfach auf Nebengleise gefahren und blieben stehen, bis es irgendwann weiterging. In den Nächten wurden wir oft von Einheimischen beklaut. Der Krieg hatte allen Beteiligten die letzte Würde genommen! Die Versorgung wurde manchmal über Suppenküchen organisiert, wobei eine solche Suppe aus Wasser und ein paar Nudeln oder aus Wasser und ein paar Erbsen bestand. Ansonsten hungerten wir oder stahlen Obst, manchmal blieb uns nur Betteln übrig.
Wenn wir zu Fuß unterwegs waren, hatten sich die Bauern etwas Besonderes einfallen lassen: Sie luden uns rasch am Ortseingang auf Pferdewagen und fuhren im Galopp durch ihre Dörfer hindurch. Am Ortsausgang mussten wir das Gefährt wieder verlassen. Damit verhinderten die Leute, dass wir bei ihnen bettelten oder stahlen. Oft blieb uns nur das unreife Obst von den Bäumen an den Straßenrändern – mit den entsprechenden Folgen wie tagelangem Durchfall.
Irgendwann kamen wir nach Dresden, aber zu spät, um den letzten Zug nach Bayern zu erreichen. Also ging es weiter: Vor uns lag die Strecke von Dresden über Riesa und Torgau nach Wittenberg, der Stadt an der Elbe, ein zweihundert Kilometer langer, nicht enden wollender Fußmarsch.
In Wittenberg wurden wir in einer Schule vorübergehend einquartiert. Sie kam uns wie ein Hotel vor: Ruhe, gesichertes Essen und Schlafen im Trocknen, wenn auch auf dem Steinfußboden. Nach einigen Tagen wurden alle Neuankömmlinge auf die umliegenden Dörfer verteilt. Gemeinsam mit Familie Bock aus der Heimat wurden wir einem Dorf zugewiesen, das auf der anderen Seite der Elbe lag: Pratau.
Wir mussten die Elbe überqueren, die hier wesentlich breiter als in unserer Heimat war. Einige Männer trugen Kinder wie mich einfach über die behelfsmäßige Brücke hinüber. Meine Geschwister und meine Mutti konnten auf breiten Brettern über den Fluss laufen. Auf der anderen Seite der Elbe warteten schon Pferdewagen, mit denen wir in unser zugewiesenes Dorf gebracht wurden.
Nach ungefähr einer halben Stunde Fahrt hielt der Bauer sein Gespann an. „Halt, Brauner!“, rief der Bauer und drehte sich zu uns um. „Nu steigt mal runter von meinem Wagen, ihr seid jetzt zu Hause.“ Zu Hause? Was meinte er damit? Wir sahen nichts, was die Bezeichnung „Zuhause“ verdient hätte. Was wir erblickten, war eine Gaststätte, die auch schon bessere Zeiten gesehen hatte. „Wo ist denn unser Quartier?“ Aufgeregt riefen alle durcheinander. Mit unserer Familie sollten etwa zwanzig Personen hier einziehen. Es stellte sich heraus, dass der Bauer der Wirt dieser Gaststätte war. „Euer Quartier ist hinten, geht erst einmal ums Haus herum.“ Im hinteren Raum des Hauses war jedoch nur der Tanzsaal. Genau dieser sollte unser neues Zuhause sein.
„Lasst uns zurück nach Hause, lasst uns doch nach Hause!“, schrien die Frauen außer sich vor Wut und Enttäuschung. Die Verantwortlichen für die Unterbringung hatten alle Hände voll zu tun, die aufgeregten Menschen zu beruhigen. „Lasst uns doch erst einmal den Saal angucken“, rief ein alter Mann, Opa Bock. Die Leute betraten den Saal und schauten sich um. Wenigstens hatten die Bauern für Stroh gesorgt, dass wir nicht auf dem blanken Fußboden liegen mussten. Uns blieb nichts anderes übrig: Der Tanzsaal wurde unser neues Quartier. Keiner der Ankömmlinge ahnte, dass wir mit der Ankunft in Pratau am Ende unserer großen Reise angekommen waren – für immer.
Irgendwie musste das Leben weitergehen. Die Hauptlast lag auf den Schultern unserer Mütter, denn die Väter und Brüder waren gefallen, verschollen oder in Kriegsgefangenschaft. Der alte Mann – der einzige in dem Saal – übernahm das Kommando. Opa Bock entdeckte im Hof eine alte Schwengelpumpe, aus der wir unser Wasser zum Waschen holten. „Wenn ihr mal müsst, dann pinkelt dahinten in die Hofecke. Große Geschäfte könnt ihr in der Bretterbude erledigen“, wies er uns an. „Nachts nehmt ihr euch einen alten Stahlhelm mit rein. Das muss erst einmal reichen.“ Diese Dinger waren auch als „Nachtgeschirr“ geeignet – welch ein Wandel! In den Nächten wurde geschluchzt, geweint, laut geträumt – und die Kinder riefen nach dem Papa.
Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich ungebetene Gäste einstellten. Und das geschah schnell! Alles, was man an Ungeziefer haben konnte, gesellte sich zu uns: Flöhe, Wanzen, Mäuse. Die Mütter ergriffen sofort Gegenmaßnahmen und die waren alles andere als fein. Trotz lauten Protestes, Weinens und Geschrei schnitten sie allen Kindern eine Glatze. Auch die Mädchen mit ihren schönen langen Haaren hatten keine Chance. Nur ich mit meinen drei Jahren hatte nichts dagegen, weil nun meine Mutti endlich aufhörte, mich zu kämmen.
Bei unseren Spaziergängen durch das Dorf fanden wir Schilder an den Hoftoren mit „Bissieger Hund“ (der war sicher sehr bissig), obwohl die Leute gar keinen Hund hatten. Die Umsiedler hatten keinen guten Ruf, weil sie alles mitnahmen, was irgendwo herumlag. Das wurde als Stehlen bezeichnet. Aber es gab auch viele Leute, die uns halfen.
Doch schnell war der Zustand im Saal nicht mehr tragbar, so dass wir mit der Familie Bock und acht weiteren Umsiedlern in das Feuerwehrhaus des Ortes umquartiert wurden. Der Tanzsaal wurde später wieder als solcher genutzt, für uns Umsiedler wurde er am Sonntag auch als Kirche verwendet. Als ich viele Jahre später als Handballtrainer mit meiner Jungenmannschaft den ehemaligen Saal betrat, staunte ich nicht schlecht: Er war zu einer ansehnlichen Sporthalle umgebaut worden.
Das Leben im Feuerwehrhaus war nicht einfach. Es war einfach viel zu eng dort. So mussten immer zwei Personen in einem Bett schlafen, weil der Platz für mehr Bettgestelle nicht ausreichte. Doch alles wurde gemeinsam geregelt, um dem Leben das Beste abzuringen. Meine Mutti erzählte mir später oft die Geschichte von der Suppe. Die ging so: Die Frauen hatten einen Riesentopf Kartoffelsuppe gekocht, der auf den Tisch gestellt wurde und zwar genau dahin, wo zwei Tische zusammenstießen. Als eine der Frauen den einen Tisch wegzog, um darunter sauber zu machen, passierte es: Der Topf sauste auf den Fußboden, wo natürlich auch die Suppe landete. Da nahmen zwei Frauen die Löffel und löffelten die Suppe zurück in den Topf. Schaden behoben! Nur nichts verkommen lassen!
Kurz nach Weihnachten wurde ich sehr krank und ins Krankenhaus gebracht. Ich hatte Knochenhautentzündung im Fuß, Scharlach und Diphtherie. Wegen der Ansteckungsgefahr durfte ich keinen Besuch empfangen. Als ich durch Zufall meinen Bruder am Fenster sah, schrie ich so fürchterlich, dass ich einige Tage lang nicht sprechen konnte. Mein Fuß heilte nicht und die Ärzte sahen keine Möglichkeit mehr, ihn zu retten. So wurde ich Ostern entlassen und wir hofften, dass der Fuß von allein gesundwerden würde, was er auch wirklich tat. Im Fieberwahn sah ich häufig Gespenster. Alle Mäntel und Jacken mussten aus unserem Schlafraum verschwinden. Ich fürchtete mich vor ihnen. Es dauerte viele Jahre, bis ich diese Angst überwunden hatte.