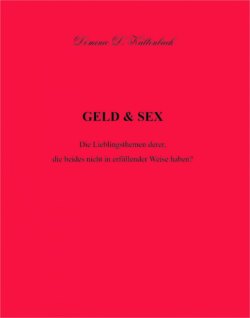Читать книгу GELD & SEX - Dominic D. Kaltenbach - Страница 5
Vorsicht, Eindringlinge
ОглавлениеEnttäuscht werden muss, um es gleich vorwegzunehmen, wer glaubt, hier direkt etwas über besonders geheime, erfolgreiche Methoden des Geldverdienens und über besonders ausgefeilte Praktiken der Sexualität zu erfahren. Gegenstand dieser Betrachtung ist weder das Eine noch das Andere.
Vordergründiger Stein des Anstoßes sind hier auch weder die kriminellen Finanzberater, die den „kleinen Mann“ um sein ohnehin nicht vorhandenes Geld bringen, noch die ausufernd schamlosen Medienvertreter, die mit ihrer sexuellen Reizüberflutung selbigen auch noch um seine Sittlichkeit bringen.
Es geht hier vielmehr um bürgerschaftlich engagierte Mitmenschen, die auf kurz oder lang jedes Gespräch völlig willkürlich und gänzlich unabhängig vom jeweiligen Personenkreis auf ihre Lieblingsthemen Geld und Sexualität lenken. Dabei beschränkt sich deren Vorgehen keinesfalls auf kostenlose, unerwünschte Vorträge, wie man sie beispielsweise von Glaubensvertretern kennt, die an der Haustüre klingeln. Wer bereits größte Anstrengungen aufbringen muss, um unverlangte Informationen weder vor sein geistiges Auge, noch in sein Gedächtnis vordringen zu lassen, steht bald vor einer weit größeren Herausforderung. Wie entkommt man möglichst höflich der investigativen Bohrung nach der eigenen finanziellen und sexuellen Erfülltheit?
Die Devise unserer vermeintlich unübersichtlichen und ohne jede Orientierung daherkommenden Zeit scheint zu lauten, wer nicht detailliert berichtet, lebt offensichtlich in einem mehr als bedauernswerten finanziellen wie sexuellen Mangelzustand.
Die Neugier kennt keine Grenzen, schließlich gibt es unendlich weit mehr zu verpassen, als die physische und psychische Begrenztheit eines Menschenlebens zu praktizieren erlaubt. Zum einen eröffnet die Globalisierung die Möglichkeit, unabhängig von der je eigenen Kulturangehörigkeit, weltweit nach geeigneten Lebensentwürfen zu suchen. Zum anderen besteht eine Facette der Individualisierung korrespondierend daraus, sich eigenverantwortlich aus diesen Möglichkeiten seine eigenen Lebensentwürfe zusammenzubasteln. Diese nicht ganz einfache Aufgabe scheint jedoch einige Mitmenschen keinesfalls vor ihr größtes Problem zu stellen. Für diese wirft die grundsätzliche Gestaltbarkeit mit Blick auf den zwischenmenschlichen Umgang vor allem zwei Fragen auf: Mit wem hat man es als Gegenüber wirklich zu tun? Und natürlich auch in umgekehrter Richtung: Für wen oder was werde ich selbst gehalten?
Der amerikanische Soziologe Richard Sennett beschreibt jedoch nicht nur die Blüten dieser von Verunsicherung geprägten Situation. Er sieht darin nicht weniger als den Untergang der Zivilisiertheit begründet. Zunächst spräche natürlich einmal nichts dagegen, den Mitmenschen die notwendige Einschätzung des Kommunikationspartners so leicht als möglich zu machen. Allerdings kommen dem kulturellen Vertreter des lockeren amerikanischen Umgangs erhebliche Zweifel daran, ob diese Hilfestellung zum besseren Verständnis notwendigerweise detaillierte Beschreibungen der sexuellen Begierden enthalten muss. Auch die persönliche Finanzlage und die bevorzugte Vorgehensweise in monetären Angelegenheiten hält Richard Sennett nicht unbedingt für die dringlichsten Informationen, um ein zwischenmenschliches Gelingen zu gewährleisten.
Die wahre Bedrohung für den zivilisierten Umgang scheint jedoch bei genauerer Betrachtung vielmehr von geheimniskrämerischen Lebensweisen auszugehen. Nicht umsonst rückt das „Impression Management“ mit Vorliebe das Intime in den Fokus der Öffentlichkeit. Die Eindrücke, die andere vom „Ich“ haben sollen, müssen unbedingt ausgeschmückte Details über die Finanzen und das Sexualleben enthalten. Ansonsten passiert, was passieren muss: „Lathe biosas“ - lebe im Verborgenen, riet nämlich bereits der griechische Philosoph Epikur (341 v. Chr. bis ca. 270 v. Chr.). Er kaufte zu diesem Zweck für seine Anhänger in Athen einen Garten („kepos“). Wenn man sich allerdings eine derartige, nicht öffentlich zugängliche Oase zulegt und zudem eine Lebensauffassung vertritt, die sich gänzlich an der „hedone“ (griechisch: Lust) orientiert, liefert man damit vor allem den Ausgeschlossenen eine Steilvorlage, als abartiger Lustmolch verschrien zu werden.
Zwar befanden sich die Griechen auch damals bereits in einer Krise, in einer Hinsicht war die Welt vor dem endgültigen Umbruch allerdings entscheidend übersichtlicher. Zumindest findet Rudolf Wolfgang Müller in den homerischen Schriften aus dem 8. Jahrhundert vor Christus weder ein autonomes Subjekt, noch überhaupt ein Ich-Bewusstsein. Natürlich lockt eine derart harmonische Ordnung zwischen Menschen und Göttern obligatorisch Störenfriede an. Bereits Mitte des 7. Jahrhunderts vor Christus wollte sich der Spötter Archilochos einfach nicht mit dem ihm zugewiesenen Platz gänzlich außerhalb der ehrenwerten Gesellschaft abfinden. Die Argumentation mutet aus heutiger Sicht befremdlich an. Er fühlte sich von aller Welt missverstanden. Ebenso empfand er es als ungerecht, dass die gesamte Ordnung nur „ihm“ feindselig gegenübertreten würde. Heutzutage gehört man mit derlei Auffassungen obligatorisch zur Mitte der Gesellschaft. Damals existierten Ich-Identitäts-Muster jedoch allenfalls in rudimentärer Form.
Relativ kurze Zeit später war der Ofen für das griechische Weltbild der Einheit von Stadtstaat („polis“) und Weltordnung („kosmos“) endgültig aus. Die sich ausbreitenden Makedonier hatten unter Philipp II (um 382 v. Chr. bis 336 v. Chr.) und dessen großem Sohn Alexander (356 v. Chr. bis 323 v. Chr.) das Weltverständnis derart ins Wanken gebracht, dass die altehrwürdige, athenische Demokratie im Jahr 321 vor Christus eine für die Todesfeststellung notwendige, aber nicht hinreichende Nulllinie im Elektroenzephalogramm aufwies. Die Wiederbelebungsversuche der städtischen Gemeinschaft konzentrierten sich nunmehr erstmals auf das Individuum.
Eine individuelle Glückseligkeit („eudaimonia“) aus der staatlichen Ordnung heraus hatte sich als Illusion erwiesen. Bisher zielte die Suche nach dem jeweiligen Glück auf den perfekten Staat. Jetzt drängte sich vielmehr die Frage auf, welche Umstände dem Einzelnen ein Wohlbefinden verwehren. Die Antwort war relativ leicht zu finden: Dem Glück stehen nicht irgendwelche konkreten Dinge, sondern lediglich angsterzeugende Vorstellungen im Weg!
Dies ist der wesentliche Kernsatz der Stoa, einer philosophischen Schule, die um 300 v. Chr. begründet worden war. Versammlungsort war die namensgebende Säulenhalle, die „Stoa poikile“. Diese war nicht nur bunt, wie der Name bereits verrät, sondern, im Unterschied zum Kepos, vor allen Dingen öffentlich zugänglich. Die dort verbreitete Lehre sah die Ursache der menschlichen Angst alleine in der Wahrnehmung. Die Welt als solche ist perfekt. Nichts anderes gilt es von jedem Einzelnen zu erkennen und stoisch hinzunehmen. Ein entsprechend tugendhaftes Leben äußert sich im pflichtbewussten und vernünftigen Gehorsam gegenüber dieser göttlichen Ordnung. Die damals offensichtliche Staatskrise widerlegt diese Auffassung nicht. Kein Stoiker hätte das sich in der Krise befindliche Gebilde als Staat bezeichnet. Der wahre Staat basiert nicht auf willkürlichen Gesetzen, die der Mensch hervorgebracht hat, sondern alleine auf jenen der „Allvernunft“. Ein Garten der Lust kann jedoch weder tugendhaft noch vernünftig sein und führt den Menschen ohne Umweg in die Unfreiheit.
Der damit direkt angegriffene Epikur sah das Kernproblem zwar ebenfalls in einer angsterzeugenden und damit fehlerhaften Sicht auf die Dinge, allerdings ist seiner Auffassung nach die perfekte Welt nicht einfach gegeben, sondern muss von jedem Einzelnen aktiv hergestellt werden. Als Orientierung in diesem Prozess diene die Lust. Natürlich regt dieser Ansatz in erster Linie die Phantasie an. Die Einbildungskraft der Ausgeschlossenen scheint allerdings weit verdorbener gewesen zu sein, als es die tatsächlichen Handlungen innerhalb des Kepos waren. Carl-Friedrich Geyer kommt sogar zu dem Schluss, dass die Sexualität für Epikur keine nennenswerte Rolle gespielt zu haben scheint. Zumindest hinterlässt der Meister diesbezüglich verschwindend wenige Hinweise. Lediglich einer seiner Schüler äußert sich konkreter. Allerdings gliedert sich dessen Beitrag ebenso unspektakulär in den allgemeinen Grundkanon der epikureischen Empfehlungen ein wie das Thema Nahrungsaufnahme. Der Fleischeslust sei nämlich nur dann nachzugeben, wenn sie dem Ziel, weder sich noch anderen zu schaden, nicht zuwiderlaufe. Lustgewinn führt nach diesem Verständnis also nicht in eine animalische Zügellosigkeit, sondern zu der rationalen Frage, ob das, was zunächst durchaus Lust erzeugt, auf kurz oder lang nicht weit größere Beschwernisse hervorruft.
Zwar kommt es beinahe trivial daher, dass man grundsätzlich nicht mehr brauche, als ausreichend sei. Den Herstellern von Trillerpfeifen und sonstigen Protestartikeln beschert es jedoch einen gewaltigen Umsatz, die Gier der unersättlichen Zeitgenossen öffentlich an den Pranger zu stellen. Kaum einer wird bezweifeln, dass dieser egoistische Wesenszug der Gemeinschaft schadet. Nicht ganz so banal kommt allerdings die Erkenntnis Epikurs daher, dass die Wirkrichtung genau umgekehrt verläuft: Die Gemeinschaft schadet der individuellen Zufriedenheit und ruft die Gier damit in vielen Fällen überhaupt erst hervor. Der unbeeinflusste Blick auf die eigenen Bedürfnisse ließe erkennen, wie wenig man eigentlich brauche. Man wird vor diesem Hintergrund niemals arm sein. Die Gemeinschaft der Mitmenschen scheint eine derart egozentrische Sichtweise allerdings nicht wirklich ertragen zu können. Gefordert wird die bedingungslose Orientierung am Wir. Vergütet wird in diesem verheerenden Spiel mit Anerkennung. Wer allerdings auf diese Bewunderung angewiesen ist, erfährt lediglich, dass Selbstzufriedenheit und ein Glücksgefühl aus dem Erreichten das Letzte ist, was die Gemeinschaft zuzugestehen bereit ist. Man wird und darf niemals reich sein.
Die Steigerung der Lust war im berühmtesten Garten der Antike offensichtlich nicht von ausschweifenden Orgien abhängig. Vielmehr schien man sich dort vor den ständig steigenden Ansprüchen unlusterzeugender Mitmenschen zu verstecken. Zum Leidwesen der Epikureer zog man allerdings gerade mit diesem Rückzug die Aufmerksamkeit der Miesepeter auf sich, die Unzufriedenheit sähen und Glückseligkeit verhindern. Mit Macht und Geld könne man zwar ein gewisses Bollwerk errichten, wirklich sicher sei man jedoch nur dann, so die etwas bittere Erkenntnis des Meisters, wenn man von der Menge übersehen werden könne. Das ist Hedonismus nach Epikur.
Der Umgang mit allerlei verschiedenen Menschen führte auch bei einem deutschen Adelsspross aus dem 18. Jahrhundert zu einer gewissen Ernüchterung. Adolph Freiherr Knigge (ca. 1751 bis 1796) rät ebenfalls dazu, sich besser rar zu machen. Ob er die negativen Erfahrungen seines antiken Leidensgenossen kannte oder nicht, jedenfalls ergänzt er seinen Rat um die Warnung, dabei tunlichst nicht als Sonderling, scheu oder hochmütig zu erscheinen. Es lasse sich folglich nicht verhindern, gelegentlich die Gesellschaft der Mitmenschen zu suchen. Im Zuge dessen dürfe durchaus auch eingebracht werden, welch interessanter Zeitgenosse man sei. Schließlich hänge die eigene Geltung in der Welt davon ab, in welchem Umfang man sich selbst geltend mache. Dabei sei jedoch ebenfalls auf vorsichtigste Bescheidenheit zu achten, damit keinerlei Neid geweckt werde. Er haderte allerdings gewaltig mit der empfohlenen Anspruchslosigkeit. Denn die Großmäuler mit ihrem alles überdeckenden Geschrei stünden einer Selbstpräsentation, die sich durch vornehme Zurückhaltung auszeichne, unweigerlich im Weg. Ganz zu schweigen davon, dass diese Mitmenschen sich mit kleinen Andeutungen ohnehin nicht zufrieden gäben. Zu deren Vorlieben gehöre es, nicht nur alles wissen, sondern auch mit unbescheidensten Ratschlägen behilflich sein zu wollen. Darüber hinaus würden sie sich des erschlichenen Wissens ungeniert bedienen, um bei anderen interessant zu erscheinen.
Ob aus Verbitterung oder aufgrund technischen Unvermögens, weder Epikur noch Freiherr Knigge hatten ein Facebook-Profil angelegt. Dabei war Epikur davon überzeugt, dass es zwar keine naturgegebene menschliche Gemeinschaft gebe, man allerdings gänzlich ohne Freundschaft nicht sicher und somit auch nicht lustvoll leben könne. Wie auch immer diese beiden Herren zu ihrem Bekanntenkreis gekommen sein mögen, damals wie heute gilt es, die stillen Freunde der Bescheidenheit erst einmal zu finden. Zudem zählt man nur dann, trotz eines äußerst zurückhaltenden und in der Verborgenheit geführten Lebens, nicht zu den verschobenen Sonderlingen, wenn man mindestens bescheidene 30 „Likes“ bekommt. Bei über zwei Milliarden Internetnutzern dürfte dies nicht besonders schwer sein. Allerdings zählt man ab 100 Einheiten der neuen „Gefällt mir“-Währung bereits zu den Stars und darf sich nach den Spiegelautoren um Manfred Dworschak etwas auf sich einbilden.
Nur wenige scheinen die Entdeckung der eigenen hervorragenden Bedeutung dem Zufall überlassen zu wollen. Zumindest nicht die Mädchen der heutigen Teenager-Generation. Diese betreiben, Beschreibungen des Sprachforschers Martin Voigt zufolge, eine Öffentlichkeitsarbeit, die in so manch professioneller PR-Agentur ihresgleichen sucht. Gemäß des uralten Mottos „Sex sells“ lässt sich hier in Anlehnung an die Medienwissenschaftlerin Ulla Autenrieth eine „Theatralisierung der Freundschaft“ finden, die mit Instrumentalisierung sicherlich treffender bezeichnet wäre. Mehrfach täglich versicherten sich die Protagonistinnen wechselseitig in aller Öffentlichkeit, dass das eigene Leben nur durch die „allerbeste Freundin fürs Leben“ (ABFFL) einen Sinn habe. Selbige werde gerne auch als „meine Ehefrau“ bezeichnet und stehe bei Facebook hinter dem Status „in einer Beziehung“. In Anbetracht der beigefügten Bilder innigster Umarmungen und Liebkosungen scheint einigen Eltern die Situation eindeutig zu sein: Ihre Tochter würde zukünftig ihr Glück in gleichgeschlechtlichen Beziehungen suchen und hoffentlich auch finden. Mit Liebe und echten Gefühlen habe dieses Verhalten, so die wissenschaftliche Erkenntnis, allerdings nichts zu tun. Hinter der dargebotenen Erotik stecke nichts anderes als das Heischen nach „Likes“.
Auch wenn das Freundinnen-Phänomen nichts gänzlich Neues darstelle, bemerkenswert blieben bei der Heraufbeschwörung des digitalen Applauses die eher unbeholfenen verbalen Steigerungen ins Unermessliche. Zum einen übersteige die Inflation größter Gefühle nämlich relativ schnell den eher bescheidenen Wortschatz der heutigen Jugend, zum anderen drücke das gesamte Unterfangen nichts anderes als eine bedauernswerte Sinnleere aus. Den Heranwachsenden fehle eine Aufgabe, die sie fordere und die für ihr Leben auch tatsächlich von Bedeutung wäre. Diese Einschätzung scheint allerdings in völliger Weltfremdheit zu verkennen, wie viel harte Arbeit auch jedes C-Promi-Sternchen, von Neidern auch Szene-Tussi genannt, in ihre Medienpräsenz stecken muss. Ohne die Hilfe der ABFFL wäre es kaum zu schaffen, die im Halbstundentakt an Aufmerksamkeit verlierenden Profilbilder zu ersetzen und in einer Geschwindigkeit wechselseitig zu kommentieren, dass selbst die Börsianer mit ihrem berüchtigten Hochfrequenzhandel als Schnecken gelten dürfen.
Wer keine ABFFL sein eigenen nennt, sollte vielleicht eine Wohnsitznahme in den USA in Erwägung ziehen. Als besonderen Freundschaftsdienst übernehmen beispielsweise die Behörden im Bundesstaat Florida das zeitnahe Posten von Bildern und Namen, wenn man selbst dazu nicht mehr in der Lage ist. Sei es, weil die anstrengende Trunkenheitsfahrt erst einmal ein Schläfchen in der Zelle notwendig macht oder weil man seinem eigenen Fahrstil zum Opfer fiel.
Das alles ist der Meilensprung zwischen 1.0 und 2.0 - oder, allgemein verständlich ausgedrückt, zwischen dem Konsum gesicherter Informationen und der aktiven Mitgestaltung im erbitterten Kampf darum, was in der Welt von Interesse zu sein hat.
Die Teilhabe bei Facebook erinnert allerdings zunächst einmal an einen grünen und ruhigen Wald. Genauer gesagt, an das darin lebende Rotwild. Bei diesen prächtigen Geschöpfen gehört jedes einzelne Tier zwar zur Herde, geht es unterwegs allerdings verloren, bleibt der Verlust weitestgehend unbemerkt. Entsprechend ist auch auf der Freundesplattform jeder 24 Stunden am Tag tunlichst darauf bedacht, den virtuellen Anschluss nicht zu verlieren. Der physische Aufenthaltsort spielt bei der digitalen Anwesenheit allenfalls dann eine Rolle, wenn sich unterwegs der Akku verabschiedet. Ein solcher Vorfall hat ähnlich dramatische Folgen, wie die von Thomas Tuma beschriebene Selbstaussperrung vom eigenen Dasein durch die dreimalige Falscheingabe der PIN. Spätestens jetzt würde die Blutdruck-und-Herzfrequenz-App Alarm schlagen. „Nomophobie“ bezeichnet seit 2008 die körperlichen Angstsymptome, die dann auftreten, wenn kein funktionsfähiges Handy zur Verfügung steht (engl: no mobile) und man dadurch sozial völlig isoliert ist. Wie, bitte schön, soll man denn vorübergehende Passanten auf die Notsituation aufmerksam machen und um Hilfe bitten, wenn man sie weder „anmailen“ noch „ansimsen“ kann?
Zwar kommt es in der heutigen Zeit an erster Stelle auf Kommunikationskompetenz an, nicht anders wäre die Zugehörigkeit zu teilweise gleich mehreren Rudeln aufrecht zu erhalten. Allerdings verstehen die entsprechenden Experten darunter keine direkte verbale Kommunikation. Selbst wenn sie ausnahmsweise den Mund bewegen und dabei auch noch ihr zufälliges Gegenüber anschauen, wird das übersehene Headset für den Laien zur Blamagegefahr. Die absoluten Könner würden auch niemals die Kommunikation einer ihrer verschiedenen Identitäten mit ihrem Klar-Gesicht verbinden. Damit wäre für immer ausgeschlossen, die eigenen Beiträge zu den meist diskutierten zu hieven. Man müsste sich fortan damit zufrieden geben, nur noch den belanglosen Müll fremder Herkunft als Zeichen der Anwesenheit und hellwacher Aufmerksamkeit zu kommentieren.
Bemerkt dennoch völlig unerwarteterweise ein realer Passant die nomophobische Notlage, gehen die Probleme erst richtig los. Offline könnten sicherlich nicht annähernd ausreichend Kommentatoren erreicht werden, um sich der Richtigkeit der angebotenen Hilfestellung auch sicher sein zu können. Schwarmintelligenz lautet die Zauberformel, die sich zwischenzeitlich sogar auf den Weg in die etablierten demokratischen Institutionen gemacht hat. Jeder Mist verwandelt sich in Genialität, wenn der Haufen nur groß genug wird. Gleichzeitig scheint jeder Einzelne zu hoffen, dass ihn die Welt auf der Basis irgendeiner seiner unbedachten und belanglosen Mitteilungen zum größten Denker des Universums kürt.
Die Digitalisierung hat das Leben offensichtlich in vielerlei Hinsicht freier, nicht jedoch unbedingt leichter gemacht. Der Einzelne kann vor diesem Hintergrund entweder egoistischerweise selbst nach Orientierung suchen, wofür er sich lediglich mit sich selbst, seinen Wünschen und Vorstellungen auseinandersetzen muss, oder er betätigt sich altruistischerweise politisch im engeren Sinn. Dafür muss er seinen Mitmenschen zur Orientierung lediglich Verpflichtungen auferlegen und sie nötigenfalls etwas unter Druck setzen. Er kann dann erst einmal beobachten, was daraus geworden wäre, hätte er sich selbige selbst zu eigen gemacht. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich auf diesem Feld die neu aufgelegten Forderungen der 68er-Bewegung. Diese wollten ebenfalls die Demokratie stärken und zerrten im Zuge ihrer Umerziehungsoffensive jeden persönlichen „Scheiß“ an die Öffentlichkeit. Dafür mussten natürlich zuallererst die Toilettentüren ausgehängt werden. Die Schamesröte sollte all jenen ins Gesicht steigen, die es wagten, ein stilles und eher zurückhaltendes Wesen ihr Eigen zu nennen. Das Biotop der geschützten Privatsphäre musste ein für alle mal ausgetrocknet werden. Dort konnte ohnehin nur eines prächtig gedeihen, die gelebte Scheinheiligkeit der Elterngeneration. Seither gilt es bereits als undemokratisch, einen Gedanken zu erst einmal reifen zu lassen, bevor er in die Welt hinaus posaunt wird.
Die Öffentlichkeit hört mehr denn je zu, teils freiwillig, teils unfreiwillig. Die welt-bedeutende Stellung der Headset-Träger steht außer Frage. Dass auf der anderen Seite jedoch nicht unbedingt ein Vertreter des Bundespräsidialamtes oder gar des Weltsicherheitsrates der Vereinten Nationen um Hilfe bittet, wird aus dem Hörbaren mehr als deutlich. Seit den Enthüllungen von WikiLeaks weiß man, dass es nur eine Behörde gibt, die einen derartig belanglosen Tratsch als diplomatische Depesche deklariert: das Außenministerium der Vereinigten Staaten von Amerika.
Allem Spott zum Trotz, die auf dem Tisch liegenden Fragestellungen lassen auch eine gewisse Bedeutsamkeit der zwischenzeitlich Alt-68er erkennen. Die ehemaligen Revolutionäre sitzen heute nicht selten selbst auf den einst verhassten Lehrstühlen und Ministersesseln. Was deren Elterngeneration möglicherweise erstaunen, auf jeden Fall jedoch erfreuen dürfte, wird nunmehr zur großen Enttäuschung der Kinder- und Enkelgeneration. Nun müssen Letztere selbst für Transparenz sorgen. In demonstrativer Abgrenzung ersetzte man zuallererst die einstigen Wollknäuele auf den Sitzungstischen durch einen Kabelsalat. In erfahrungsbedingter Gleichheit wurde die angekündigte große Veränderung des intransparenten politischen Betriebs bis auf Weiteres wieder in die Hinterzimmer verlegt.
Wie soll denn nun also die neue Transparenz aussehen? Und vor allem, welche Lebensbereiche sollten einem entsprechenden Transparenzgedanken unterliegen? Trotz allen Strebens nach Anerkennung und Aufmerksamkeit scheint mit diesen Fragen zunehmend ein diffuses Unbehagen aufzutreten. Neben die Befürchtung, unbeachtet zu bleiben, tritt zumindest die vage Angst, diese Beachtung auf ungewollte und äußerst unerfreuliche Weise zu erlangen.
Die diesbezügliche Verunsicherung scheint sich bislang allerdings in Grenzen zu halten. Während für seriösere Produkte um jeden Cent gefeilscht wird, verdeutlichen sich offensichtlich die wenigsten, was „kostenlos“ im neuen Wortsinn bedeutet. So angelockt, verramschen sie bedenkenlos die Angaben zur eigenen Person, unwissend, welche Preise auf dem Markt für derartige Informationen zu erzielen sind. Die Köderprodukte der Datensammler müssen weder besonders hilfreich noch annähernd wertvoll sein, „umsonst“ reicht völlig.
Selbstverständlich wissen auch die neuen Transparenz- und Kostenlosapostel, dass die Privatsphäre aus guten Gründen zu einem wesentlichen Schutzgut der Grund- und Menschenrechte gehört. Fremden gegenüber würden wahrscheinlich die wenigsten einem kostenlosen Konsum dessen zustimmen, was sie unbekleidet zu bieten haben. Während sich die meisten Mitmenschen als Anbieter eher zugeknöpft zeigen, fordern sie als Konsument uneingeschränkten Zugang. Um etwaige Irrtümer zu vermeiden, klärt Ralf Höcker beide Seiten über ihre Rechte auf. Gegen einen arglosen, technisch unbedarften Betrachter des „Schönen“ ist rechtlich nichts einzuwenden. Heimliche Bildaufnahmen muss sich der Darsteller seit 2004 jedoch nicht mehr unbedingt gefallen lassen. Die vorgenommene Ergänzung des Strafgesetzbuches (StGB) um den § 201a schützt explizit die Räumlichkeiten, in denen man sich für gewöhnlich ohne Bedenken entblößt. Schwierigkeiten stehen seither zudem sowohl den Besuchern als auch den Kuratoren ins Haus, die sich dieser technischen Darstellungsform naturbelassener Kunst verschrieben haben.
Geht es allerdings um den Schutz der Privatsphäre, steht ohnehin primär die Abwehrfunktion der Grundrechte gegen den Staat im Fokus der Wahrnehmung. Was uns in den 1980er-Jahren hätte erwarten können, entfaltet hier, dank George Orwell (1903 bis 1950), nachhaltige Wirkung. Über den wahren Zweck staatlich installierter Videoüberwachungsanlagen auf öffentlichen Plätzen lässt sich seither kein Mensch mehr täuschen. Noch vom Ort des Geschehens aus wird die Internetgemeinde informiert: Soeben habe man die kriminellen Machenschaften der Sicherheitsbehörden durch die mutige Missachtung des Vermummungsverbotes unterwandert. Selbiges gilt allerdings nur im Zusammenhang mit Versammlungen, so dass fraglich bleibt, wer oder was hier beisammen war. Endlich wieder in die grundrechtlich geschützte Wohnung zurückgekehrt, kann mit Eifer am Eldorado für zwielichtige Zeitgenossen gebastelt werden. Selbstverständlich interessieren sich auch die Sicherheitsbehörden für die angeberischen Informationen: Der neue Sportwagen, die schick eingerichtete Wohnung mit angegebener Adresse in bester Wohnlage, die soeben gebuchte Reise auf die Malediven etc. Fehlt nur noch das ausdrückliche Bedauern, dass man Erstere im Zeitraum X leider aufgrund Letzterer verwaist zurücklassen muss. Diese Informationen stellen auch einen ersten Ansatzpunkt für die Beamten dar, in deren Zuständigkeit dann die Aufklärung des „Angriff[s] auf den Gewahrsam einer täterfremden beweglichen Sache bei [...] beabsichtigtem Angriff auf [...] die Sachherrschaft [über selbige]“ liegt. (Die zitierte Quelle im „Fachlexikon Recht“ trägt übrigens den schnöden Titel: „Diebstahl“.)
Natürlich soll das Internet endlich eine Öffentlichkeit ermöglichen, die an keinerlei Zugangsbedingungen geknüpft ist. Der „kleine Mann“ wurde lange genug ausgeschlossen. Schließlich etablierte sich das Verständnis der „bürgerlichen Öffentlichkeit“ als Überwindung der Herrschaft derer da oben bereits im 18. Jahrhundert.
Zweifellos gibt es im Internet auch keine Fremden, die nicht als potentiell neue Freunde angesehen werden müssen. Die gemeinsamen Interessen sollen ja gerade auf diesem Weg ausgelotet werden.
Selbstverständlich sind dabei die aufeinandertreffenden Vorstellungen von Öffentlichem und Privatem fließend. Man ist schließlich offen für alle(s).
Unklar bleibt jedoch offensichtlich, ob die virtuell ausgestellten Bilder der eigenen Habseligkeiten lediglich als schnöde Angeberei oder als kostenloses Angebot bei Selbstabholung zu verstehen sind.
Um also ein Bewusstsein für die unterschiedlichen Weltdeutungen zu schaffen, mussten die Vereinten Nationen zu einem ebenso innovativen wie anschaulichen Mittel der Menschenrechtsbildung greifen. Der im Zuge dessen neu ernannte, inoffizielle „UN-Sonderbeauftragte zur Steigerung der Wertschätzung der Privatsphäre“, Mark Zuckerberg, lässt regelmäßig unregelmäßig die entsprechenden Grundeinstellungen seiner Plattform ändern. „Das Zeitalter der Privatheit ist vorüber“ lautet der provokante Slogan bei Facebook, der die Menschen zu mehr Vorsicht beim Umgang mit ihren persönlichen Daten ermahnen soll. Dieses Vorgehen sei für die realen Verhältnisse viel zu subtil und vor allem viel zu langsam, wie Edward Snowden streng geheimen Quellen zufolge meint. Derweil zielt ein weiterer Bestandteil der Facebook-Bildungskampagne auch auf den vorsichtigeren Umgang in Finanzangelegenheiten. Das Vabanquespiel „Behalte ich die Kontrolle über meine persönlichen Daten?“ ist nun auch in der Fassung „Behalte ich die Kontrolle über mein Geld?“ erhältlich.
Selten entfaltet eine Aktion der Vereinten Nationen in dieser Geschwindigkeit die gewünschte Wirkung. Möglicherweise geht der Erfolg auch darauf zurück, dass die UN-Operation hierbei nicht in einem weit genug entfernten, ohnehin unterentwickelten Irgendwo stattfindet. Die Gefahr für die Menschenrechte geht nicht nur von den hochentwickelten Industrienationen aus, sie bedroht ausnahmsweise auch deren Bürger. Die Menschen seien jedenfalls bereits erkennbar misstrauischer geworden. Teilweise zeigten sie sich geradezu verschlossen, so dass einige Betrachter, mehr oder weniger sarkastisch, bereits von einer erkennbaren Rückkehr zu den wichtigen Dingen des Lebens sprechen. Auf der einen Seite müssen sich diejenigen, die eine zeitnahe Antwort auf ihre Mails als höflich betrachten, bereits mit den Opfern von Psychoterror vergleichen lassen. Selbige würden ebenfalls durch die völlige Stille beim Warten in den Wahnsinn ihrer eigenen, zermürbenden Gedankenwelt getrieben. Auf der anderen Seite müssen sich wiederum diejenigen, die eine permanente Facebookpräsenz als lebensnotwendig betrachten, bereits mit den letzten Gästen einer Party vergleichen lassen. Selbige gäben ebenfalls, selbst im Morgengrauen, die Hoffnung nicht auf, doch noch jemanden in ihr Schlafzimmer abschleppen zu können. Die Jugend amüsiert sich derweil angeblich nur über die antiquierte Nutzung von sozialen Netzwerken und erst recht über das Versenden von Mails. Im Netzwerk senden sie allenfalls hie und da etwas in die Runde. Chats bieten hingegen die gewünschte Flüchtigkeit und selbst technikaffinen Eltern und Pädagogen bleibt der Einblick verwehrt.
Die Sozialwissenschaftler sind von diesen Vorgängen entzückt. Erstmals könnte sich unter Umständen in Echtzeit beobachten lassen, wie der Übergang von einem durch Entblößung und Gewalt geprägten Naturzustand zu einer durch Umgangstugenden und festen Regeln geprägten Zivilisation aussieht. Es ist allerdings nicht zu erwarten, dass sich hier Umgangsformen etablieren werden, die diejenigen der analogen Welt überragen. Einer entsprechenden Enttäuschung zuvorkommend, weist Georg Diez darauf hin, dass auch Maschinen und Technik die Menschen nicht in ihrem Wesen verändern werden. Der Rahmen des digitalisierten Geplauders bringt allerdings eine wesentliche Veränderung mit sich: die Speicherkapazität. Im analogen Umgang wirkte der erfreuliche oder unerfreuliche Verlauf eines Gesprächs lediglich in einer natürlicherweise nachlassenden emotionalen Erinnerung nach. Dank Bits und Bytes kann selbiger nunmehr in aller Ruhe immer wieder analysiert, überinterpretiert und aufgekocht werden.
Völlig neu sind die einhergehenden Gefahren allerdings nicht, wie ein Blick in das lange währende Technikzeitalter 0.0 zeigt. Wer falschen Freunden eine Weltsicht offen legte, die sich beispielsweise nicht nach der Grundauffassung der katholischen Amtskirche richtete, spielte damals buchstäblich mit seinem Leben. Für unsere Zeit scheint jedoch vielmehr die Konfusion charakteristisch, was denn nun überhaupt als öffentlich und was als privat einzustufen sei. Seit Jahren wird auf die Frage, ob Bunga-Bunga-Partys in Italien nun privat oder von öffentlichem Interesse seien, eine Antwort gesucht. Während die einen darin eine legitime Machtdemonstration sehen und die anderen daraus vor allem eine Schädigung der Institution ableiten, dauert die Suche nunmehr schon Jahrhunderte:
Ein enthaltsames Leben für Geistliche der katholischen Kirche war zwar bereits seit dem Jahr 306 angedacht, bis zum Beginn einer mehr oder weniger ernsthaften Durchsetzung des Zölibats vergingen jedoch noch knapp 800 Jahre. Welche Nonne dennoch unbedingt öffentlich ausplaudern musste, dass Seine Heiligkeit Sixtus III (Pontifex von 432 bis 440) als wörtlich genommener Stellvertreter des Herrn auch ein besonders versierter Verführer und Nebenbuhler um die „Bräute Christi“ gewesen ist, konnte bis heute nicht geklärt werden. Bei Johannes XII (Pontifex von 955 bis 964), der eine begehrenswerte Schwester hatte, tauchte dummerweise der Ehemann auf und hatte für die vorgefundene Form der Geschwisterliebe nicht sehr viel übrig. Jedenfalls ließ sich die resultierende Ermordung des amtierenden Oberhauptes der katholischen Kirche, trotz der engen familiären Umstände, nicht im Privaten halten. Bekannt sind auch die Ausschweifungen zu Zeiten des Pontifikats Alexanders VI (Pontifex von 1492 bis 1503). Der Borgia-Familie waren zur Steigerung von Macht und Einfluss vielerlei Mittel recht und die einhergehende Wirkung in der Öffentlichkeit nur billig.
Natürlich könnte man hier einwenden, dass die Wahl des Konjunktivs bei der Verbreitung dieser erfundenen Gerüchte angemessener wäre. Zum einen macht man sich, nach Ralf Höcker, ohnehin jedoch auch dann strafbar, wenn man die üble Nachrede ausdrücklich als Gerücht klassifiziert. Zum anderen wurden die Schilderungen über das Treiben der Päpste, so die Sexualphilosophen Stefanie Voigt und Markus Köhlerschmidt, schon vor Jahrhunderten, mehr oder weniger überprüft, zum Allgemeinwissen erhoben.
Im Ancien Régime des 17. und vor allem 18. Jahrhunderts waren die Ausschweifungen im Vatikan, dank des Whistleblowers Martin Luther (1483 bis 1546), möglicherweise schon etwas abgedroschen. Jedenfalls beschränkte sich die Beschäftigung mit der unsäglichen Vermengung von Öffentlichem und Privatem fortan nicht mehr auf den Klerus alleine. Um Genaueres zu erfahren muss man allerdings schon nach den großen Literaten dieser Zeit, wie etwa dem französischen Philosophen Jean-Jacques Rousseau (1712 bis 1778), Ausschau halten.
Heutzutage bedürfe es weder eines bedeutenden Amtes noch sonstiger Würden, um auf ewig in das große Geschichtsarchiv des Internets aufgenommen zu werden, so das letzte Bunga-Bunga-Opfer Silvio B. Die zeitgenössische Selbstbestimmung baut, wie die Journalistin Ulrike Knöfel feststellt, nicht unwesentlich auf dem Verrat auf. Das Wahren von Geheimnissen prädestinierte den Einzelnen zum Mitglied in den ehemals vorherrschenden kleinen und verschworenen Vereinigungen. Unter den neuen Vorzeichen stellt ihm die Enthüllung dagegen den Status eines Weltstars in Aussicht. Jeder kann sich im digitalen Zeitalter, gerade auf diesem Weg, selbst zur öffentlichen Figur erheben. Genau das lässt das Pendel der „Wichtigkeit des Einzelnen“ heute wild zwischen extremer Beachtung und völliger Bedeutungslosigkeit hin und her schwingen.
Im Rahmen dieses Spiels kann bei jedem kleinen Zwist, ob im Privaten, der Schule oder im Arbeitsleben, allerdings auch jedem Einzelnen zum Verhängnis werden, was bereits der langjährige Direktor des FBI, J. Edgar Hoover (1895 bis 1972), begonnen hatte. Nicht mehr in eigens angelegten geheimen Dossiers, aber irgendwo im Internet sind die kleinen, bisher belanglosen Informationen gesammelt, die nun schlagartig und gebündelt gegen den Urheber Verwendung finden.
Ob Hoover selbst tatsächlich Frauenkleider getragen hat und mit seiner betont konservativen Lebenshaltung von seiner Homosexualität ablenken wollte, bleibt bis heute mutmaßende Retourkutsche für dessen Sammelleidenschaft. Motiviert sei das Horten solcher Informationen nämlich aus einem grundsätzlichen Sicherheitsbedürfnis heraus. Die naturgegebene Konkurrenz zwischen den Menschen und der ständige wechselseitige Vergleich brauche einen beruhigenden Pol. Hat man erst einmal eine Schwäche am Mitmenschen ausgemacht, stehe man nicht nur vor sich selbst besser da, diese jederzeit einsetzbare Munition verleihe eine beinahe erhabene Macht. Dabei spielt es gänzlich keine Rolle, ob das in Stellung gebrachte Pulver auch tatsächlich der Wahrheit entspricht.
„Vertrauen“ meint entsprechend die Bereitschaft, sich freiwillig verletzbar zu machen. Wie also könnte man selbiges besser demonstrieren, als sich buchstäblich zu entblößen. „Sexting“ bezeichnet diesen vertrauensbildenden Vorgang des digitalen Austauschs mehr oder weniger erotischer Bilder. Die Vertrauenswürdigkeit des Adressaten macht sich jedoch nicht alleine an dessen charakterlichen Eigenschaften fest. Die Sache hat auch ein technisches „Häkchen“. Stets besteht die Gefahr, dass selbst die ehrlichste Haut das ihr digital Anvertraute versehentlich freilässt. Sind die Bilder erst einmal in Umlauf, lässt sich ein diesbezüglicher Irrtum kaum mehr beheben. Sicherheitshalber lassen angeblich deshalb immer mehr Eltern ihre Töchter spätestens zum 16. Geburtstag dem allgemeinen Schönheitsideal entsprechend zurechtschneiden. Es falle ja schließlich alles auf die Familie zurück.
Eine andere Variante auf der Suche nach Sicherheit lässt zwar den Körper unversehrt, ist jedoch nicht weniger kostspielig. So verspricht ein Gestänge, das bei richtigem Aufbau eine Pyramide ergibt, die völlige Isolation von allerlei Strahlung. Für einen fünfstelligen Betrag erhält man ein Modell, bei dem garantiert keine störende Energie von außen am ruhesuchenden Selbst zerrt. Phantasielose Geizhälse betätigen einfach den Ausschaltknopf ihres Mobiltelefons. Jedoch nicht, ohne sich vorab zu vergewissern, dass die PIN zur Reaktivierung noch präsent ist.
Auf welchem Weg auch immer, sobald man der ohrenbetäubenden Welt entflohen ist, gibt es nicht weniger zu entdecken, als die „Kraft der Stillen“. Entgegen der allgemeinen Auffassung, die lauten Mitmenschen seien schöner, intelligenter, erfolgreicher und sympathischer, finden sich bei den Freunden der leisen Töne überraschende Gegenbeispiele. Sicherlich ist es auf Anhieb nur schwer vorstellbar, aber auch hübsche und erfolgreiche Führungspersönlichkeiten wie Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier sollen zu den eher introvertierten Charakteren gehören.
Zwar steht Extraversion für Selbstsicherheit und Erfolg, Introvertierte sind allerdings alles andere als unsicher und ängstlich. Der Schweizer Psychologe Carl Gustav Jung (1875 bis 1961) bemerkte bereits in den 1920er-Jahren, dass diese Menschen ihre Energie einfach nur mehr nach innen richten. Sowohl die Pyramidenverkäufer als auch die Vertreter der Schwarmintelligenz ignorieren mit aller Kraft die schlechten Nachrichten der Forschung. Um einen Gedanken auf der Basis einer gründlichen Analyse reifen zu lassen, braucht es kein Pyramidengestänge. Diese Eigenschaft wird nach heutigem Wissen vererbt und steckt, schwächer oder stärker ausgeprägt, in jedem von uns. Für tatsächlich wertvolle Gedanken braucht es auch keinen Schwarm. Der Sozialpsychologe Wolfgang Stroebe stellt bezüglich des Brainstormings sogar ernüchternd fest, dass der einzelne Denker potentiell weit bessere Ideen hervorbringt, als den gruppengenerierten, aber immerhin wechselseitigen Beifall erzeugenden, Mainstreambrei.
Dabei sei es gar nicht grundsätzlich dumm, der Herde nachzulaufen, wie Axel T. Paul feststellt. Wenn eigene Maßstäbe fehlen, sei die Imitation ein durchaus rationales Verhalten. Geld und Sexualität scheinen Paradebeispiele zu sein, bei denen sich die öffentliche Selbstdarstellung der Menschen an der vermeintlichen Mehrheitserwartung orientiert. Entsprechend lassen sich die Äußerungen mit mehr oder weniger interessanten Rückschlüssen einordnen:
Je mehr Prahlerei, desto weniger Stellen scheint der Kontostand zu haben, so die ersten Hinweise aus einer Spiegelserie, die sich eigens dem besseren Verständnis der tagtäglichen Probleme der Wohlhabenden gewidmet hat. Die schrillsten Selbstdarsteller brächten es meistens maximal auf sieben Stellen vor dem Komma. Diese Hürde scheint allerdings mit einem Jahreseinkommen im unteren sechsstelligen Bereich gerade deshalb nur schwer zu nehmen zu sein, weil jeder mit diesem Gehalt bereits zum Geldadel gehöre. Der entsprechend notwendige repräsentative Lebenswandel, gerade weil jene sich selbst in der Unterschicht der Oberschicht wähnen, lasse für Rücklagen kaum einen Spielraum. Interessanterweise scheinen die absoluten Repräsentationsausgaben umso geringer auszufallen, je weniger sie relational ins Gewicht fallen. Gerade die Menschen, die finanziell bedenkenlos tun könnten, was die Mehrheit bekundetermaßen anstrebt, führen oftmals ein bemerkenswert asketisches Leben. Bevor hieraus jedoch voreilige Rufe nach einem Grundeinkommen angeregt werden, dessen Höhe diese Bescheidenheit und Tiefstapelei für jedermann finanzierbar macht, sei bereits darauf hingewiesen, dass die Hintergründe nicht unbedingt finanzieller Natur sind.
Die ausschweifendsten Phantasien über die Mitmenschen bringt jedoch immer noch das Thema Sexualität hervor. Je mehr moralische Empörung, desto verdorbener scheint die Vorstellungskraft zu sein. Erstaunlicherweise findet sich die völlig ungehemmte Zügellosigkeit nämlich nicht bei der sexuell verwahrlosten Jugend der Generation Porno, sondern mehrheitlich nur in den Köpfen der entsetzten Diskutanten. Bei wissenschaftlichen Erhebungen muss übrigens, wie bei kaum einem anderen Thema, in diesem Umfang berücksichtigt werden, dass die Befragten ihre Realität, ob bewusst oder unbewusst, an das anpassen, was sie in den Schlafzimmern ihrer Mitmenschen vorzufinden vermuten: Hetero-, Homo-, Bi-, Tri-, Quattro-, Metro-, Trans- und Zissexualität, alleine diese, wenn auch unvollständige, Aufzählung ermattet. Im Verhältnis zu Schilderungen aus dem Alten Testament und erst recht zu jenen aus der griechischen Antike, handele es sich bei den zugrunde liegenden Praktiken, nach Hans Magnus Enzensberger, jedoch geradezu um farblose Biedermeierei. Lediglich von Paaren, die seit Jahrzehnten in einer erfüllten Beziehung leben, hört man das, wovon auch die heutige verdorbene Jugend träumt: Liebe und wechselseitige Geborgenheit seien das Wichtigste. Sexualität spiele eher eine beiläufige Rolle.
Ach, wie schlecht ist doch die heutige Zeit. Blickt man allerdings historisch zurück, so bestätigt sich diese Feststellung zu jeder Zeit und allerorten. Selbstverständlich finden sich immer Anhaltspunkte, etwas zu verbessern. Solange dieser Motor mit einer Form der „Zufriedenheit“ befeuert wird, die anderenfalls zu Trägheit und Apathie führen würde, läuft alles wie geschmiert. Allerdings scheint insbesondere der statistisch erzeugte „Deutsche“ als Antriebsmittel nichts Geringeres als sein gesamtes „Lebensglück“ einzusetzen.
Wirtschaftlich ging es noch keiner Generation der Deutschen so gut wie der heutigen. Während in anderen europäischen Staaten krisenbedingt schwerste Einschnitte hinzunehmen sind, trösten wir uns mit einer konstanten Steigerung des Konsums. Selbst das bösartigste Monster, welches der Kapitalismus geschaffen hat, scheint durch die Krise derart verwirrt, dass es anatomisch unmögliche Bewegungen zu vollziehen vermag. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung will im Jahr 2012 beobachtet haben, dass sich das Reichtums-Scheren-Monster kurzfristig minimal geschlossen haben soll. Anlass zum Optimismus? Wir sind doch keine Amerikaner oder Briten, die selbst bei lahmender Wirtschaft und drohender Arbeitslosigkeit diese Form der Nicht-Informiertheit an den Tag legen. Der Deutsche schaut nicht auf sich, er vergleicht neidvoll nach oben. Irgendwo müssen die 839 deutschen Haushalte ja sein, die nach dem „Global Wealth Report“ mehr als 100 Millionen Dollar ihr Eigen nennen.
Auch sexuell lebte noch keine Generation vorher derart frei. Bis 1973 machte sich noch strafbar, wer einem erwachsenen, aber unverheirateten Paar lediglich die Möglichkeit eines Schäferstündchens einräumte. Bis Anfang der 1990er-Jahre galt Homosexualität laut Liste der Weltgesundheitsorganisation als Krankheit und stand bis 1994 in Deutschland unter Strafandrohung. Heute gibt es unter Volljährigen nur eine Einschränkung: alles muss in wechselseitigem Einvernehmen der Beteiligten geschehen. Das Einzige, was es jetzt noch zu vermeiden gelte, wäre die von der Psychoanalyse ausgemachte ewigliche Angst, alle anderen erlebten eine unglaubliche, ekstatische Befriedigung, während einem selbst selbige unzugänglich bleibe.
Die Tyrannei der Intimität kommt nach Richard Sennett auf zwei Wegen daher, unvermeidbar ist sie in beiden Fällen jedoch nicht.
Im ersten Fall beschreibt er die Entwicklung der modernen Kleinfamilie. Der Wahrnehmungs- und Handlungsrahmen engt sich auf den Kreis der Lieben ein und geht mit einem zunehmenden Desinteresse an öffentlichen Belangen einher. Eine Bedrohung für die allgemeine Zivilisiertheit entsteht hier durch das ausbleibende Engagement für die Gemeinschaft. Zur Tyrannei für den Einzelnen wird die Intimität, wenn die Schaffung eines goldenen Käfigs zur Klaustrophobie führt.
Der zweite Weg beschreibt den Siegeszug der Psychologie in die Mitte der Gesellschaft. Alle Unverstandenen dieser Welt können endlich auf die Einsicht der Mitmenschen hoffen, weil mit der allgegenwärtigen Offenheit alle charakterlichen Details verfügbar sind. Eine Bedrohung für die allgemeine Zivilisiertheit entsteht hier durch die Abschaffung höflicher Distanz. Zur Tyrannei für den Einzelnen wird die Intimität, wenn durch das Verschwinden von Geheimnissen das gesamte Leben stets mitteilbar sein muss.
Was passiert mit Geld und Sexualität, wenn beides stets für eine Pressekonferenz aufbereitet sein muss? Konnten wenigstens die Psychopathen zwischenzeitlich geheilt werden, die immer behaupteten, über Geld spreche man nicht, und auf die gerade die Verschwiegenheit und das Unausgesprochene einen sexuellen Reiz ausübten?