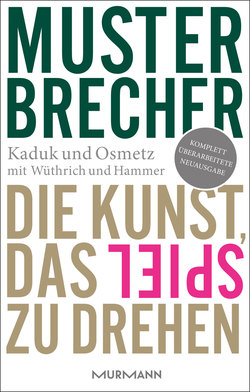Читать книгу Musterbrecher - Dominik Hammer, Stefan Kaduk - Страница 8
ОглавлениеSpielfeld 2
SCHWÄRMENDE GENIES
Warum das Analoge eine Bühne braucht
»Man kann die meisten Leute dazu bringen, öffentlich zu erklären, dass eins plus eins drei ergibt. Kein Problem. Es müssen ihnen nur genügend andere Leute dabei Gesellschaft leisten.« 23 Harald Martenstein, Kolumnist des Zeit Magazins, bringt es auf den Punkt: Menschen tendieren dazu, anderen wie die Lemminge zu folgen.
Vielleicht war es Glück, vielleicht hatten wir auch nur für das richtige Thema die richtigen Referenten gefunden. Die Karten für unsere Konferenz »Lebendige Führung: Muster überwinden – Potenziale entfalten« waren bereits sechs Wochen vor der Veranstaltung ausverkauft. Als die Teilnehmer am Morgen des 25. November 2011 im Veranstaltungsraum des Technoparks Zürich eintrafen, sahen sie, dass auf der Großleinwand ein Computerspiel im Gange war. Es handelte sich um den Telespielklassiker aus den 1980er-Jahren: Pong, eine Art Tischtennisspiel. Einige Personen aus dem Veranstaltungsteam hatten sich schon im Raum verteilt und hielten kleine Kellen in die Luft, die aussahen wie Raclette-Pfännchen, die auf der einen Seite silbern reflektierten, auf der anderen schwarz waren. In gewissen Abständen, nach einer zunächst nicht nachvollziehbaren Logik, drehten die Spieler die Kellen um 180 Grad. Wer neu hinzukam und die Szene beobachtete, merkte schnell, dass die Kellen wie Joysticks funktionierten, mit denen die Schläger auf dem Bildschirm – originalgetreu als simple Balken dargestellt – auf- und abbewegt werden konnten. Wir beobachteten, dass die eintreffenden Gäste – zuerst nur zögerlich, dann immer rascher – ebenfalls Spielkellen in die Hand nahmen, die auf jedem Platz bereitlagen. Nach einigen Minuten hatte sich ein kleiner Schwarm gebildet, dessen Mitglieder sich die Spielregeln offensichtlich nur aus dem Beobachten anderer erschlossen hatten. Die Regeln waren einfach: 1. Die eine Mannschaft wurde von Teilnehmenden in der linken, die andere von denen in der rechten Raumhälfte gebildet. 2. Je nachdem, welche Seite der Kelle nach vorne in Richtung Infrarotempfänger gehalten wurde, bewegte sich der Schläger nach oben oder unten.
Heiner Koppermann ist einer der beiden Geschäftsführer von SwarmWorks, einer Firma, die Großgruppen mithilfe moderner Technologie für Livekommunikation vernetzt. Für ihn ist das Gelingen dieses Experiments keine Überraschung: »Wir erleben seit Jahren, dass diese Form der spontanen Herausbildung eines koordinierten Schwarmverhaltens funktioniert. Menschen beobachten andere Menschen, erschließen die Steuerungsregeln und agieren ohne äußere Einwirkung so, dass die Gruppe eine gemeinsame Handlung vollzieht.«
Nach dem spielerischen Einstieg wechselten im weiteren Verlauf der Konferenz Vortragsimpulse und Arbeitsphasen. Letztere bestanden zunächst aus Votings, die von jedem Einzelnen über vernetzte iPods abgegeben werden mussten. Die Ergebnisse der individuellen Abfragen wurden zu Durchschnittswerten verdichtet und im Plenum sofort zur Diskussion gestellt.
Darüber hinaus wurde in Gruppen gearbeitet. Die 200 Teilnehmer waren auf 24 Tische verteilt, auf denen jeweils ein SwarmWorks-Desktop stand. Die Gruppen wurden nun aufgefordert, in einer Diskussion »Bremsklötze« zu benennen, die eine Kultur der Potenzialentfaltung in ihren Organisationen verhindern. Jede Gruppe gab ihre Ergebnisse in das System ein. Anschließend wurden die Antworten aller Gruppen, für alle sichtbar, auf einem elektronischen Marktplatz abgebildet. Die Gruppen sollten nun alle Bremsklötze nach Relevanz bewerten. Am Ende lag eine Liste vor, die folgende Hürden priorisierte: »Kurzfristdenken«, »Angst vor Kontroll- oder Machtverlust«, »fehlendes Vertrauen in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter«.
Im letzten Drittel der Veranstaltung luden wir die Teilnehmer dazu ein, mutige Experimente zu erarbeiten, die zur Überwindung der Hürden beitragen könnten. Es kam eine Reihe von Vorschlägen zusammen, die durchaus interessante Aspekte enthielten, wie zum Beispiel Zielvereinbarungsmodelle und Bonussysteme zu testen, Menschenbilder in der Organisation zu diskutieren, die Hierarchie für einen Tag aufzuheben oder eine Dialogplattform für den Ideenaustausch zu schaffen. Nur sehr wenige Ideen aber waren wirklich mutig.
Die Nutzung der in Organisationen vorhandenen kollektiven Intelligenz schien uns ein lange Zeit viel zu wenig beachteter strategischer Wettbewerbsvorteil zu sein. In unterschiedlichen methodischen Settings versuchten wir in den letzten Jahren, die besondere Wirkung der »Klugheit der vielen« zu nutzen. Schließlich sprechen Untersuchungen über Schwarmintelligenz dafür, sich mit dieser besonderen Form der Herstellung von Wissen auseinanderzusetzen. Zudem waren und sind wir davon überzeugt, dass vom Kollektiv getroffene und mitgetragene Entscheidungen ein Schmiermittel für das Funktionieren moderner Organisation sind.
Mit der digitalen Technik der vernetzten Livekommunikation gelang es immer – sowohl bei der Konferenz in Zürich als auch in anderen Settings –, hilfreiche Stimmungsbilder und Priorisierungen von Themen zu erzeugen. In diesem Sinne entstanden effiziente Varianten demokratischer Abstimmungsprozesse. Auch war das Kollektiv in der Lage, heikle Themen und Schwachstellen auf den Punkt zu bringen. Somit überzeugte der Schwarmansatz durch die erreichte Analysequalität. Schwarmtechnologie ist folglich eine ernst zu nehmende Alternative zu den herkömmlichen Befragungsprozeduren, weil sie schneller – in Echtzeit – zu Ergebnissen führt, die dann wiederum kommentiert und diskutiert werden können.
Als schwieriger erwies sich die Ideenentwicklung in den Gruppen, auch wenn die Aktivierung zum Dialog gelang.
Denn wir stellten häufig fest, dass die Ideen selten besonders stark waren. Vielmehr reihten sie sich in das bestehende Muster, in die vorhandenen Theorien, Überzeugungen und Interpretationen der Organisation ein. Die Ergebnisse waren hundertfach vorgedachte Gedanken. Die Erwartungen an Originalität und Fantasie wurden nicht erfüllt, wenngleich durchaus einige interessante Ansätze entwickelt wurden.
Also stellten wir uns Fragen: Warum sind wir häufig gemeinsam so unproduktiv, wo doch seit Jahrzehnten die Lehraktivitäten in Unternehmen, Schulen und Universitäten immer stärker am Teamgedanken ausgerichtet werden? Weshalb kann der Schwarm nur begrenzt als Vorbild dienen, wenn doch seit vielen Jahren unablässig seine Intelligenz beschworen wird? Sind wir vielleicht eher gemeinsam »schwarmdumm«, so wie es der Titel eines Buches von Gunter Dueck nahelegt? 24
Die amerikanische Juristin Susan Cain, Autorin des bemerkenswerten Buchs zur Rehabilitation der Stillen 25, liefert eine lakonische Antwort: »Manche Menschen wollen, dass wir eine Schwarmintelligenz entwickeln wie Ameisen. Wir sind allerdings keine Ameisen.« Mit dieser unzweifelhaft nachvollziehbaren Aussage wollen wir uns nicht zufriedengeben, sondern den Dingen weiter auf den Grund gehen. Allein schon deshalb, weil es einen Unterschied gibt zwischen den relativ neu entdeckten Schwärmen und den länger bekannten Gruppenphänomenen.26
Beginnen wir mit der Vorstellung vom Schwarm als einem größeren Kollektiv. Der Medienwissenschaftler Stefan Münker liefert eine Erklärung für unsere Beobachtung, dass ein Kollektiv dieser Größe nur eingeschränkt »starke« Ideen produziert. Seiner Einschätzung nach sind der Austausch von Argumenten und erster Lösungsansätze im gemeinsamen großen Rahmen wertvoll.27
Damit wirklich neue, andersartige Lösungen entstehen können, wird im Kollektiv auch zwingend individuelle Intelligenz benötigt.
In gleicher Weise äußert sich der schon erwähnte Praktiker Jaime Lerner. Der mehrfach wiedergewählte Bürgermeister von Curitiba in Brasilien sagte uns im Interview: »Menschen im Kollektiv zu befragen, hat durchaus einen Sinn. Aber es bedarf einer Idee oder einer Vision, an der man dann gemeinsam arbeiten, über die man nachdenken kann. Einfach ein Kollektiv zusammenzurufen und zu sagen: ›Jetzt findet mal Ideen!‹, das gibt nichts Neues, meist entsteht sogar Chaos.«
Doch wieso wird in Kollektiven die Fantasie gehemmt? Hören wir nicht ständig von der Kreativität der Massen und der schwindenden Wertschätzung des im Stillen sinnierenden Genies? Wie kommt es, dass durch elektronische Vernetzung, wie es im Arabischen Frühling oder bei den Protesten in Hongkong in beeindruckender Weise der Fall war, Revolutionen in Gang gesetzt und bestehende Systeme gestürzt beziehungsweise zumindest erschüttert werden – auf die Mobilisierung jedoch keine Neugestaltung erfolgt? Und was bedeutet es für eine digital vernetzte Welt, wenn wir in diesem Kollektiv zwar gemeinsam wortmächtig »meckern und motzen«, aber andererseits keine wirkliche gemeinsame Kreativität entwickeln können?
Der beobachtete Effekt könnte damit zu tun haben, dass soziale Einflüsse die Intelligenz eines Kollektivs negativ beeinflussen. Genau diese Störgrößen hat ein Forscherteam an der ETH Zürich experimentell unter die Lupe genommen.28 In einem Versuch wurden Studenten gebeten, vier Fragen zu beantworten. Es ging um Fakten, die in gewisser Weise bekannt waren, aber nur selten exakt benannt werden konnten. So wurde etwa nach der Länge der Grenzlinie zwischen der Schweiz und Italien gefragt. Es gab insgesamt fünf Durchläufe, in denen die Fragen jeweils unverändert gestellt wurden. In einer ersten Gruppe erhielten die Studenten fortwährend die Mittelwerte der Ergebnisse mitgeteilt, in der zweiten zusätzlich die Einzelwerte ihrer Kollegen. Interessanterweise lag die erste Gruppe deutlich näher an den richtigen Ergebnissen als die zweite. Daraus zogen die Forscher den Schluss, dass die zweite Gruppe gerade wegen der Kenntnis der Einzelwerte unterlag. »Es zeigte sich, dass die Antworten von 145 Befragten im Durchschnitt die besten waren, wenn keiner die Antworten der anderen kannte. Erfuhren die Probanden von den Schätzungen der anderen Studienteilnehmer, verschwanden die Extremwerte nach und nach. Die Schätzwerte kamen zwar einander näher, nicht jedoch dem tatsächlichen Wert.« 29
Die fast schon paradoxe Einsicht lautet: Man muss den sozialen Austausch in einem Kollektiv begrenzen, damit der Schwarm im positiven Sinne wirksam werden kann.
Andernfalls wird die »Konsensmaschinerie« in Gang gesetzt. Wertvolle nonkonforme Einzeleinschätzungen unterliegen dem sozialen Druck. Die Kraft sozialer Einflüsse ebnet dabei nicht nur deutlich abweichende Meinungen ein, sondern führt sogar dazu, dass man nicht mehr zu »gewussten« Eigenschaften steht, wie das folgende Experiment zeigt:
»Kinder bekamen Bilderbücher und sollten sagen, was sie auf den Bildern sehen. Die Kinder dachten, dass sie alle das gleiche Buch in der Hand halten, sie konnten aber in die Bücher der anderen nicht hineinschauen. Eines der Kinder, nur eines, hatte ein anderes Buch bekommen. Auf einer Seite des Buches war ein Bild seiner Mama oder seines Papas zu sehen. Bei den anderen Kindern zeigte diese Seite ein Tier, vielleicht einen Goldhamster. In 18 von 24 Versuchen passten sich die Kinder, die es besser hätten wissen müssen, der Mehrheit an. Sie sahen ein Bild ihrer Mutter und sagten wie alle anderen: ›Ich sehe einen Goldhamster‹.« 30 Wie die Autoren der Studie feststellen, gelte das Ergebnis der hier mit Kindern durchgeführten Untersuchung im Wesentlichen auch für Erwachsene.31
Wenn man mit einem gewissen Abstand zur anfänglichen Euphorie von vor etwa 15 Jahren die Publikationen zur Schwarmintelligenz und deren Übertragbarkeit auf Organisationen betrachtet, zeigt sich die Begrenztheit dieses Konzepts heute deutlich. Die Pheromonstraße der Ameisen oder den Schwänzeltanz der Bienen gibt es deshalb, weil die Insekten dadurch Futter oder die optimale Lage für einen neuen Stock finden. Sie verfügen alle über denselben instinktgesteuerten Algorithmus, der ihr Überleben sichert – das einzelne Insekt jedoch ist dumm. Man könnte auch sagen, es ist wesentlich von angeborenen Mustern gesteuert im Gegensatz zum Menschen, dessen Hirnverschaltungen erst durch die Art ihrer Nutzung »geknüpft, gefestigt und gebahnt werden«32. Das Gehirn von Insekten dagegen ist genetisch programmiert und weitestgehend determiniert. Allein deshalb ist es unzulässig, das auf gemeinschaftliches Überleben programmierte Verhalten von Schwärmen auf menschliches Individualverhalten zu übertragen, das permanent situativ angepasst wird.
Gehen wir also von der naheliegenden Annahme aus, dass menschliche Individuen klüger oder zumindest anders sind als Ameisen oder Bienen. Und nehmen wir ferner an, dass ein beträchtlicher Teil dieser klugen Menschen ganz vielfältige und unterschiedliche Vorstellungen und Ideen hat. Berücksichtigen wir außerdem, dass nach seriösen Schätzungen etwa 30 Prozent der Bevölkerung nicht zum Verkäufertypus zählen, den Susan Cain kritisch als extrovertiertes Ideal der westlichen Welt beschrieben hat, dann müssten wir also Wege finden, wie auch die Intelligenz der Stillen zum Tragen gebracht werden kann. Dabei muss jedoch bedacht werden: Man erachtet Einstufungen in Typen – wie etwa extrovertiert vs. introvertiert, agil vs. flexibel oder dynamisch vs. veränderungsresistent – oftmals als hilfreich, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass es realiter kein Schwarz-Weiß gibt. Menschen sind – da Individuen – unterschiedlich und können dennoch gleichartige Verhaltensmuster zeigen. So sind es beispielsweise die eher ruhigen Menschen, die sich weder bei Teamarbeit noch in Gruppendiskussionen wohlfühlen und eine offene Arbeitsumgebung in Großraumbüros als Belastung empfinden. Sie wollen Sachverhalte für sich alleine durchdringen und nicht genötigt werden, ihre Ideen gemeinsam mit anderen am Flipchart zu entwickeln und der Geschäftsleitung zu präsentieren.
Ebensowenig wie jeder »Stille« ein großartiger Denker ist, muss jeder »Laute« Bedeutsames zu bieten haben.
Da wir wissen, dass es stille Menschen gibt und – wie oben erläutert – ein großes Kollektiv für die Entwicklung mutiger Ideen ohnehin kaum geeignet ist, sind Methoden wie Brainstorming oder andere gruppenbasierte Ansätze durchaus kritisch zu betrachten. Zumindest ist das Dogma: »Alles muss in der Gemeinschaft entwickelt werden« in Zweifel zu ziehen. Interessanterweise ist das Brainstorming, eine von einem Werbefachmann im Jahr 1939 entwickelte Methode zur Ideenentwicklung, bereits in den späten 1950er-Jahren wissenschaftlich untersucht und bezüglich des Neuigkeitsgehalts der auf diese Weise hervorgebrachten Ideen auch negativ bewertet worden. Wolfgang Stroebe, Professor für Sozialpsychologie an den Universitäten Utrecht und Groningen, weist darauf hin, dass das Teilen von Ideen mit anderen regelrecht zu einer »kognitiven Verengung« führen könne, ganz einfach weil man sich auf diejenigen Kategorien konzentriere, die man mit den anderen Gruppenmitgliedern gemeinsam habe.33 Doch dürfen wir hier nicht den Fehler machen, Menschen und deren Verhalten im Team generell mit dem in der Großgruppe gleichzusetzen.
Beginnen wir mit der von Fritz B. Simon als das »Schweizer Offiziersmesser der Managementtheorie« beschriebenen Teamarbeit,34 genauer gesagt mit der falsch verstandenen Teamarbeit. Es wird gemeinhin erwartet, dass die Beschäftigten im Team gute Ergebnisse erzielen, da viele komplizierte, ja komplexe Probleme in einer Gruppe von acht bis zwölf Mitgliedern – mit der darin üblichen Face-to-face-Kommunikation – schneller einer besseren Lösung zugeführt werden können als in der Arbeit Einzelner, deren Lösungen am Ende zusammengeführt werden müssten. Häufig werden jedoch ganze Belegschaften von Konzernlenkern mit dem Ausruf »Wir sind ein Team!« auf Zusammenhalt eingeschworen, nicht selten unter dem Verweis auf den Mannschaftsgedanken aus dem Sport. Hiermit schießt man eindeutig übers Ziel hinaus.
Der Teamgedanke wird zum Dogma und auf das Kollektiv übertragen.
Wenn man weiß, dass durch erzwungene Teamarbeit die Beteiligung introvertierter Menschen erschwert wird, muss einem auch bewusst sein, dass die Genies unter den Stillen ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten und Ideen nicht im möglichen Umfang zur Verfügung stellen werden. Vielleicht wäre ohne Steve Wozniak, den weniger bekannten Apple-Gründer, die Apple Story ganz anders verlaufen. Von ihm sagt man, er habe – ganz im Gegensatz zu seinem Partner Steve Jobs – ein sehr zurückhaltendes Naturell gehabt.35
Eine Ursache für das oft zu beobachtende Scheitern des Teamansatzes kann also eine gegebene Persönlichkeitsstruktur sein; aber auch organisationale Gegebenheiten, wie zum Beispiel ein Individualbonus, die Art des Aufgabenzuschnitts oder das Fehlen von Entscheidungskompetenzen, können Gründe dafür sein, dass keine effektive Teamarbeit entstehen kann.
Sara Ilić ist eine ehemalige Studentin von uns, mit der wir immer wieder gerne zusammenarbeiten, denn sie bringt in unser Team die Sichtweise der »Generation Y« ein und stellt damit unsere eigenen Muster auf die Probe. Sie hat uns zu einem Treffen mit einem echten »Digital-Nomaden« eingeladen. Wir haben nur eine vage Vorstellung von deren Art zu leben. Die vorbereitende Recherche macht deutlich, dass Digital-Nomaden mit leichtem Gepäck um die ganze Welt reisen und dabei an digitalen Projekten mitarbeiten. Besonders beliebt sind bei ihnen die Länder, in denen es eine schnelle, stabile und günstige Internetverbindung gibt und die einen hohen Freizeitwert haben. An formalen Arbeitszeitregelungen, einem festen Gehalt, einem eigenen Büro oder gar an Statussymbolen wie einem repräsentativen Firmenwagen sind die digitalen Nomaden nicht interessiert.
Genau das ist das Leben, das der Mittdreißiger Stefan Klumpp liebt. »Ich war schon immer fasziniert von fremden Kulturen und Menschen aus anderen Ländern«, sagt er uns bei einer Tasse Kaffee. »Ich komme aus einem kleinen Dorf im Schwarzwald, meine Eltern hatten ein Autohaus. Weil ich technisch interessiert war, habe ich eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker gemacht, bevor ich dann Elektrotechnik studiert habe. Eigentlich gute Voraussetzungen, um im Schwarzwald zu bleiben und dort ein abgesichertes Leben zu führen. Doch dann hätte ich die Welt nicht kennengelernt.« Wir erfahren, dass Klumpp 2007 – er arbeitete gerade im Softwareengineering in der Fahrzeugentwicklung – im Fernsehen einen Bericht über die Entwicklung selbstfahrender Autos gesehen hatte. Er schrieb das in der Reportage gezeigte Team an und wurde nach Stanford eingeladen, wo gerade an einem Fahrzeug für die DARPA Urban Challenge 2007, ein Rennen für autonome Fahrzeuge, gebaut wurde. Die Leitung hatte Sebastian Thrun, der bekannte Robotik-Spezialist, ehemaliger Vizepräsident von Google und Mitgründer von Udacity, der erfolgreichen Online-Akademie. Die Länder, in denen Klumpp seitdem irgendwo mitgearbeitet hat, lassen sich kaum mehr alle aufzählen: Schottland, Deutschland, Bali, Südafrika, Spanien …, ohne Frage, er kennt den Globus.
2012 hat er dann mit einem Partner die Firma Mobile Jazz gegründet, die mittlerweile 20 feste und einige freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Den Angestellten steht es frei, von wo aus in der Welt sie mitarbeiten wollen. Das Unternehmen entwickelt digitale Lösungen für so namhafte Kunden wie Google oder Airbus und Branchen wie die der Militär- und der Medizintechnik, wo es um Zuverlässigkeit und Qualität geht.
Wie gelingt es, dass trotz dieser immensen Freiheit, zu arbeiten, wo und wann man will, so sensible und erfolgreiche Produkte entstehen können? Stefan Klumpp erklärt es uns: »Zuerst muss man viel Disziplin haben, denn es gibt auf Bali am Strand jede Menge Ablenkungen. Wir müssen also wirklich alle selbstverantwortlich arbeiten. Es geht nicht, darauf zu warten, dass der Chef sagt, was als Nächstes zu tun ist. Darum brauchen die Neuen oft ein paar Monate, bis sie diese besondere Arbeitsweise verstehen. Das klappt nicht bei allen. Wenn Menschen nicht zu unserer Art des Arbeitens passen, dann müssen wir uns wieder von ihnen trennen. Leider gibt es immer wieder sehr naive Vorstellungen von einem Leben als Digital-Nomade.« Auf unser Nachfragen, wie hoch denn die Trefferquote im Einstellungsprozess neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei, denkt Stefan Klumpp kurz nach und sagt: »Ich würde schätzen, so circa 90 Prozent.«
Wichtig sei auch eine überschaubare Unternehmensgröße. Die liege bei etwa 20 Mitarbeitern. In größeren Gruppen entstünden schnell Misstrauen und Ignoranz. Es werde wöchentlich zu einer festen Uhrzeit geskypt, egal wo die Leute sich auf dem Globus gerade aufhielten – Mobile Jazz Weekly heiße dieser Termin. Der diene dem Austausch, um alle in allen Projekten auf dem neuesten Stand zu halten. »Es geht mir nicht um klassisches Größenwachstum. Und ich sehe mich auch nicht als Unternehmer. Bei uns geht es vielmehr darum, dass jede und jeder persönlich in den Feldern wachsen kann, die sie oder ihn interessieren. Ich liebe Kitesurfen, Wandern und Skifahren, also suche ich mir meine Arbeitsorte entsprechend aus.« Und dann kommt Stefan Klumpp doch noch auf einen Punkt zu sprechen, der so gar nicht einem typischen Digital-Nomaden zu entsprechen scheint. »Da wir weiterhin ein Unternehmen sind, in dem Leute etwas zusammen machen, müssen wir auch wirklich und analog zusammen etwas machen, wodurch eine starke Bindung erzeugt wird. Mehrmals im Jahr arbeiten und leben wir alle für eine oder mehrere Wochen an einem Ort zusammen. Letztes Mal hatten wir ein Haus in Thailand gemietet. Oder wir treffen uns im Winter auch mal eine Woche zum Skifahren in den Bergen. Es wird dann viel zusammen gearbeitet, wer will, kann gemeinsam Sport machen, und manchmal wird auch miteinander gefeiert. So entstehen Freundschaften, und die Identifikation mit der Firma wird gefestigt. Ein Event pro Jahr ist für alle verpflichtend. Bei diesem Anlass ist es dann meine Aufgabe, die Firmenkultur zu erklären und nach Möglichkeiten zu suchen, das Team zu entwickeln.«
Das Leben der Digital-Nomaden scheint uns von starken Ambivalenzen geprägt zu sein. Auf der einen Seite wollen sie die analoge Welt bereisen, können das aber nur, weil die digitale Welt ihnen die Möglichkeit eröffnet. Einerseits leben sie an Orten, an denen klassische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Urlaub machen, andererseits müssen sie sich dem Reiz dieser Orte immer wieder entziehen; denn es gilt, Projekte durchzuziehen und Kunden mit hohem Qualitätsanspruch zufriedenzustellen. Und obwohl man die meiste Zeit im Jahr nur »remote« zusammenarbeitet, ist es zwingend notwendig, in einen ganz engen persönlichen Kontakt zu kommen, der den an standortgebundenen Arbeitsplätzen bei Weitem übersteigt.
Durch das Gespräch müssen wir unser stereotypes Bild von einem IT-Unternehmen revidieren, doch Stefan Klumpp »beruhigt« uns beim Abschied: »Tief drinnen sind wir Mega-Nerds!«
Auch wenn wir das Arbeitsmodell eines Digital-Nomaden sehr interessant finden und viele positive Ansätze darin sehen, bleiben viele Fragen offen: Funktioniert das auch, wenn man schulpflichtige Kinder hat? Wie und wo ist man sozial abgesichert? Können wirklich Freundschaften entstehen, wenn man zwei Wochen pro Jahr im selben Haus zusammenarbeitet? – Was wir aber von Stefan Klumpp und der Zusammenarbeit bei Mobile Jazz gelernt haben, ist Folgendes: Damit Teams funktionieren können, muss es ihnen möglich sein, sich weitgehend selbst zu organisieren und ihre eigenen Spielregeln zu entwickeln. Man benötigt eine Basis, auf der man aufbauen kann. Nur dann haben unterschiedlichste Charaktere – vom stillen Computerfreak bis zum extrovertierten Verkäufer – eine Chance, in Abstimmung mit den anderen ihre Rolle im Team zu finden. Dazu gehört dann allerdings auch die Möglichkeit, sich zeitweise aus dem Team auszuklinken.
Bereits in den 1990er-Jahren hat der Psychologe Kevin Dunbar einen interessanten Versuch gestartet, in dem er in vier führenden Instituten für Molekularbiologie Kameras aufstellte, um die Wissenschaftler bei ihren Arbeitsprozessen zu beobachten. Dabei stellte er fest, dass es höchst selten zu »Heureka-Momenten« kam, in denen sie eine wichtige Entdeckung machten. Die Ideen der Wissenschaftler entsprangen eben nicht der individuellen Beobachtung und Untersuchung am Mikroskop, sondern ergaben sich in der vertrauten Umgebung der Teambesprechung, in der man sich gegenseitig half, ein Problem aus unterschiedlichen Perspektiven zu sehen.36 Hier zeigt sich der Vorteil sinnvoll geplanter Teamarbeit.
Es ist also nicht zwingend das Individuum, das eine Antwort auf die fehlende Kreativität der Großgruppe liefert, sondern die vertraute und selbst organisierte Gruppe.
Der Psychiater, Familientherapeut und Organisationsforscher Fritz B. Simon zeigt auf, dass Großgruppen psychoseähnliche Effekte bewirken. »Grenzen des Individuums scheinen sich aufzulösen, seine Orientierung geht verloren, die Komplexität steigt«, die Folge ist die Zuflucht in die Kleingruppe.37 Ein Phänomen, das man erleben kann, wenn man allein an einer Großveranstaltung teilnimmt. Zu Beginn oder in den Pausen fühlt man sich unwohl, bis man auf Bekannte trifft oder den Blick auf das Bühnengeschehen richtet und dadurch die Großgruppe sich in »einer Art Zweipersonenkommunikation zwischen einem und wenigen Protagonisten« auflöst.38
Bei Formaten wie Open-Space-Veranstaltungen oder Bar Camps sorgt ein hoher formaler Organisationsgrad für eine gewisse Rahmung. Durch die Festlegung von Zeit, Raum, Teilnehmerzahl und Moderatoren wird die Voraussetzung dafür geschaffen, dass sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht verloren fühlen. Kreativität ist dann keine Folge der »großen Gruppe«, sondern entsteht in überschaubaren und geschützten Bereichen innerhalb der Großveranstaltung (etwa in Form von Einzelworkshops und Sessions).
Ungeachtet der Erkenntnis, dass Kollektive nicht als Ganzes zur Entwicklung bahnbrechender Ideen fähig sind, erfreuen sich die Methoden, die uns das Gegenteil suggerieren, bis heute großer Beliebtheit.
Egal ob wir von Schwärmen oder Großgruppen sprechen, es geht immer auch um die Teilhabe an der Schaffung und Bewertung von (neuen) Realitäten im Sinne einer Enthierarchisierung und Demokratisierung ursprünglich elitär geführter Diskurse. Damit wird automatisch die Machtfrage neu gestellt. Im Kern geht es bei der altbekannten Gruppenarbeit in der Automobilindustrie oder in modernen Scrum-Teams der agilen Arbeitswelt wie auch bei internetbasierten »Liquid-Democracy«-Experimenten stets um das Bemühen, viele Menschen an der Ausgestaltung von Strukturen und Prozessen teilhaben zu lassen – ein Ansatz, der in der Politikwissenschaft als Deliberation bezeichnet wird. Demokratie ist, politisch betrachtet, ohne die Weisheit der vielen nicht zu denken.
Allerdings kann der »Strudel der Masse« auch dazu führen, dass demokratische Grundprinzipien wie der der Schutz von Minderheiten oder die Toleranz gegenüber abweichenden Meinungen angetastet werden. Wenn paradoxerweise durch die Einbeziehung von Vielfalt genau diese zerstört wird und der Mainstream die Herrschaft übernimmt, kann von kollektiver Intelligenz nicht mehr die Rede sein. Die stets geforderte Innovationskraft ist dann gefährdet oder wird sogar verhindert – ein Phänomen, das wir gerade in den sozialen Medien beobachten. Diese bieten zunächst ein urdemokratisches Forum, auf dem jeder zu Wort kommen, jeder gehört werden kann. Menschen aus der ganzen Welt begegnen sich und nehmen an einer besonderen Form der Kommunikation teil. Doch dieser kollektive Raum ermöglicht unter dem Schutz der Anonymität auch Hetze und Verschwörung mit tätlicher Gewalt als möglicher Folge und Formen eines Gegeneinanders, das im direkten Austausch so eher nicht erreicht würde. Es kann eine das soziale Gefüge gefährdende Direktheit durchbrechen, die ungeahnte Probleme für die Gesellschaft, also das Kollektiv, erzeugt. Und die Selbstvermarktung – mit der sich die eingangs erwähnte Susan Cain kritisch auseinandersetzt – erhält hier eine noch bedeutendere Rolle als in der realen Welt.
Wenn wir die im Kollektiv vorhandene positive Kraft nicht verlieren wollen, müssen wir Räume schaffen auch für die Darlegung von still entwickelten Ideen Einzelner – selbst wenn sie nicht der Logik der gewieften Selbstvermarktung entsprechen.
Trotz anderslautender Versprechen ist die digitale Welt nur bedingt dafür geeignet, im Kollektiv starke Ideen entstehen zu lassen, wie das folgende Beispiel zeigt.
Als wir uns das erste Mal 2013 in der Schwabinger »Bar Giornale« trafen, erzählte uns Frank Roebers, Vorstandsvorsitzender der Synaxon AG, von einem Werkzeug namens Liquid Feedback (LQFB), das im Jahr zuvor in seiner Firma eingeführt wurde. Genau genommen ging es nicht um ein Werkzeug, sondern um Kulturarbeit, die mit einem durchdachten Instrument in Gang gesetzt werden sollte. Roebers und seine Kollegen in der Führung wollten einen entscheidenden Schritt in Richtung strategische Beteiligung der Mitarbeitenden und Demokratisierung von Entscheidungen gehen, da Initiativen bei entsprechender Mehrheit auch dann umgesetzt werden sollten, wenn der Vorstand gegen sie war. Im Ergebnis wurde das Unternehmen durch das Software-Tool LQFB, das als Experiment gestartet wurde, entscheidend vorangebracht. Die Arbeit mit LQFB lieferte viele Erkenntnisse und beeinflusste die Kultur maßgeblich – bevor die Plattform schließlich nach sieben Jahren nicht mehr benötigt und 2019 abgeschaltet wurde.
Was war der Auslöser für die Einführung dieses Instruments? »Vor ein paar Jahren haben meine Kollegen aus der Geschäftsleitung und ich mit viel Mühe ein neues Leitbild geschrieben«, so Roebers bei unserem Treffen. »Während des Prozesses, über den wir die Mitarbeiter stets informierten, erhielten wir eine Rückmeldung, die erfreulich und ernüchternd zugleich war. 85 bis 90 Prozent der Kolleginnen und Kollegen fanden sich in dem Leitbild wieder, waren also der Meinung, dass geschriebener Text und reales Erleben irgendwie zusammengingen.« Es passte zu dem Westfalen Roebers, dass er den Rest der Rückmeldungen ungeschönt darstellte: »Dummerweise mussten wir akzeptieren, dass zehn bis 15 Prozent der Mitarbeiter offenbar in einem ganz anderen Unternehmen arbeiten als der Rest. Die Kultur, die wir gerade so nett im Leitbild beschrieben hatten, existierte für diesen Teil der Belegschaft überhaupt nicht. In der Geschäftsleitung diskutierten wir daraufhin intensiv, wie wir mit dieser Erkenntnis umgehen sollten.«
An dieser Stelle des Gesprächs von 2013 gingen wir insgeheim im Kopf unsere Kunden und Forschungspartner durch. Andere Unternehmen, so unsere Überzeugung, kämen vermutlich gar nicht auf die Idee, über eine derartige Diagnose weiter nachzudenken. Wo sollte auch das Problem liegen, wenn man nur etwas mehr als ein Zehntel der Menschen verloren hat? Doch das Führungsteam der Synaxon AG, der inzwischen größten IT-Verbundgruppe Europas mit mittlerweile 210 Angestellten, 3800 Verbundpartnern und über drei Milliarden Euro Außenumsatz, wollte sich auch mit vergleichsweise geringen »Verlusten« nicht abfinden und stellte sich zwei entscheidende Fragen: Wie schaffen wir es, dass sich auch diejenigen Kollegen äußern und einbringen, die mit unserer Kultur unzufrieden sind? Und wie gelingt es, dass wir dieses »Outing« unter den Schutz der Anonymität stellen? Während Roebers dies erzählte, wurden wir hellhörig. Wir dachten uns im Stillen: »Wie ernsthaft kann man an einer Kultur arbeiten, wenn der Mut fehlt, Ross und Reiter zu benennen? Lohnt es sich, nach einem Werkzeug zu suchen, wenn die Menschen noch nicht einmal zu einem offenen und persönlichen Austausch in der Lage sind?« Wir verpackten unsere Vorbehalte gegenüber dem in der Online-Welt gängigen Modus der Anonymität in eine moderate Frage, die uns nicht als ewiggestrig-analog erscheinen ließ. Frank Roebers antwortete knapp – und nachvollziehbar: »Es ist ein schöner Gedanke, dass man – wäre die Kultur ideal – gar kein Tool bräuchte. Aber es ist wohl ein bisschen viel verlangt, alle Konflikte offen auszutragen. Vor allem dann, wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter davon ausgehen kann, dass die Führungskraft einen Sachverhalt anders einschätzt als sie oder er.«
Das LQFB wurde wie folgt umgesetzt: Wann immer ein Synaxon-Mitarbeiter ein Anliegen positionieren wollte, konnte es im Liquid-Feedback-System beschrieben werden – ohne Nennung des Namens. Wichtig war nun, für diese Initiative Unterstützung von anderen im Unternehmen zu erhalten. Denn damit eine Initiative überhaupt zur Abstimmung gelangen konnte, musste sie von zehn Prozent derjenigen Kolleginnen und Kollegen, die sich für ein Themenfeld angemeldet hatten, befürwortet werden. Diese Hürde sei ganz bewusst eingebaut worden, damit das Unternehmen von einer Unzahl von Initiativen verschont bleibe, so Frank Roebers damals. »Sie können sich vorstellen, dass es bei den Initiativen dicke und dünne Bretter gibt. Je nachdem, wie dick ein Brett, wie anspruchsvoll also ein Thema ist, geben wir kürzere oder längere Bedenk- und Diskussionszeit. Das hat sich bewährt.«
Für die Abstimmung galt dann: Alle Initiativen mit einfacher Mehrheit sollten umgesetzt werden. »Wir haben uns als Unternehmensleitung dazu verpflichtet, erfolgreiche Initiativen konsequent umzusetzen. Einige fand ich persönlich absolut sinnlos«, so Roebers. »Aber ich bin Bestandteil dieses Systems und würde beim LQFB nur dann von meinem Vetorecht Gebrauch machen, wenn Synaxon als Ganzes gefährdet wäre. Insofern schreite ich nur in Ausnahmefällen ein. Ich muss und will mit der Demokratie leben.« Der Mut, den Frank Roebers und die anderen Vorstände hatten, beeindruckte uns.
Nach sieben Jahren stellte sich heraus, dass eine Software, die Anonymität garantierte, nicht mehr benötigt wurde. Der CEO sagt heute: »In den ersten vier Monaten waren wir mit LQFB schwach gestartet, dann konnten wir vier Jahre ganz herausragende Ergebnisse erzielen und seit drei Jahren benötigen wir das Tool nicht mehr.« In der Anfangszeit war die Beteiligung nicht sonderlich groß. Man vermutete, dass es damals an einer unzureichenden Nutzerführung der Software lag. Auch die Qualität der ersten Vorschläge enttäuschte: So wurde etwa die Anschaffung eines Firmenfahrrads und eines Getränkeautomaten vorgeschlagen. Mit der Zeit besserte man die Software nach, und die Vorschläge wurden mutiger. »Die Mitarbeitenden hatten wirklich bahnbrechende Ideen. Es wurden uns gewünschte Karriereoptionen aufgezeigt, neue Modelle bezüglich Arbeitszeit und Arbeitsort wurden entwickelt. Die Geschäftsleitung wurde bei Personalentscheidungen kritisiert und Gegenvorschläge wurden gemacht. Außerdem konnten wir immer gleich nachvollziehen, wie groß die Zustimmung für diese Initiativen in der Belegschaft war, denn das bildete ja das System ab«, sagt Roebers. »Mittlerweile brauchen wir den Umweg über LQFB nicht mehr. Die Kolleginnen und Kollegen schreiben ihre Vorschläge direkt ins Wiki oder melden sich mit ihren Anliegen bei der Vertrauensperson. Und wenn ich will, dass sich meine Mitarbeitenden zu strategischen Themen einbringen, dann mache ich einen Workshop, in dem sich Menschen in die Augen schauen können. Darum haben wir die Software mittlerweile abgestellt. Und zwar mit mehrheitlicher Zustimmung der Mitarbeiter. Wir hatten vorstandsseitig diesbezüglich eine LQFB-Initiative gestartet, die eine Mehrheit fand. Und zwar schlicht deswegen, weil die Aktivitäten komplett erlahmt waren. Es gab einfach keinen Bedarf mehr an Anonymität im Entscheidungsprozess.« Wir werfen in das Gespräch ein, dass das ja ein sehr gutes Zeichen sei. Roebers antwortet mit einem knappen »Ja« und fährt fort: »Was ich auch gemerkt habe: Je schlechter es uns wirtschaftlich ging, desto mehr wurde die Möglichkeit genutzt, anonym Initiativen zu starten. Je besser es uns ging, desto weniger Initiativen wurden gestartet. Ich weiß noch nicht, wie ich das einordnen muss. Sollte irgendwann wieder der Wunsch nach Anonymität bestehen, dann können die Mitarbeitenden, die diesen Bedarf sehen, sich einfach an die Vertrauensperson wenden, dann wird das System wieder eingeführt. Es wird dafür auch keine Mehrheit mehr benötigt.« Roebers macht eine kurze Pause und fährt dann fort: »Im Gegensatz zum LQFB nutzen wir unser Wiki immer noch sehr intensiv.«
Vor der Einführung von Liquid Feedback gab es bereits – und gibt es seit nun 13 Jahren – ein Synaxon-Wiki, das alle Prozesse und Zuständigkeiten des Unternehmens enthält, also das gesamte Firmenwissen. Jeder Mitarbeiter hat das Recht, Änderungen vorzunehmen, also beispielsweise den Einkaufsprozess neu zu strukturieren. »Seit der Einführung 2007 gab es über 500 000 Änderungen. Es war kein einziger Missbrauch dabei«, betonte Roebers bereits bei unserem ersten Treffen in Schwabing durchaus mit etwas Stolz. Nach nun weiteren sieben Jahren sind nochmals 200 000 Änderungen dazugekommen. Der Missbrauch blieb konstant bei Null. Dann erzählt er uns: »Was euch vielleicht interessieren könnte, in ein paar Monaten löschen wir das gesamte Wiki wieder.« Wir müssen kurz schlucken und fragen uns, warum das? Es müssten doch alle Prozesse optimal sein. »Wir fangen komplett neu auf einem weißen Blatt Papier an. Alle müssen mitentscheiden, was von dem alten Wissen rübertransportiert wird. Wir haben mittlerweile über 80 000 Artikel im Wiki und wollen nicht den gleichen Fehler machen wie die EU und uns überreglementieren, weil wir nicht in der Lage sind, alte Regeln zu löschen – entweder weil wir sie vergessen haben, oder weil sich keiner traut, sich davon zu trennen. Aktivitäten, mit denen wir experimentiert haben, wie zum Beispiel ›Löschtage‹ oder Ähnliches haben sich nicht als sinnvoll erwiesen. Also haben wir gesagt, wir schmeißen eine Bombe rein und fangen von vorne an. Und wer etwas retten will, der muss sich die Mühe machen, die Inhalte rüberzuschaffen. Vor 13 Jahren, als wir mit dem Wiki begonnen haben, sind wir von 120 000 Artikeln auf 4000 runtergekommen. Darum erwarte ich, dass wir dieses Mal von 80 000 auf 3000 kommen.«
Wir finden den Mut spannend, mit dem Roebers immer wieder Neues ausprobiert, sind aber erleichtert, als wir hören, dass für die wirklich wichtigen Themen die klassischen Gespräche von Angesicht zu Angesicht dringend benötigt werden. Die analoge Welt hat sich einen Teil der digitalen wieder zurückerobert.
Der Frage, ob er nach vielen Jahren agilen Arbeitens in der digitalen Welt auch glaube, dass echte Führung gerade in diesen Zeiten viel analoger denken müsste, stimmt Roebers sofort zu. »Digitale Systeme haben unser Arbeiten als Führungskräfte massiv erleichtert. Aufgrund von sehr guten Videokonferenz- und Instant-Messaging-Diensten haben wir zum Beispiel bedeutend mehr Zeit, einfach weil wir nicht mehr so viel reisen müssen.« Im agilen Projektmanagement habe man sogar einen Quantensprung gemacht. Es sei aber nie die Technik selbst, sondern es hänge auch hier davon ab, wie man im analogen Leben unterwegs sei. Wer gut organisiert sei, der profitiere massiv; wer nicht, verliere sich in der digitalen Welt.
Roebers bringt es abschließend auf den Punkt: »Durch die Effizienzsteigerung aufgrund der digitalen Möglichkeiten habe ich für die essenziellen Themen mehr Zeit. Darum ist tatsächlich die Hauptlast in meinem Führungsalltag ›analoger‹ geworden.«
Was bedeuten die gewonnenen Erkenntnisse für die zeitgemäße Ausgestaltung der Führungsaufgabe? Sie wird zweifellos schwieriger und intensiver – und sie sollte ganz in Roebers’ Sinne »analoger« werden. Die Beziehung der Führungskraft zum Mitarbeitenden, zu seinen Ideen, aber auch zu seinen Problemen, rückt in den Vordergrund und kann maximal digital unterstützt, niemals aber durch Digitalität ersetzt werden.
In allen Fällen geht es darum, das unterschiedliche Naturell von Menschen zunächst einmal anzunehmen.
Zudem sollte Führung sich der Nebenwirkungen moderner Großgruppenveranstaltungen – sowohl in analogen als auch digitalen Varianten – bewusst werden und den Mut besitzen, bei der Wahl des passenden Settings gesundes Augenmaß walten zu lassen.
•Musterbrecher nutzen die Analyse- und Bewertungskraft von Kollektiven. Sie haben eine genaue Vorstellung von den Möglichkeiten und Grenzen des Schwarms.
•Musterbrecher zerren stille Genies nicht ins Rampenlicht. Sie drängen die Lauten aber auch nicht in den Schatten.
•Musterbrecher involvieren nicht pro forma. Wenn sie sich dazu entschließen, das Kollektiv mitbestimmen zu lassen, dann ohne Netz und doppelten Boden.
•Musterbrecher verstehen es, die digitale Welt zu nutzen, um dem analogen Denken und Handeln mehr Raum zu geben.
Anmerkungen
23 Martenstein, H.: »Der Sog der Masse«, in: Die Zeit, 10.11.2011.
24 Vgl. Dueck; G.: Schwarmdumm – So blöd sind wir nur gemeinsam, Frankfurt am Main 2015.
25 Vgl. Cain, S.: Quiet – The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking, New York 2012.
26 Die Diskussion um die Begriffe »Gruppe«, »Schwarm« und »Kollektiv« war eine Zeit lang in vollem Gange. Gesichert ist, dass sie nicht als Synonyme aufgefasst werden können. Beim Schwarm ist von der Anonymität der Schwarmmitglieder auszugehen. Die Mitglieder einer Gruppe kennen einander, es kommen deshalb bekannte Phänomene wie Gruppendynamik, Rollen- und Machtverteilung zum Tragen. Wenn hier von kollektiver Intelligenz gesprochen wird, gehen wir von der Annahme aus, dass ein Unternehmen auf der Makroebene als Schwarm gelten kann – und gleichzeitig auf der Gruppenebene analysiert werden muss. Insofern bildeten die Teilnehmer unserer Konferenz zu Beginn der Veranstaltung einen Schwarm, später arbeiteten sie in Gruppen.
27 Vgl. Münker, S.: »›Ideen entstehen nicht durch Schwarmintelligenz‹ – Intellektuelle und das Internet«, Interview in: INDES, Herbst 2011, S. 102.
28 Vgl. Lorenz, J. et al.: »How social influence can undermine the wisdom of crowd effect«, in: Proceedings in the National Academy of Sciences in the United States of America, Vol. 108, No. 22/2011, S. 9020–9025.
29 Grams, T.: »Schwarmintelligenz – Herrschaft des Mittelmaßes«, 2012 (PDF-Dokument verfügbar über: http://www2.hs-fulda.de/~grams/hoppla/wordpress/?p=575) [letzter Abruf 01.03.2020].
30 Martenstein, H.: »Der Sog der Masse«, in: Die Zeit, 10.11.2011.
31 Vgl. Haun, D./Tomasello, M.: »Conformity to Peer Pressure in Preschool Children«, in: Child Development, 11/12-2011, Vol. 82, No. 6, S. 1765.
32 Hüther, G.: Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn, Göttingen 2009, S. 53.
33 Vgl. Stroebe, W./Nijstad , B. A.: »Warum Brainstorming in Gruppen Kreativität vermindert: Eine kognitive Theorie der Leistungsverluste beim Brainstorming«, in: Psychologische Rundschau, Jg. 55, Nr. 1/2004, S. 9.
34 Vgl. Simon, F. B.: Gemeinsam sind wir blöd? Die Intelligenz von Unternehmen, Managern und Märkten, 5. Aufl., Heidelberg 2019, S. 142 ff.
35 Vgl. Cain, S.: Still – Die Bedeutung von Introvertierten in einer lauten Welt, München 2011, S. 117 f.
36 Vgl. Johnson, S.: Wo gute Ideen herkommen – eine kurze Geschichte der Innovation, 2. Aufl., Bad Vilbel 2013.
37 Vgl. Simon, F. B.: Gemeinsam sind wir blöd? Die Intelligenz von Unternehmen, Managern und Märkten, 5. Aufl., Heidelberg 2019, S. 282 f.
38 Ebd.