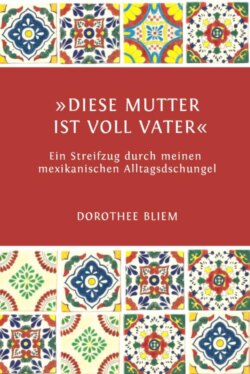Читать книгу "Diese Mutter ist voll Vater" - Dorothee Bliem - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
La Casona Comonfort - Vom Wohnen etwas fürs Leben lernen
ОглавлениеKeine Angst, das hier ist keine IKEA-Werbung. Im Gegensatz zu vielen anderen Kapiteln meines Lebens beginnt mein Kapitel Mexiko ausnahmsweise nicht mit einem strapaziösen Besuch im schwedischen Möbelhaus. Laut meinem zukünftigen Chef erwartete mich nämlich eine voll ausgestattete Wohnung. Voll ausgestattet! In diesem Zusammenhang wurde ich mir wieder einmal des Schönen, gleichzeitig aber auch Beängstigenden an Begriffen bewusst: ihrer Dehnbarkeit. Was für meinen Chef »voll ausgestattet« bedeutete, rief bei meiner Mutter erniedrigende Kommentare wie »Du wohnst ja im Slum!« hervor. Mein anfänglicher Ärger über diese Parallele galt eigentlich mir selber, denn auch ich sah anfangs nur das Gefälle zu meinen bisherigen Wohnstandards. Mit der Zeit eröffnete sich mir jedoch eine ganz neue (Wohn-)Welt. Unter der Oberfläche von improvisierten Möbeln und zweckentfremdetem Hausrat entdeckte ich eine Mentalität, die durch ihre Genügsamkeit fast eine Art buddhistische Freiheit in sich trug: nichts zu wollen, was man nicht hat.
In diesem Kapitel entführe ich euch in mein mexikanisches Hippiehaus. Gemeinsam überwinden wir den ersten Kulturschock und lernen, wie man den typischen Herausforderungen des mexikanischen Alltags begegnet. Dabei werden wir erkennen, dass gerade im Verzicht viele erheiternden Seiten des Lebens zutage treten.
Im Januar 2017 stand ich erstmals vor der Tür, die von jenem Augenblick an das Tor zu meinen mexikanischen vier Wänden sein würde. Für mein Gefühl unterschied sich die Haustür Nr. 715 nur durch ein Stück weiße Kreide von all den anderen Haustüren der Calle Ignacio Comonfort im Zentrum von San Luis Potosí. Die Kreide steckte in einem zeigefingergroßen Loch und sollte uns Bewohner, so meine Vermutung, vor voyeuristischen Passantenaugen schützen. Neben mir stand Hector, der Chauffeur des Centro Cultural Alemán, meiner zukünftigen Arbeitsstätte. Von einem Chauffeur vom Flughafen abgeholt zu werden, stellte ich mir aufregend und exklusiv vor. Hector kam jedoch nicht mit einem polierten Hochglanzschlitten angefahren, sondern mit einem klapprigen VW-Käfer. Auch Hectors Aufmachung entsprach nicht gerade dem Bild des klassischen Chauffeurs: Anstelle von Hut, Handschuhen, Anzug und Krawatte trug er ein lockeres Paar Jeans und ein Polohemd.
Auf der Fahrt hatte mir Hector bereits von meinem zukünftigen Mitbewohner Salvador und dessen Renovierungskünsten erzählt. Die Kreide ließ nun durchsickern, dass diese »Renovierungskünste« wohl ihrer ganz eigenen Definition bedürfen. An der hölzernen Haustür prangte ein eiserner Türklopfer. Er war nicht nur zur Zierde, denn neben der Klingel klebte ein handgeschriebener Zettel mit der Aufschrift: »Timbre no sirve« – ›Klingel funktioniert nicht‹. Die Klingel muss ihren Dienst schon vor längerer Zeit niedergelegt haben, denn der Zettel hatte bereits einige Regenfälle gesehen. Hector klopfte dreimal. Nichts passierte. Er klopfte weitere dreimal. Wieder nichts. Erst das fordernde »¡Holaaaaa!«, das er in die Ungewissheit hinter der löchrigen Tür schickte, setzte das Leben dort in hörbare Bewegung. Zwei Schlüsselumdrehungen entriegelten die Tür.
Noch bevor ich die menschlichen Züge meiner zukünftigen Mitbewohner erahnen konnte, umhüllte mich eine dicke Rauchwolke, ein Gemisch aus Tabak und aromatischen Terpenen. Letztere sind für den charakteristischen Cannabisgeruch verantwortlich. Inmitten der Rauchwolke schlangen sich zweimal zwei Arme um mich und bestätigten, dass das Kreidestück inklusive mir mindestens zwei Frauen und einem Mann dienlich sein würde. Ich hörte die Namen Amelie und Salvador und hatte jetzt zumindest eine Stimme zum Renovierungskünstler und meiner deutschen Kollegin, von der mir mein Chef bereits erzählt hatte. Amelie war wie ich als Deutschlehrerin nach San Luis gekommen und wohnte seit einem halben Jahr mit Salvador und drei weiteren Mitbewohnern unter einem Dach. Wobei man das mit dem Dach nicht zu wörtlich nehmen darf. Neben Amelie und Salvador gab es noch den langgezogenen Carlos und sein optisches Gegenstück, den kleinrunden Norberto. Salvador teilte sich sein Zimmer mit seiner Freundin Rigel, benannt nach dem hellsten Stern im Sternbild Orion.
Mein Begrüßungskomitee führte mich durch einen fünfzehn Meter langen, unüberdachten Gang, von dem links drei fensterlose Schlafzimmer abzweigten. Die rechte Wand war geziert von Aloe Vera und anderen, auch in Mexiko nicht ganz legalen, Grünpflanzen. Am Ende des Ganges hing über einer Tür ein WLAN-Router, den ich nur anhand seiner Antenne identifizierte. Um vor dem Regen geschützt zu sein, war das Herzstück des Routers in einen knittrigen Plastiksack gehüllt worden.
Die Tür führte in das belebteste Zimmer des Hauses. Wofür es bestimmt sein sollte, war meinem kategorisierenden Geist in diesem Moment noch nicht ersichtlich. Esszimmer? Oder Raucherzimmer? Arbeitszimmer? Malzimmer? Reines Durchgangszimmer oder schlichtweg Wohnzimmer? Die paar Quadratmeter wurden von einer querliegenden Tür auf zwei Tischblöcken fast komplett ausgefüllt. Drumherum zusammengewürfelte Stühle mit den ebenfalls zusammengewürfelten Freunden meiner Mitbewohner. An der schmalen Wand erkannte ich die Umrisse der für Mexiko charakteristischen Virgen de Guadalupe. Dieses Gnadenbild der Maria findet man in jedem traditionsbewussten mexikanischen Haushalt. Der Legende zufolge erschien dem Indianer Juan Diego im Dezember des Jahres 1531 die Mutter Gottes, die ihn mit dem Bau einer Kirche beauftragt haben soll, der Basilica de Guadalupe. Acht Millionen Indios wurden innerhalb der darauffolgenden Jahre zum Christentum bekehrt. Die Basilica im Norden von Mexiko-Stadt ist heute ein beliebter Wallfahrtsort und das Marienbildnis allgegenwärtig. Für gläubige Katholiken wäre die Guadalupe an unserer Wand jedoch vermutlich ein blasphemischer Affront gewesen. Meine Mitbewohner waren nämlich gerade dabei, sie in einen T-Rex umzuwandeln, unseren Guadarex. Ein erstes Indiz dafür, dass mein mexikanisches Wohnerlebnis nicht ganz den traditionellen Standards entsprechen würde.
Hinter diesem Zimmer mit dem Guadarex befand sich ein abstellkammerartiger Innenhof. Mein Blick blieb an einer riesigen, schwarzen Mülltonne hängen, deren Deckel durch die aufeinandergestapelten Müllsäcke bereits ziemlich hoch gewandert war. Da der Turm in sich zusammenzufallen drohte, packte Salvador eines der herausstehenden Säckchen und platzierte es ganz oben, über dem Mülltonnen-Mittelpunkt. Der Deckel wanderte weiter in die Höhe, doch der Turm stand. Im Müll-Jenga wieder eine Runde weiter.
Über den Innenhof gelangte man zu Bad, Küche und einem weiteren Schlafzimmer. Nach der durchlöcherten Haustür und dem bunten Türtisch war ich mir nun unsicher, was es mit der Badezimmertür auf sich hatte. War sie das Resultat künstlerischen Schaffens oder das traurige Ergebnis einer Fehlkalkulation? Die Tür reichte nicht bis an die Decke, sondern ließ, wie viele öffentliche WCs, nach oben hin einen ziemlich großen Spalt frei. Es ragte zwar höchstens Carlos’ Kopf darüber hinaus, doch wer neben der visuellen auch auf akustische Abgeschiedenheit Wert legte, tat gut daran, seine Notdurft an einem anderen Ort zu verrichten.
Vom Innenhof führte eine steile Betontreppe zu meinem Zimmer. Es war das einzige Zimmer im Obergeschoss. Beim Anblick der Treppe war ich für einen kurzen Moment froh, dass es mein Gepäck nicht bis nach San Luis geschafft hatte. Laut Flughafenpersonal sollte mein Koffer zwar automatisch von Houston nach San Luis weitertransportiert werden, doch am Ende erreichte ein Großteil der Passagiere San Luis ohne Gepäck. Hector zeigte sich darüber nicht weiter überrascht. Er hatte die Zeit am United-Airlines-Schalter schon einkalkuliert und half mir über meine noch ziemlich holprigen Spanischkenntnisse hinweg. Bis ich endlich den langersehnten Outfitwechsel durchführen konnte, sollte es jedoch eine geschlagene Woche dauern.
Als ich die steile Treppe zu meinem Zimmer erklomm, machte mir am meisten meine schwache Blase Sorgen: Immerhin würde ich mich für jeden Toilettengang den gegebenen Wetterverhältnissen und 15 scharfkantigen Stufen aussetzen müssen. Schnee und Überschwemmungen hielt ich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise noch für unrealistisch.
Als letzten Raum präsentierte mir Salvador nun mein Zimmer. Der Boden bestand zur einen Hälfte aus schlichtem Beton, zur anderen Hälfte aus einem hölzernen Podest. Dieses Podest diente anscheinend der Stabilität des Raumes, was ich vorsichtshalber nicht hinterfragte. Es bot Platz für mein Bett mit einer dicken, durchgelegenen Matratze sowie für einen kleinen Nachttisch mitsamt Nachttischlampe. An Mobiliar gab es ansonsten einzig ein paar Holzbretter, die Salvador höchstpersönlich mithilfe einer Limettenpresse an die Wand genagelt hatte. Ein weiterer Vorgeschmack dessen, was mich in diesem Haus noch erwarten würde. Dass ich dort tatsächlich noch so vieles erleben würde, hätte ich anfangs nicht gedacht: Über die Rustikalität erschrocken, konnte ich mir nicht vorstellen, länger als unbedingt nötig zu bleiben. Und obwohl ich noch nicht wusste, ob ich es mit meiner mexikanischen WG verhältnismäßig gut oder schlecht getroffen hatte, plante ich im Geiste schon meinen Umzug. Warum war ich also ein Jahr später immer noch da?
Ich hatte zum Glück schnell erkannt, dass ich von meiner österreichischen Komfortzone direkt in die mexikanische Panikzone geschlittert war. Die fremde Umgebung, das kahle Haus, die rauchenden Mitbewohner und die Zeitverschiebung verursachten primär eines: Stress! Das Eustress-Level war dabei längst überschritten und ich heillos überfordert. Erst versuchte ich mir einzureden, dass diese Panik eine ganz normale Reaktion sei, die von selbst wieder abklingen würde. Den Moment machte dieser Gedanke jedoch auch nicht erträglicher. Ich verlor mich für einige Stunden in einem Buch und fasste den etwas schizophrenen Plan, einfach selbst zur Romanfigur zu werden – aus mir herauszutreten und mich von oben zu betrachten. Wie reagiere ich auf mein neues Leben in diesem absurden Hippiehaus? Was gibt es sonst noch zu entdecken? Und was kann ich aus diesem Abenteuer lernen? Tatsächlich half mir diese Strategie dabei, mich physisch und psychisch auf Mexiko einzulassen. Stück für Stück begann ich, die Casona, wie wir unser Haus liebevoll nannten, in mein Herz zu schließen – denn mit ihrer (vermeintlichen!) Unvollkommenheit hat sie mir sehr viele Dinge gelehrt. Zum Beispiel, wie schön ein Leben als Provisorium sein kann.
Nach einer Phase des Eingewöhnens war ich richtig beschämt darüber, wenn ich daran zurückdachte, wie schwer es mir fiel, meinen knallroten Milchaufschäumer zuhause zurückzulassen. Der Verzicht auf die milchige Schaumhaube auf meinem morgendlichen Kaffee erschien mir nicht unwesentlich. Aber man kann nicht alles haben – bei 22 Kilo Heimat für (geplant) 365 Tage waren nun einmal Prioritäten zu setzen. Ich ging richtig in der Annahme, dass ich als verwöhnte Besitzerin skurriler Haushaltsartikel auf viele meiner geliebten, neudeutschen »Gadgets« würde verzichten müssen. Am Ende verzichtete ich allerdings nicht nur auf das eine oder andere Luxusgut, sondern auch auf klassischere Alltagshelfer, die mir bis dahin selbstverständlich erschienen waren: Wir hatten weder Mikrowelle noch Wasserkocher, lebten ohne Staubsauger und Bügeleisen – von einer Spülmaschine ganz zu schweigen. Und auch Dosen- oder Flaschenöffner suchte ich vergeblich. Bei manchen Dingen bin ich mir bis heute noch nicht sicher, ob es sie in Mexiko überhaupt gibt. Zumindest im Falle des Staubsaugers hatte ich den Eindruck, dass sich der Mexikaner diesem Gerät aktiv verweigert – war doch der Besen sein liebstes Accessoire. Ob in Wohnhäusern oder Einkaufszentren, auf Straßen oder Baustellen – irgendwer war immer am Kehren. Meiner Auffassung nach entspricht der Begriff Kehren ja dem gezielten Beseitigen von Staub, Bröseln oder ähnlichem Dreck. In Mexiko hingegen scheint vor allem die Zielgerichtetheit keine entscheidende Bedeutungskomponente zu sein. Die Gemächlichkeit, mit der so manch Besen durch die Gegend wedelte, war bemerkenswert. Das Fegen, Kehren oder eben das sinnbefreite Staubaufwedeln muss für den Mexikaner also eine willkommene Freizeitbeschäftigung darstellen, so meine Schlussfolgerung. Für mich persönlich war der Verzicht auf den Staubsauger zwar weniger unterhaltsam, doch immerhin übte ich mich damit in der Entschleunigung. Denselben Effekt hatte der nichtvorhandene Geschirrspüler. Dabei musste ich bei der meditativen Tellerwäsche immer wieder über eine kuriose Vorrichtung schmunzeln: den Schwammbecher. Der Schwammbecher gehört zum festen Inventar mexikanischer Haushalte. Es handelt sich dabei um einen alten Plastikbecher, in dem der Spülschwamm in alter Spülsuppe auf seinen nächsten Einsatz wartet. Ich war in der Bakteriologie zum Glück nicht gut genug bewandert, um genaue Vorstellungen davon zu haben, was dieser Schwammbecher bazillenmäßig bedeutet.
Viel bedrohlicher als die Schwammbazillen schien mir beim Abwasch die Gefahr des sich leerenden Wassertanks. Unbegrenzt fließendes Leitungswasser ist in Mexiko nämlich keine Selbstverständlichkeit. Auf den Hausdächern stehen runde Wassertanks, die regelmäßig von einer elektrischen Wasserpumpe befüllt werden müssen. Unsere Wasserpumpe – die Bomba – konnten wir mit einem Stromkabel in Salvadors und Rigels Zimmer aktivieren. Mit einem ratternden Geräusch teilte sie uns mit, dass sie dabei war, unsere Wasservorräte sicherzustellen. Dafür reichten in den meisten Fällen 30 Minuten pro Tag. Noch erleichternder als beim Abwasch war die Gewissheit über die Wasserversorgung übrigens nach dem »großen Geschäft« – um einiges erleichternder als die Darmentleerung an sich. Stellte man nämlich fest, dass der Spülhebel keinen Widerstand leistete und die Verdauungsreste somit nicht bald der Kanalisation zugeführt werden konnten, hätte man sie retrospektiv doch lieber bei sich behalten. Nur bei Salvador löste dieses Gefühl keine Beklemmnis aus; zumindest war er der Einzige, der sich dieses Problems nicht immer unmittelbar annahm. Meinen restlichen Mitbewohnern war es zum Glück kein Bedürfnis, nachfolgende WC-Benutzer mit ihren schwimmenden Hinterlassenschaften zu beglücken. Wer jedoch versuchte, das Problem mit Toilettenpapier zu kaschieren, der schoss sich selbst ins Knie. Durch die engen Abflussrohre gibt es einen guten Grund dafür, dass der für Toilettenpapier prädestinierte Ort nicht die Kloschüssel, sondern der Mülleimer ist. Es hieß also wohl oder übel, sich unauffällig des Trinkwasserkruges zu bemächtigen, um den Spülkasten manuell zu befüllen. Erst dann konnte man beruhigt darauf warten, dass die Bomba ihre Dienste tat. Neben den Wasservorräten sind in mexikanischen Haushalten auch die Gasvorräte begrenzt. Gleich wie der letzte Wassertropfen immer in den ungünstigsten Momenten schwindet, leert sich auch der Gastank meist dann, wenn man gerade einen Topf Suppe am Herd stehen hat. Bestenfalls schwimmen darin noch rohe Fleischstücke, die man auch in Mexiko vorzugsweise in gekochtem Zustand verzehrt. Was also, wenn das Flimmern der Gasflamme seine Endlichkeit ankündigt? Im Prinzip sollte ein Anruf bei einem der zahlreichen Gasanbieter Abhilfe schaffen. In der Realität ist das allerdings oft nicht ganz so einfach. Zum Beispiel sonntags. Oder, wenn trotz vereinbartem Termin niemand auftaucht. Oder man das Klopfen dank kaputter Klingel einfach nicht hört. Da Not aber bekanntlich erfinderisch macht, lernte ich: Suppe kann man auch grillen.
Spätestens wenn die nächste Dusche fällig war, freuten wir uns aber doch, wenn ein muskulöser Herr von Potogas vor der Tür stand. Geschultert mit einer Gaspatrone bahnte er sich seinen Weg in unseren Innenhof, wo er die Patrone mit ein paar gekonnten Handgriffen austauschte. In vielen Häusern befindet sich die Gaspatrone jedoch auf den flachen Hausdächern, unweit des Wassertanks. In diesem Fall braucht man einen der mobilen Gastanks, die täglich ihre Runden durch die mexikanischen Städte drehen. Wie Eiswägen kündigen sie sich durch ein lautes Klingeln an. Schafft man es, sie rechtzeitig anzuhalten, klettern die Gasbefüller über eine Leiter direkt aufs Dach und machen ihrem Namen dort mithilfe eines Schlauchs alle Ehre.
Sobald der Tank gefüllt ist, dient das Gas in Mexiko übrigens ausschließlich Herd, Backofen und Boiler. Heizungen im klassischen Sinne sind Fehlanzeige. Im Vergleich zur milchigen Schaumhaube ein etwas schwerwiegenderer Verzicht. Mit seinen fast zwei Millionen Quadratkilometern wartet das Land aber nun einmal nicht nur mit tropischen Temperaturen auf. Was es bedeutet, einen harten Winter zu erleben, wurde mir skurrilerweise erst in Mexiko annähernd bewusst. In San Luis Potosí herrscht Steppenklima, wobei sich die Temperatur im Januar – dem kältesten Monat – durchschnittlich zwischen 6 und 22°C bewegt. Von zuhause kannte ich zwar weitaus niedrigere Temperaturen, doch immerhin lebte ich dort in einem gut isolierten und wohlbeheizten Haus. Unser mexikanisches Altstadthaus hingegen war isolierungstechnisch alles andere als auf dem neuesten Stand. Mit dem Winter 2017/2018 erwischte ich noch dazu einen sehr kalten mexikanischen Winter, dem irgendwann auch Fleecepullover und mehrere Schichten an Wolldecken nicht mehr Herr wurden. Die Verzweiflung meiner späteren Mitbewohnerin Franzi ging so weit, dass sie sogar ihre Kriterien bei der Partnerwahl überdachte: Eine Heizung schaffte es ganz nach oben auf ihre Liste der männlichen Must-Haves, doch leider fand sich nicht ein einziger geeigneter Kandidat. Auch sie musste die Kälteperiode also in unserer Küche überbrücken, wo wir den Backofen zum Kachelofen umfunktionierten. Obwohl sie nach dem Innenhof der ausladendste Raum unseres Hauses war, hätte ich mich zu dieser Zeit nirgends lieber aufgehalten als in der Küche.
So unangenehm sie auch sein mochten, ließen mich genau solche Momente eine Facette dessen entdecken, was mein Leben in Mexiko so erfrischend machte: unser Hippiehaus als mich immer rettendes Provisorium. Einmachgläser wurden zu Trinkgläsern, Pfannen zu Deckeln, der Backofen zur Heizung. Schraubhaken fungierten als Flaschenöffner, Limettenpressen als Hammer, Putzeimer als Blumenvasen. Bretter waren Schaukeln, die Dachterrasse Freiluftkino und die letzten Liter Trinkwasser der heilige Gral der Toilettenspülung. Plötzlich war alles möglich und nix fix. Einzig für den chronischen Klopapiermangel haben wir leider nie eine Lösung gefunden.