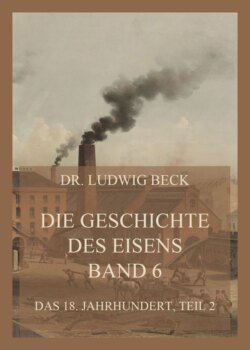Читать книгу Die Geschichte des Eisens, Band 6: Das 18. Jahrhundert, Teil 2 - Dr. Ludwig Beck - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Eisenbereitung im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts. Luppenfeuer 1775 bis 1800.
ОглавлениеWeitere Entwicklung der Schmiedeeisenbereitung in Luppen- und Frischfeuern. 1775 bis 1800. Indem wir in den folgenden Kapiteln einen Überblick über den Stand und die Fortschritte der Eisenbereitung im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts geben, beginnen wir mit der direkten Gewinnung schmiedbaren Eisens aus den Erzen, die zwar an Bedeutung mehr und mehr verloren hatte, aber doch immer noch eine Rolle spielte.
Dass die Luppenfeuer auf adligen Gütern in Deutschland in dieser Zeit noch gebräuchlich waren, geht aus dem Artikel in Krünitz’ Enzyklopädie (1785) und einer Abhandlung von Justi von 1771 hervor.
Nach Beschreibung der ältesten Luppenfeuer, welche an Bergabhängen angelegt worden seien und aus einem größeren Schmelzloch und einem tiefer gelegenen kleineren Schlackenloch bestanden hätten, heißt es:
„Von dieser leichten und einfältigen Art, das Eisen auszuschmelzen, sind vermutlich die sogenannten Luppenfeuer entstanden, die schon seit vielen Jahrhunderten in Deutschland stattfinden und deren sich die Adligen, welche auf ihren Gütern mit dem Bergwerksregal oder mit dem Eisenhüttenrechte beliehen sind, noch heutigen Tages sehr häufig bedienen. Bei diesen Luppenfeuern findet dieselbe Einrichtung statt: ein oben solches rundes und unten ovales Loch zum Einschmelzen; ein oben dergleichen, aber weniger tiefes Loch in einem Orte der Eisenhütte, welcher 5 bis 6 Fuß tiefer ist als die Erhöhung, in welcher sich das Schmelzloch befindet und in welches die Schlacken aus dem letzteren ablaufen; nur ist man bemüht gewesen, den Anstalten zum Luppenfeuer eine größere Dauerhaftigkeit zu geben. Sowohl das Schmelz- als Schlackenloch sind mit feuerbeständigen Ziegelsteinen ausgemauert und anstatt des Zugloches der Alten hat man 4 bis 5 Zoll von dem obersten Rande des Schmelzloches ein doppeltes Gebläse, jedoch gemeiniglich nur von Leder, angebracht, welches durch ein Wasserrad getrieben wird. — Das durch das Luppenfeuer gewonnene Stabeisen ist gemeiniglich sehr gut, aber die ganze Anstalt taugt nichts. Sie ist eine Verschwendung sowohl der Kohlen als des Eisensteins.“
Bei dem Schmelzen wird erst das Schmelzloch und das Schlackenloch vorgewärmt, dann lagenweise Holzkohle und gepochter Eisenstein mit dem nötigen Zuschlag aufgetragen und zu einem förmlichen Hügel über der Öffnung aufgetürmt. Das Ganze schmilzt zu einer Luppe zusammen, von der man, wenn sie fertig ist, die Schlacke absticht, die Kohlen wegräumt und die Luppe aufbricht. Da die Verbrennung beinahe in freier Luft erfolgt, so ist die Verschwendung von Kohlen und Eisenstein eine unmäßige.
„Man muss sich in der Tat verwundern, dass diese Luppenfeuer in Deutschland noch immer beibehalten werden, da man doch heutigen Tages weit bessere und vorzüglichere Anstalten zum Eisenschmelzen hat.“ Dass dies doch geschehe, liege hauptsächlich in der Kostspieligkeit der besseren Anlagen, denn einen Hochofen zu erbauen, koste an 3000 Taler und eine Hochofenhütte mit allen dazu gehörigen Anlagen und Gebäuden 20000 Taler und mehr. Koste doch ein Blauofen 1200 bis 1500 Taler zu bauen.
Zur Verbesserung dieser Luppenfeuer schlug deshalb Justi vor, sie mit einem Steinkranz zu überbauen. Dieser Vorschlag, der durchaus unpraktisch war, hatte keinen Erfolg und genügt es, ihn erwähnt zu haben.
Im ganzen war die direkte Eisenbereitung in Deutschland mehr und mehr im Verschwinden begriffen. In Sachsen, wo früher die Luppenfeuer verbreitet gewesen waren, fand Stockenström auf seiner Informationsreise im Jahre 1778 keins mehr vor, in Thüringen nur ein einziges in dem meiningischen Dorfe Steinbach (s. Bd. I, S. 782). Dieses erwähnt auch der Bergamtsassessor Wille noch 1786. Ebenso war es am Harz, wo nur in Uslar noch in einem Luppenfeuer Frischschlacken zeitweilig verschmolzen wurden. Es geschah dies in einem Zerenn- oder „Zentnerherd“, eigentlich Zehntnerherd. Seit alter Zeit hatte nämlich die Landesherrschaft am Harz den ihr zukommenden Erzzehnten in eigenen Zehntnerherden verschmolzen und hatten sich diese auch nach Einführung des Hochofenbetriebes an manchen Plätzen erhalten. Ein solcher alter Zehntnerherd war bei Uslar, der von höchst primitiver Konstruktion war. Er hatte weder einen eisernen Boden, noch eiserne Seitenzacken. Die Herdgrube wurde vielmehr aus feuchter Stübbe, ähnlich wie ein Garherd, geschlagen und die Seitenwände nur zum Schutz gegen das Einwerfen der Beschickung oben mit eisernen Platten abgedeckt. Die Breite von Form- zur Windseite betrug 21 Zoll, die Tiefe bis zur Mitte des Gestübbebodens 12 Zoll. Formlage und Formmaul waren wie bei einem Frischfeuer. Die Bälge waren kleiner, wechselten aber rascher. Beim Anlassen wurden vier Maß kleine Kohlen von Zweigen und schwachen Ästen von Laubholz (Grubenkohlen) aufgegeben und dann vier Schaufeln ganz fein gepochter Frischschlacke darüber gebreitet. Hierauf gab man wieder Kohlen u. s. w., so dass man etwa 8 Ztr. Schlacke in 5½ Stunden durchsetzte. Anfangs blies man langsam, zuletzt rasch, damit in der Masse eine Scheidung erfolgte und die kleine Luppe von 1¼ bis 1¾ Ztr. Gewicht sich ansammelte. Die Luppe oder der Deul wurde unter dem „Zentnerhammer“, einem Stabhammer, fertig gemacht und ausgeschmiedet.
Weil dieses Zerenneisen aber meist noch roh und undicht war, so wurde es gewöhnlich noch einmal im Frischherd geschmolzen und gab dann ein sehr gutes Eisen. Die Arbeit erforderte einen sehr rohen Gang und wurden zuletzt oft Schlacken abgelassen.
Dieses Verfahren wurde auf Rinmans Empfehlung in Schweden eingeführt und dort verbessert.
In Schlesien befanden sich nach Karstens Angabe im Jahre 1780 noch 17, 1790 noch 10 Luppenfeuer, davon 10 in Niederschlesien und 2 in Oberschlesien. Die letzteren gingen 1798 ein; von den ersteren waren 1814 noch 4 zu Greulich, Alt-Öls, Modlau und Nieder-Leschen im Betrieb. Es wurden Rasenerze darin verschmolzen.
Eins der letzten Luppenfeuer in Oberschlesien, das des Grafen Colonna zu Tworock, hat Eversmann abgebildet, Fig. 179. Er beschreibt es als ein Ding, wie eine märkische Ambossschmiede, nur dass der Herd eine in Kohlengestübbe gemachte größere und ungefähr 1 bis 1½ Fuß tiefe Öffnung hatte. Die Eisenerze von Tarnowitz, welche leichtflüssig sind, wurden ohne weitere Vorbereitung in einen Handkübel voll Wasser geschüttet, dass sie etwas zusammenklebten und so mit dem Wasser auf dieses Feuer geschüttet, vor dem zwei große Frischbälge mit ziemlich stechender Form lagen. So wie sie niedergegangen waren, wurden wieder frische aufgethan und die Kohlen angeschürt, bis eine Luppe von ungefähr 150 Pfund im Feuer war, die dann aufgebrochen und unter dem Hammer in Stäbe geschlagen wurde. Zu einem Zentner Eisen rechnete man 1½ Korb Kohlen (etwa 46 Kubikfuß). In 24 Stunden wurden drei Luppen gemacht. Zu zwei Luppenfeuern waren 4 Schmiede, 4 Luppenschmelzer und 2 Kohlenschütter erforderlich. Das Erz wurde klar gepocht und Kalk zugeschlagen.
Auch in der Oberpfalz waren von den Zerennfeuern, welche die Brauneisensteine von Amberg verschmolzen, Ende des vorigen Jahrhunderts noch einige im Betrieb. Das halbgare Zerenneisen wurde in besonderen Löschfeuern zu geschmeidigem Eisen umgearbeitet, wobei es 33 Prozent verlor.
In England wurden keine Luppenfeuer (bloomeries) mehr betrieben.
In Schweden waren die alten Bauernöfen fast verschwunden. Dagegen war der Betrieb von Luppenschmieden noch in ausgedehnter Anwendung in den Vereinigten Staaten von Nordamerika und in den Pyrenäen.
In Frankreich gab es nur in den südlichen Provinzen Luppenfeuer, die von den französischen Metallurgen nur wenig beachtet wurden, bis im Jahre 1775 der Artilleriehauptmann Tronson du Coudray durch eine Schrift, in welcher er die Eisenmanipulationen in Korsika und in der Grafschaft Foix beschrieb, die allgemeine Aufmerksamkeit darauf lenkte und eine nachhaltige Diskussion über die Vorteile der direkten Schmelzmethode anregte, die von geschichtlicher Bedeutung ist. Tronson du Coudray kam nämlich, nachdem er das Verschmelzen der elbanischen Erze in Korsika und die katalonische Schmelzart in Roussillon und der Grafschaft Foix beschrieben hatte, zu dem Schluss, dass die katalonische Schmiede eine bessere Abscheidung der Unreinigkeiten der Erze, also ein besseres Eisen erzeuge, dass man in ihnen ohne weitere Unkosten sowohl Eisen als Stahl machen könne und dass drittens die Anlagekosten nur den vierten Teil, der Kohlenverbrauch nur die Hälfte betrage als bei der indirekten Methode mit Hochofen- und Frischbetrieb, wie er im übrigen Frankreich gebräuchlich sei. Diese verlockenden Aussichten erregten Aufmerksamkeit, umso mehr, als du Coudray korrespondierendes Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Paris war und dieser seine Schrift zugeschickt hatte. Duhamel war damals Generalinspektor der königlichen Bergwerke. Er interessierte sich für die Sache, besuchte die Grafschaft Foix und brachte 1785 in der Akademie eine Abhandlung über die Konstruktion der dortigen Eisenschmelzherde zur Vorlesung, welche großen Beifall fand und deren Druck in der Sammlung der akademischen Schriften beschlossen wurde. Gleichzeitig hatte ein anderer hervorragender Metallurge Frankreichs, Baron de Diedrich, sich für die Eisenwerke der Pyrenäen interessiert und dieselben 1785 ebenfalls besucht. Er erhielt von dem Grafen von Artois, dem Bruder König Ludwigs XVI., den Auftrag, die Schmelzung anderer Erze und zwar zunächst der von Berri und der von Alevard in der Dauphiné in pyrenäischen Schmelzherden vorzunehmen. Der Graf von Artois ließ auf seine Kosten 200 Ztr. Erze von Berri nach der Grafschaft Foix fahren und der Generalkontrolleur schickte gleichzeitig 30 Ztr. spätige Erze der Dauphiné dorthin. Auch Baron de Diedrich war bei seinem ersten Besuch entzückt von der Einfachheit des Verfahrens und setzte wie Duhamel große Hoffnungen auf eine allgemeinere Verwendung desselben. Wenn er auch die von du Coudray angenommene Kohlenersparung von der Hälfte des seitherigen Verbrauchs für etwas zu hoch hielt, so glaubte er doch, durch die allgemeine Einführung dieses Prozesses auf die Ersparung des dritten Teils des Verbrauchs in Frankreich sicher rechnen zu dürfen. Er berechnete den Kohlenverbrauch in Katalonschmieden zu 3¼ Pfund Kohle auf 1 Pfd. Eisen, dagegen bei der indirekten Methode auf 5 bis 6½ Pfd. Die Ergebnisse der angestellten Versuche entsprachen aber den Erwartungen nicht. Die Erze von Berri gaben bei 15 Versuchen neben großem Abbrand ein ganz unbrauchbares Eisen. Die Versuche mit den Erzen von der Dauphiné fielen besser aus und gab v. Diedrich sein Urteil dahin ab, dass dieselben geeignet seien, um nach dem Verfahren von Foix verschmolzen zu werden, „wenn man sie richtig behandle“ — also auch nicht ohne Reserve. Den Veröffentlichungen von Baron v. Diedrich und Duhamel folgte dann 1787 die ausführliche Abhandlung des Marquis de la Peyrouse, Traité sur les mines et les forges du Comté de Foix, welche ebenfalls die Vorzüge dieses Schmelzverfahrens anpreist. Den Misserfolg des Baron v. Diedrich mit den Erzen von Berri sucht er dadurch zu beseitigen, dass er annimmt, man habe besonders schlechte und schwefelhaltige Erze geschickt, während gewiss eher das Gegenteil der Fall war, da der Graf von Artois persönliches Interesse an dem günstigen Ausfall der Versuche hatte. Für die Dauphiné will er das Verfahren sofort eingeführt wissen. So groß das Interesse war, welches diese rasch aufeinander folgenden gut geschriebenen Veröffentlichungen in den fachmännischen Kreisen hervorriefen, welches sich unter anderem auch darin äußert, dass das Buch von Tronson du Coudray 1786 von Chr. L. A. Wille und das des Marquis de la Peyrouse 1789 von Gust. Karsten in das Deutsche übersetzt wurden, so war der praktische Erfolg doch nur gering. Den Theoretikern und dem gebildeten Publikum leuchteten die Vorschläge der genannten Schriftsteller wohl ein, vielleicht um so mehr, weil sie in die Zeit Rousseaus und der Schwärmerei für die Rückkehr zum alten und einfachen fielen, aber die Männer der Praxis wollten nichts davon wissen. Auch die schwedischen Metallurgen Rinman und Garney, die ebenfalls von dem Blendwerk des natürlichen Schmelzverfahrens etwas angesteckt waren, beschränkten sich auf einige billige Versuche.
Garney machte mit Raseneisensteinen, die im Hochofen ein Roheisen gaben, das sich nur zu einem kaum brauchbaren Schmiedeeisen verfrischen ließ, Versuche im Luppenfeuer und erhielt ein gutes weiches Eisen. Ebenso gelang es ihm, aus braunsteinhaltigen Bergerzen einen brauchbaren Rohstahl zu erhalten. Rinman zog hieraus den Schluss, dass es besser wäre, manche Erze direkt auf Schmiedeeisen, statt auf Roheisen, zu verschmelzen.
„Das Ausbringen aus den Erzen und der Zeitaufwand schienen freilich sehr unvorteilhaft und mit vielen Kosten verknüpft zu sein, allein der Schmelzprozess würde sich ohne Zweifel durch eine größere Vorrichtung und durch ein stärkeres Gebläse ungemein verbessern lassen.“
Man übersah bei den günstigen Urteilen über den Luppenfeuerbetrieb in den Pyrenäen den großen Schmelzverlust, die historische Entwicklung und die Abgelegenheit und Unzugänglichkeit der Hochgebirgstäler, in denen dieser Betrieb in Ausübung stand, welche eine Konkurrenz kaum ermöglichten und den Jahrtausende alten Betrieb lebensfähig erhielten.
Die ganze Bewegung hatte den Vorteil, dass dieser in den übrigen Industrieländern ausgestorbene oder im Verschwinden begriffene Betrieb gründlich studiert und sorgfältig beschrieben wurde. Tronson du Coudray schilderte zunächst die Eisengewinnung aus elbanischen Erzen auf der Insel Korsika, die noch in der ursprünglichsten Weise ausgeübt wurde. Die Schmelzvorrichtungen waren noch einfacher, als wie wir sie im ersten Band nach Sageys Bericht von 1828 geschildert haben. Es ist deshalb keine Wiederholung, sondern eine Ergänzung, wenn wir einen Auszug aus seiner Schilderung folgen lassen.
Die Korsikanschmiede erfordert nur einen erhöhten Boden von 8 bis 10 Fuß Länge und 5 bis 6 Fuß Breite, von dessen einer Seite sich eine Mauer mit einer Öffnung für die Windform befindet. Vor dieser liegt eine halbkreisförmige Grube, welche 3 Fuß im Durchmesser hat und 6 bis 7 Zoll tief ist. Diese Grube wird mit angefeuchteter Kohlenstübbe ausgeschlagen, so dass unter der Formmündung noch ein Abstand von 4 bis 5 Zoll bleibt. Alsdann setzt man in einem Abstand von 5 Zoll von der Form ringsum eine 4 bis 5 Zoll dicke Wand von Holzkohlenstücken, die man sorgfältig wie eine Trockenmauer zunächst 6 bis 7 Zoll hoch aufbaut. Dann legt man um diesen Kohlenzirkel eine ebensolche Erzwand 6 Zoll dick aus nussgroßen Stücken von gebranntem Erz von Elba. Diese umgibt man von außen mit einem zweiten Kohlenkranz von 2 Zoll Dicke. Sind die ersten Lagen so aufgeführt, so setzt man auf diese erste eine zweite von derselben Höhe und Beschaffenheit. Um aber dem ganzen Haufen bessern Halt zu geben, legt man von außen ringsum einen Kranz von dicken Erzklumpen dagegen, welche gleichzeitig für den nächsten Tag gebrannt werden sollen. Auf die beiden unteren Lagen trägt man dann noch eine innere Lage Kohlen und eine äußere Lage von gesintertem Erz von der früheren Schmelzung in Brocken von Faustgröße auf. Alsdann werden in den inneren Hohlraum vor die Form glühende Kohlen eingeschüttet, darauf mit frischen Kohlen bis oben hin nachgefüllt und der Wind angelassen. Dieser wird durch ein einfaches Wassertrommelgebläse, das nur eine Einfallsröhre von etwa 25 Fuß Höhe hat, erzeugt. Sind die inneren Kohlen verzehrt, so werden sie durch neue ersetzt. Der Haufen gerät in Glut und die Erze sintern zusammen. Ist diese Röstung, welche bereits eine teilweise Reduktion ist, genügend vorgeschritten, so rollt der Schmelzer die äußeren Erzstücke weg, dann den äußeren Kohlenmantel und bricht die Erzmauer auf, indem er die losgebrochenen Stücke nach der andern Seite der Hütte zieht. Hierauf wird die Grube gereinigt. Sodann wird ein neuer Kohlenboden gelegt und rechts und links von der Form ein etwa 2 Fuß hoher Haufen von Kohlen gesetzt, wodurch die Form selbst etwa 1½ Fuß hoch mit Kohlen bedeckt wird. Nachdem das Feuer wieder entzündet und der Wind angelassen ist, werden der Form gegenüber die gerösteten Erzbrocken eingelegt. Die Schlacke schmilzt ab und wird von Zeit zu Zeit abgestochen. Das Eisen sammelt sich am Boden zu einer Luppe (massello). Nach vier bis fünf Stunden ist ¼ der Tagescharge eingeschmolzen, worauf der Schmelzer, wenn die Luppe gut ist, die Schlacke abbläst, das Feuer wegräumt, den Wind abstellt und die Luppe ausbricht. Diese wird erst mit Holzhämmern abgeklopft und dann unter dem höchstens 3 Zentner schweren Hammer zu einem parallel-epipedischen Kolben gedichtet, der in drei Hitzen zu Stäben ausgeschmiedet wird. Während der Zeit des Schmiedens macht der Schmelzer eine neue Luppe, von der im ganzen vier in 16 bis 24 Stunden gemacht und ausgeschmiedet werden, die zusammen 3 Zentner wiegen. Diese Arbeit verrichten vier, zuweilen auch nur drei Arbeiter.
Gegenüber diesem höchst einfachen Löschherd war der gemauerte und mit Eisenzacken versehene Rennherd in der Grafschaft Foix, welchen Tronson du Coudray als katalonischen Herd bezeichnet, ein viel vollkommenerer Apparat.
Coudrays Angaben sind nicht immer ganz genau und deshalb von Baron de Diedrich und Marquis de la Peyrouse korrigiert worden. Soweit diese Abweichung nur seine Maßangaben betrifft, ist es aber auch möglich, dass die Abweichung in dem von ihm gemessenen Herde lag, da ja sämtliche Schriftsteller zugeben, dass die Dimensionen der Schmelzherde beeinflusst werden durch die Stärke der Gebläse, und größere Wassertrommelgebläse auch größere Herde erforderten.
Hinsichtlich der Einrichtung einer pyrenäischen Luppenschmiede verweisen wir auf die S. 117 mitgeteilte Beschreibung Reaumurs. Auch haben wir bereits im ersten Bande eine ausführliche Schilderung des Schmelzprozesses in der Grafschaft Foix (nach François) gegeben. Es genügt also hier, einige ergänzende Mitteilungen über den damaligen Betrieb zu machen. Die Erze wurden in runden oder viereckigen Stadeln geröstet. Dieselben waren 6 bis 7 Fuß hoch und hatten 10 bis 12 Fuß Durchmesser. Der Herd oder Ofen musste an einer durchaus trockenen Stelle stehen und führte man zur Trockenlegung rings um den Herd herum eine Abzucht (aqueduct). Den Boden des Herdes stellte man aus einer einzigen Granitplatte her, die im richtigen Verhältnis zum Windstrahl gelegt werden musste. Die vier Seiten des Herdes wichen in Höhe und Weite voneinander ab. Der im Oktober 1785 neuerbaute Herd in der Hütte des M. Vergines de Bouischères, eines hervorragenden Eisenindustriellen im Tal e von Vic.-Dessos, hatte die nachfolgenden Maße:
Die Schlackenseite (coté du chio) hatte etwa 20 Zoll Breite
Die gegenüberstehende Rückseite (cave) hatte etwa 21 „ „
Der Abstand von der Form zur Windseite betrug 25 „
„ „ von der Schlackenseite zur Windseite in der
Mitte des Herdes gemessen 22½ bis 24 „
Von den vier Seiten waren die Formseite (porges) und die Schlackenseite senkrecht und hatten Eisenzacken, die beiden andernwaren nach außen geneigt. Die Windseite (ore), die auch durch eine eiserne Platte geschützt war, wich 6½ Zoll von der Senkrechten ab, die Rück- oder Aschenseite, die immer gemauert war, nur halb so viel. Die Schlackenplatte war 20 Zoll hoch, Form- und Rückseite verschieden, meist 4 und 4½ Fuß hoch. Die Höhe der Windseite betrug 2 Fuß 4 Zoll. Die Tiefe des Herdes, in der Mitte gemessen, war 27½ Zoll. Der Herd wurde mit Gestübbe ausgekleidet und erhielt dadurch eine elliptische Gestalt, deren Achsen am Boden 2 Fuß auf 1 Fuß 8 Zoll lang waren. Die Form lag früher 12 Zoll über dem Boden, in neuerer Zeit hatte man sie höher gelegt auf 14 bis 15 Zoll vom Boden und ihre Mündung auf 20 Linien im Durchmesser erweitert, wodurch man ein wesentlich höheres Ausbringen erzielte. Man gab der Form ein Obermaul und 35 Grad Stechen. Der Wind wurde mit Wassertrommelgebläsen erzeugt, die meist von Holz, zuweilen aber auch gemauert waren. Fig. 180 stellt den Luppenherd der Hütte Guille zu Vic-Dessos nach der Zeichnung von dem Marquis de la Peyrouse von 1789 dar.
Charakteristisch war die Art der Beschickung des Schmelzherdes mit Kohlen und Erz. Diese geschah nach dem Einsetzen einer Platte (la posté) zwischen Form- und Windseite, die von letzterer 5 Zoll abstand. Der Raum auf der Formseite (parédou) wurde mit Kohlen gefüllt, die dicht zusammen geschlagen wurden, der Raum auf der Windseite (ore) mit klein geschlagenem, geröstetem Erz. Durch Höhersetzen der Platte führte man die Erz- und die Kohlenwand bis oben hin, bedeckte dann das Ganze mit Kohlenklein (fraisil), das man festschlug und abböschte (en dos d’âne). Auf diese Weise wurde ⅔ oder ¾ der Erzcharge, welche 9 Zentner (quintaux) betrug, eingesetzt. Nachdem das Feuer entzündet und der Wind angelassen war, wurden die zwei Massel (massoques), in welche die Luppe (massé) der vorhergehenden Charge geteilt worden waren, in den Vorraum (parédou) zum Ausheizen eingesetzt und in Kölbchen (masselots) ausgeschmiedet. Die verbrannten Kohlen wurden durch neue ersetzt und diese immer gegen die Erzwand geschoben, damit dieselbe nicht umstürzte. Nach etwa drei Stunden war das Ausheizen und Schmieden beendet und die Erzmasse so weit zusammengeschmolzen, dass man jetzt allmählich den Rest des Erzes, aber nicht in Stücken, sondern als Pulver (greillade) aufgab. Dieses wurde auf die Kohlen über den ganzen Herd ausgestreut, an einem Punkte mehr, am anderen weniger, wo es die Kennzeichen, besonders die Farbe der Flamme dem Schmelzer angaben. In dem richtigen Aufgeben dieses Erzpulvers lag die Kunst des Schmelzers. Die Greillade wurde nicht allein ebenfalls reduziert und vermehrte die Luppe, sie bewirkte auch, dass sich das Eisen aus der einschmelzenden Masse abschied und zu Boden setzte, weshalb man es la prinzipe de la massé nannte. Ob das Erz langsamer oder schneller der Form zugeschoben wurde (donner la mine), war auch ein wichtiger Punkt für den Schmelzer. Aus dem Einsatz von 9 Ztr. Erz erhielt man eine Luppe von 4 Ztr., aus welcher 14 masselots geschmiedet wurden, die 3½ Ztr. fertiges Schmiedeeisen ergaben.
Bei einem Luppenfeuer waren meist acht, zuweilen auch nur sechs Arbeiter beschäftigt. Davon war der erste der foyer oder Ofenmeister, ihm am nächsten stand der Hammerschmied (maillet), dann folgten die beiden Schmelzer (escolas); Gehilfen waren zwei Erzpocher (pique-mines) und zwei Vorläufer (miallous). Beim Ausbrechen der Luppe (Fig. 181) mussten alle zusammen helfen. In 24 Stunden konnten 4, in der Woche 24 Chargen geschmolzen werden, die gewöhnlich 90 Ztr. Stahl ergaben. Zu einer Charge von 6 Ztr. geröstetem Erz verbrannte man einschließlich des Röstens 14 Sack Kohlen. Dies entsprach einem Kohlenverbrauch von 280 auf 100 Eisen.
Ein bemerkenswerter Umstand war es, dass mit dem weichen Eisen (fer doux) auch öfter hartes Eisen (fer fort) und Stahl (fer cedat, acier naturel) fielen.
Es war dies aber durchaus vom Zufall abhängig und weder die Praktiker noch die Theoretiker fanden dafür eine ausreichende Erklärung. Die Schmelzer hatten es nicht in der Hand,absichtlich Stahl oder weiches Eisen zu machen, wenn auch manche Eskolas darin mehr Glück hatten, als andere. Swedenborg schreibt die Stahlbildung besonderen Stahlerzen zu; Reaumur dem Umstand, dass neben dem weichen Eisen auch etwas Roheisen gebildet werde. Da dieses flüssiger sei als die Hauptmasse, fließe es nach dem Rande hin und bewirke in seiner Berührung mit dem weichen Eisen die Stahlbildung in derselben Weise, wie dies bei der alten Stahlerzeugung, welche schon Vanuccio Biringuccio beschrieben hat, der Fall war. Dadurch erklärte sich die Tatsache, dass der Stahl sich immer am Rande der Luppe fand. Du Coudray, Baron Dietrich und Marquis de la Peyrouse bestritten zwar sämtlich diese Erklärung Reaumurs, aber ihre eigenen waren keineswegs besser. Du Coudray, der angibt, dass von der Jahresproduktion sämtlicher Hütten der Grafschaft der fünfte Teil an hartem Eisen und der zwanzigste Teil an Stahl falle, verwirft die Ansicht Reaumurs, weil er von der irrigen Vorstellung ausgeht, dass das Eisen, das er in metallischem Zustande in den Erzen vorhanden glaubt, überhaupt gar nicht selbst schmelze, sondern dass nur die erdigen Teile in den Erzen davon abschmelzen würden. Er will die Stahlbildung durch eine bessere Reinigung der oberflächlichen Teile, durch die Einwirkung des Feuers und Aufnahme von brennbarem Wesen durch die unmittelbare Berührung mit den Kohlen erklären. Dietrich, der Coudray gegenüber hervorhebt, dass der Stahl sich nicht gleichmäßig auf der Oberfläche der Luppe verteilt vorfinde, sondern meist nur an der unteren Hälfte, die nach dem Schlackenabfluss zu liegt und am meisten am Schlackenabfluss selbst, will die Stahlbildung, der Meinung der Praktiker folgend, der Einwirkung des nachgesetzten Erzpulvers (greillade) zuschreiben, was nach unserer heutigen Anschauung etwa so zu erklären wäre, dass beim Einschmelzen zugleich eine Kohlung eintrete und die Greillade den Überschuss an Kohlen außer bei den stahlartigen Randpartien wegnehme. Der Marquis de la Peyrouse schreibt endlich die Stahlbildung hauptsächlich dem Mangangehalt der aufgegebenen Erze zu, der dem Arbeiter nicht bekannt war und den er ebenfalls nur unterstellt. Der Luppenstahl der Katalonschmieden war sehr ungleich und von Eisenfäden durchsetzt. Durch Gerben ließ er sich verbessern, erreichte aber nicht die Güte und Gleichmäßigkeit des deutschen Stahls.
In den südwestlichen Provinzen Frankreichs bediente man sich der biskayischen Luppenfeuer, welche größer waren als die der Grafschaft Foix. Baron de Dietrich beschreibt einen solchen Herd der Schmiede von Echeaux im Tal e von Baigorry in Nieder-Navarra. Man verschmolz Spateisenstein, der in Schachtöfen, ähnlich den Kalkbrennöfen, geröstet wurde. Diese waren oben 8½ Fuß, unten 5 Fuß weit und wurden die gerösteten Erze durch eine breite Öffnung unten ausgezogen. Die Erze wurden lagenweise mit Holz geschichtet und betrug eine Füllung 170 Ztr. Erz. Der Herd des Luppenfeuers war 29 Zoll hoch und zeigte sein Querschnitt ein in die Länge gezogenes Achteck. Form- und Windseite bildeten die langen Seiten. Die Länge von der Schlacken- zur Rückseite betrug 42 Zoll, von der Formzur Windseite 36 Zoll. Die Form war 15 Zoll lang und 9 Linien geneigt, so dass der Wind 7½ Zoll über dem Boden des Herdes und etwas von der Schlackenseite abgewendet die Windseite traf. Das Formmaul war oval, 24 auf 18 Linien. Das obere Loch der Schlackenseite lag 8 Zoll unter der Essbank. Der Herd wurde aus Gestübbe geschlagen, so dass er den Boden 13 Zoll bedeckte. Man machte in 24 Stunden fünf Luppen, durchschnittlich zu 215 Pfund, wozu jedes Mal 5 Ztr. Erz aufgegeben wurden. Bei gutem Gang erhielt man 35 Luppen oder 84 Ztr. Eisen in der Woche. Auf eine Luppe verbrannte man 6½ Last (charge) Kohlen. Eine Last wog 140 Pfund und kostete bis zu 40 Sols. 100 Pfund Eisen erforderten 27 Kubikfuß Kohlen zur Schmelzung, während man in der Grafschaft Foix nur 20 Kubikfuß brauchte. Bei einem Luppenfeuer waren fünf Arbeiter beschäftigt, von denen die vier ersten 25 Sols für den Zentner Eisen bekamen, der Meister 7, jeder der drei anderen 6 Sols. Der Erzfahrer (piquemine oder Miala) erhielt 30 Livres den Monat. Außerdem gab es zwei Erzröster, welche 6 Pfennige für den Zentner rohes Erz erhielten. Im ganzen stellten sich die Fabrikationskosten auf 30 Sols für den Zentner. Die Erze kosteten 15 bis 16 Sols pro Zentner. Das Eisen war sehr gut und fand willige Abnehmer zu 18 Livres der Zentner.
In Russland waren vordem die niedrigen Bauernöfen oder Blaseöfen, in welchen aus Sumpferzen unmittelbar geschmeidiges Eisen erblasen wurde, allgemein im Gebrauch. Vor der Teilung Polens (1772) gab es noch über 300 solcher Öfen in Russland. Am längsten erhielten sie sich in dem Nowgorodschen Bauernbergrevier. Dort waren alle Männer geborene Schmiede, welche jede freie Zeit, die der Landbau übrig ließ, in der Schmiede zubrachten. Dabei bestand eine hergebrachte Arbeitsteilung: Schmelzer, Stahlmacher, Zeugschmiede und Nagelschmiede waren getrennte Gewerbe. Ja, ein Nagelschmied, der grobe Nagelsorten schmiedete, machte keine feine und umgekehrt. Ein- oder zweimal im Monat trafen sich die Arbeiter mit ihren Produkten auf gewissen Märkten, wo sie voneinander kauften und tauschten und wobei die Zwischenhändler von der benachbarten Stadt Ustjuschna Rhelesopolski die notwendigen Bedürfnisse herbeiführten und die Eisenfabrikate, welche meistens in Nägeln bestanden, aufkauften. Diese wurden alsdann auf der Wolga nach einem großen Teil des russischen Reiches verfahren.
Norberg gibt von einem solchen russischen Blaseofen, den er gesehen hatte, folgende Beschreibung. Er war von der Form 9 Fuß hoch, vor der Form 21 bis 22 Zoll im Gevierte weit; der Boden wurde von Kohlenstübbe mit einer Vertiefung von 6 bis 7 Zoll und Neigung nach der Form geschlagen. Die Gichtöffnung war rund, kaum 12 Zoll im Durchmesser. Die Brust, welche beim Herausziehen des Schmelzklumpens weggenommen wurde, setzte man jedes Mal aufs Neue aus einigen losen Steinen und dazwischen gelegten Kohlen und angeschaufeltem Gestübbe zusammen. Der Ofen wurde mit Kohlen gefüllt und dann ein Maß von Sumpferz oder Schmiedesinter oder gepochter Frischschlacke aufgegeben; zwei einfache, 4 Fuß lange lederne Bälge wurden mit einem eigenen Handgriff durch den hinter den Bälgen sitzenden Arbeiter, welcher auch zugleich das ganze Schmelzen allein dirigierte, bewegt. Es wurde niedergeschmolzen und wieder aufgegeben, bis das Schmelzstück die verlangte Größe hatte, die jedoch nicht über 1 Pud betrug. Dann wurden die Bälge und die Brustwand weggenommen, der Schmelzklumpen herausgezogen, auf einem Stein mit einem hölzernen Schlägel geschlagen und mit der Axt zerhauen. In 24 Stunden konnten sechs Schmelzen gemacht werden.
Die Bauern- oder Blaseöfen in den schwedischen Dalorten waren fast verschwunden und damals nur noch an wenigen Plätzen in den Kirchspielen zu Lima, Särna, Orsa und anderen in Westerdalen, die von den neueren Hüttenwerken sehr entfernt lagen, im Gange. Es wurden darin ockerige Erze, welche dort in Sümpfen, Wiesen und Brüchen nur 1 Fuß tief unter dem Rasen gefunden und unter dem Namen Yrke oder Örke aus morastigen Stellen gegraben wurden, verschmolzen.
In England wurden die Versuche, schmiedbares Eisen in Flammöfen mit Steinkohlen zu schmelzen, fortgesetzt. Wir ergänzen Swedenborgs Mitteilung hierüber (S. 130) durch folgende Angaben.
Francis Wood erhielt 1727 ein Patent, „Roheisen aus Eisenerzen in einem Flammofen abzuscheiden mit Hilfe von Steinkohlen“. Dasselbe Patent wurde 1728 erneuert mit dem Zusatz, dass das neue Verfahren eine Verbesserung des im Jahre zuvor patentierten und dass das gewonnene Eisen besser als gewöhnliches Roheisen sei, weshalb er es Raueisen oder präpariertes Eisen (raw-iron or iron metal prepared) nennen will. Nähere Angaben fehlen.
1736 nahm Kingmill Eyre ein Patent, Raueisen oder präpariertes Eisen (wie oben) aus Eisenerz in einem Flammofen mit Steinkohlen und Flussmitteln zu machen. „Nachdem das Eisenerz geröstet und die Steinkohle verkokt ist, werden sie pulverisiert und gemengt und so mit Zusatz von Kalk und Asche von Farn als Flussmittel in einen Flammofen eingesetzt. Durch die Flussmittel wird die Schlacke dünnflüssig und dadurch die Abscheidung des Eisens erleichtert. Hierzu wird dann, je nach der Beschaffenheit der eingeschmolzenen Erze, je nachdem sie rot- oder kaltbrüchig oder entsprechend sind, eine gewisse geringe Menge von altem verrostetem Eisen, sogenanntem Schrott (scraps) oder Abfalleisen (bushel iron or nut iron) oder Hammerschlacke (hammer slough), zugesetzt, wodurch mehr Metall aus den Erzen extrahiert wird wie sonst und ein besseres, weicheres Eisen als gewöhnlich erzeugt wird.“ — Postlewayths Patent von 1748 erinnert an das Patent von John Payne (S. 250) und lautet: Eisen zu gießen aus Eisenerz, reiner, zäher und ähnlicher dem Schmiedeeisen wie sonst, durch eine besondere Anwendung des Feuers und Zusatz von Salzen und anderen Beimischungen.
Von größerem Interesse ist das Patent von John Cockshutt vom 2. Mai 1771, und zwar schon deshalb, weil dasselbe aus einer Zeit stammt, wo das Ausschmelzen der Erze mit Koks schon sehr allgemein geworden war. Das Patent wurde erteilt für die Darstellung von Schmiedeeisen direkt aus den Erzen mit Hilfe von Steinkohlen in einem Frischfeuer (finery or bloomery); für das Frischen von Gusseisen in Schmiedeeisen, und für ein Frischfeuer, um Eisen zu machen und zu raffinieren.
1. Ein pulverisiertes Gemenge von Eisenerz (wenn nötig geröstet) und von roher oder verkokter Kohle, oder beiden, wird nach und nach in einen vorgeheizten Frischherd eingetragen. Wenn die Kohle brennt und das Erz schmilzt, wird die überflüssige Schlacke abgelassen und mit dem Nachsetzen fortgefahren, bis der Herd voll Eisen ist, welches ganz schmiedbar und in der Form einer Luppe sein sollte. Diese wird gehämmert und in zwei Halbmasseln geteilt, welche in Stäbe u. s. w. ausgereckt werden. Besser noch geschehe die Operation in dem von ihm erfundenen Frischfeuer (Feineisenfeuer s. S. 612), wobei man eine größere Luppe bekommt, welche von einer für diesen Zweck konstruierten Maschine in Stücke geschnitten wird, welche gezängt und ausgereckt werden.
Um Zeit und Holzkohlen zu sparen, kann das Gusseisen bis nahe seinem Schmelzpunkt mit Steinkohlen oder sonstigem billigen Brennmaterial in einem Flammofen oder mit Bälgen erhitzt werden, um dann in dem Frischherd des Erfinders mit Holzkohle bis zum Garwerden geschmolzen zu werden. Man setzt so lange Metall und Kohle nach, bis eine große Luppe gebildet wird. Diese Luppe wird dann mit der erwähnten Maschine zerschnitten, die Stücke gezängt und Stabeisen erhalten. Der Frischherd Cockshutts, der sich hauptsächlich dadurch auszeichnete, dass er mehrere Formen hatte, wird später noch beschrieben werden.
Die Idee des direkten Verfahrens, um schmiedbares Eisen aus den Erzen zu gewinnen, tauchte dann in den 90 er Jahren des vorigen Jahrhunderts in England wieder auf.
Am 18. April 1792 nahm Samuel Lucas ein Patent, Eisenerze und Eisenoxid in Metall zu verwandeln, ohne sie erst zu schmelzen. Dies sollte in der Weise bewirkt werden, dass eine Tonne weiches Erz oder Eisenoxid in zerkleinertem Zustande in die Tiegel eines Stahlbrennofens (steel-converting furnace) oder eines entsprechenden Ofens, nach Vermischung mit 3 bis 4 Scheffel Holzkohle, Horn oder Knochenmehl oder anderer Substanzen, welche brennbaren Stoff oder Phlogiston abgeben, eingesetzt wird. Diese Töpfe werden mit feuchtem Sand oder Lehm, um die Luft abzuschließen, bedeckt. Die Hitze wird alsdann gesteigert und der Prozess geführt, wie wenn man Eisen in Stahl (durch Einsatzhärtung) umwandelt. Auf diese Weise wird das Erz in Metall umgewandelt, welches noch mit anderen Stoffen vermischt ist; ein großer Teil dieses Metalls wird unter günstigen Umständen Stahl sein. Letzterer kann zu Gussstahl geschmolzen werden (may be run into ingots of cast-steel).
Am 19. Juni 1792 nahm William Fullarton ein Patent, das darauf hinausging, Eisenerze sehr sorgfältig aufzubereiten und dann in einer Art Schachtofen auf Schmiedeeisen zu verschmelzen. Das geröstete Erz soll zu diesem Zwecke erst mittels Hämmern, Pochwerk, Mühlen oder Walzen pulverisiert und, wenn nötig, gesiebt werden. Alle fremden Stoffe werden dann durch Waschen, Zerreiben und Aufbereiten oder durch magnetische Anziehung getrennt. Diese von allen groben Beimengungen, welche seinen Fluss beeinträchtigten, befreite Masse wird nun in einen Flamm- oder Gebläseofen eingesetzt. Der Ofen dafür kann rund, quadratisch, länglich oder sonst wie gestaltet sein, ist aber oben offen. Er wirkt wie ein Tiegel, aus welchem das Eisen aber nicht als Roheisen abgelassen wird, sondern als Regulus oder Luppe am Boden verbleibt. Sogleich nach Beendigung eines Schmelzens und Herausnahme der Luppe wird der Ofen von neuem beschickt. Die Luppe wird ausgeheizt, gezängt und zu Stäben ausgewalzt. Die Beschickung von Koks oder Holzkohle mit gepulvertem Erz wird dem Gebläse ausgesetzt und die Schlacke von Zeit zu Zeit abgestochen.
Ganz originell und wie Zukunftsträume waren Barbers Patente, in welchen wir die erste Idee einer Gasmaschine mit dem Gedanken der Reduktion und Schmelzung durch Wassergas kombiniert finden.
John Barber nahm am 31. Oktober 1791 ein Patent, entzündliche Gase zu entwickeln zur Erzeugung von Kraft und zur Benutzung bei metallurgischen Operationen.
Sein Apparat bestand aus einer Retorte, in welcher Kohlen, Holz, Öl oder andere Brennstoffe durch ein äußeres Feuer vergast und die Gase durch eine Röhre in ein zweites Metallgefäß „the exploder“ geleitet wurden. Hier wurden sie mit atmosphärischer Luft, welche eingepumpt wurde, gemischt, wodurch ein entzündliches Gasgemenge (Knallgas) entsteht, welches in Röhren geleitet werden kann und, bei seinem Austritt entzündet, mit lebhafter Flamme verbrennt.
Der Druck in dem Exploder wird reguliert und verstärkt durch Wasser, welches durch eine Pumpe eingepumpt wird. Die Erfindung ist nach der Behauptung Barbers zu den verschiedensten Zwecken verwendbar. Eine Maschine wird von dem Dampf, der aus der Öffnung des Exploders strömt, getrieben (Gasmaschine?) und kann zum Mahlen, Walzen, Schmieden, Spinnen und jeder mechanischen Arbeit verwendet werden. Gleichfalls kann der Gasstrom (fluid stream) in Öfen geleitet werden, um Erze zu schmelzen (Gasschmelzerei) u. s. w.
Derselbe John Barber nahm am 22. Dezbr. 1792 ein anderes Patent für eine Methode, Steinkohle, Eisenerze und andere metallurgische Erze und deren Kalke durch Dampf, Luft und Feuer zu reinigen, indem er dadurch den Grundstoff mit brennlichem Wesen verbindet und so zähes Metall erzeugt. — „Man nehme eine gewisse Menge Eisenerz und Steinkohle, bringe sie in einen Ofen oder einen entsprechenden Apparat, bringe Feuer hinzu und leite Dampf mit atmosphärischer Luft darüber, wodurch das Erz gereinigt wird. Dieses gereinigte Erz wird dann mit gereinigter Steinkohle in einem Schmelzofen unter Zuleitung von brennbarem Gas geschmolzen.“
Frischfeuer 1775 bis 1800.
Von der Eisenbereitung aus Erzen wenden wir uns zur Eisenbereitung aus Roheisen, und zwar zunächst zu der in Herdöfen, dem Eisenfrischen. Wir tragen hierbei zuerst das nach, was Rinman 1782 von den primitiven Frischmethoden in Schweden mitteilt, die wir als schwedische Osemundschmieden S. 187 bereits beschrieben haben. Danach wurden die in der Osemundschmiede gewonnenen kleinen Luppen in rohem Zustande, „ohne eine andere Zubereitung, als dass die Schlacken davon geschieden waren, an einige Platthämmer und Schwanzschmiede im Reich verkauft“. Bei dem „ungewählten“ Osemund ließ man die kleinen Luppen geradeso, wie sie aus dem Feuer kamen, bei dem „gewählten“ wurden die größeren Frischen mit Äxten in fünf Teile zerhauen, die noch mit den Enden zusammenhingen. So wurde er in Fässer gepackt und verkauft. Um daraus ein besseres, dichteres Eisen zu bekommen, wurde der Osemund in Hammerschmiedessen nochmals eingeschmolzen, gereinigt und dann verarbeitet. Unter dem Osemund waren oft stahlartige Frischen, die als harter Osemund verkauft und zum Verstählen von Werkzeugen verwendet wurden. Guter Osemund sollte beim Umschmelzen nicht über 20 Prozent Verlust erleiden. Rinman spricht in seiner „Eisen- und Stahlveredlung“ den Wunsch aus, dass dieses Verfahren, welches ein besseres Eisen gäbe als die anderen Frischschmieden, eher zu- als abnähme.
Von den übrigen Frischmethoden, welche Rinman in seiner Geschichte des Eisens (1782) noch aufgeführt hat, ist für uns nur die englische Stabeisenschmiede bemerkenswert, weil wir noch wenig über die in England üblichen Frischmethoden berichten konnten. Was Rinman darüber mitzuteilen weiß, ist auch nicht viel und hat seinen Wert fast mehr in dem, was er nicht sagt. Mit keiner Silbe erwähnt nämlich Rinman den später bei der englischen Frischarbeit gebräuchlichen Feinprozess (refining-process), das vorbereitende Schmelzen des Roheisens mit Koks in einem großen Herdofen, durch welches das graue Roheisen gefeint oder geweißt wurde. Wir können daraus mit Sicherheit schließen, dass diese für das spätere englische Frischen so charakteristische Vorarbeit damals noch nicht in Übung war. Diese wurde auch erst ein Bedürfnis, als die Holzkohlenöfen eingingen und man anfing, Koksroheisen zu verfrischen. Rinman, der das, was er über das englische Frischverfahren mitteilt, den Reisebemerkungen eines Herrn Quist entnommen hat, schreibt: Eins der bedeutendsten Eisenwerke ist das bei Pontypool (Süd-Wales), woselbst man das Verfrischen, wie auch an anderen Orten in England, in Wallonherden vornimmt, nur mit dem Unterschiede, dass in England nicht soviel in derselben Zeit eingeschmolzen und bearbeitet wird, als wie in Schweden, weshalb man auf jenem Werke auch drei Schmelzherde gegen einen Reckherd haben soll. Auch wird die Luppe dort erst zu Kolben ausgeschmiedet, ehe man sie an den Reckherd zum Ausrecken abliefert. Das größte Quantum, welches man mit diesen drei Schmelzherden und einem Reckherde wöchentlich produzieren kann, beträgt 3 Tonnen. Man verschmilzt namentlich schwach halbiertes und grau gesprenkeltes Roheisen. Beim Recken müssen die Reckschmiede aber auf den Grad des Glühens oder auf die Farbe des Eisens sehr genau Achtung geben, denn wenn das Eisen zu dunkelrot glüht, so lässt es sich nicht recken, und wenn es zu weißwarm ist, so fällt es unter dem Hammer auseinander.
Das beste Eisen soll in Lancastershire aus Blutsteinerzen (Hämatit) und aus Erzen von Forrest of Dean erzeugt werden. Auch das Eisen aus einigen Flözerzen bei Pontypool und den umliegenden Werken soll ziemlich gut sein; an allen diesen Orten wird aber das Roheisen sowohl als auch das Stabeisen bei Holzkohlen, welche dort von vorzüglicher Güte sind, produziert. Wo man wenig Holzkohlen hat, verwendet man in den Reckherden Steinkohlen. In den Frischherden lässt sich die Steinkohle nicht anwenden.
Percy teilt in seiner Eisenhüttenkunde aufgrund von Angaben eines Herrn Rogers mit, dass das Frischverfahren im Jahre 1807 eine wesentliche Verbesserung erfahren habe, dass aber vor dieser Zeit, bis zum Jahre 1720 zurück, das Verfahren noch ein sehr einfaches gewesen sei. Man habe mit 1½ Ztr. Roheisen Einsatz Luppen in einem Frischherd mit Holzkohlen erzeugt, diese seien unter einem schweren Hammer gezängt und dann unter leichten, rasch gehenden Schwanzhämmern ausgeschmiedet worden. Das Heizfeuer oder der Reckherd hieß chaferie, von dem französischen chaufferie. — Dies sind die knappen Nachrichten über das Herdfrischen in England im vorigen Jahrhundert.
In Frankreich entwickelte sich in Nivernais, wo man Qualitätseisen machte, eine verbesserte Bergamaskschmiede, die sich von dem alten Verfahren dadurch unterschied, dass das Hartzerennen und Frischen in zwei getrennten Herden vorgenommen wurde.
Baron Dietrich hat dieses Verfahren, welches von einem Beamten aus Nivernais auch in dem Dep. des Landes, etwa in den 70 er Jahren des vorigen Jahrhunderts, eingeführt worden war, in der Weise, wie er es dort auf der Hütte von Uza bei dem Dorfe Lys kennen lernte, näher beschrieben:
Von den zwei Hochöfen von Uza war immer nur einer, meistens 6 Monate lang, im Betrieb. Es wurde in 24 Stunden zweimal abgestochen, jeder Abstich gab etwa 1000 kg. Eine Tonne Eisen erforderte drei Wagen Kohlen. Nur der Mangel an Holzkohle verhinderte einen stärkeren Betrieb.
Der Frischprozess (la mazerage), wie er von Nivernais eingeführt war, bestand aus drei Operationen, 1. dem Hartzerennen, 2. dem Rösten der Kuchen (Blattelbraten), und 3. dem Frischen (Raffinieren). Es geschah dies manchmal in einem, meist in zwei Herden. Der Hartzerennherd (mazerie) war 16 bis 18 Zoll im Quadrat und 16 bis 18 Zoll tief. Der Boden war nach der Schlackenseite zu geneigt, den Formen gab man mehr oder weniger Neigung, je nachdem das Eisen weicher oder härter war. Die Gans wurde von der Windseite aus eingeschoben und gleich Frischschlacke und Hammerschlag mit aufgegeben und der Wind angelassen. Bei der ersten Operation wurde keine Schlacke abgestochen.
Das Einschmelzen durfte nicht zu sehr beschleunigt werden und dauerte deshalb in der Regel drei bis vier Stunden. Dann stach man die ganze geschmolzene Masse gefeintes Eisen und Schlacken zusammen in ein flaches Sandbett ab, so dass der Eisenkuchen nur etwa 1 Zoll dick wurde. Ein solcher Abstich (pissée) lieferte 500 bis 600 Pfund Hartzerenneisen. Man konnte sieben Abstiche in 24 Stunden machen. Ehe das Eisen erstarrte, durchfurchte es der Arbeiter mit einem Spieß, so dass es in Stücke von 6 Zoll auf 15 Zoll zerteilt wurde, wodurch es sich hernach leicht in einzelne Platten (lopins) zerteilen ließ.
Nun folgte die zweite Operation, das Rösten oder Braten (recuit), dem man in Uza in der Regel alles Eisen unterwarf, außer wenn die Platten ganz weiß waren oder wenn man Stahl machen wollte. Das Braten geschah im offenen Herd zwischen zwei Lagen Kohlen. Auf 1000 Pfund Eisen verbrannte man 420 Pfund Kohlen.
Das Raffinieren oder Frischen erfolgte dann in einem besonderen größeren Herd, der 24 Zoll tief, 18 Zoll Quadrat im Boden, 24 Zoll vom Schlackenloch bis zum Hinterzacken und von dem Form- zum Windzacken (contrevent oder marâtre) in der Feuerhöhe hatte. Die aus Kupfer geschmiedete Form lag 14 Zoll über dem Boden und 5½ bis 5¾ Zoll vor; ihre Mündung war 12 bis 13 Linien im Durchmesser; sie war so geneigt, dass der Wind den Windzacken 6 bis 8 Zoll unter der Kante traf. Man setzte nur 60 Pfund gebratener Platten ein und erhielt daraus eine Luppe (masset) von 40 Pfund, welche in demselben Herd ausgeschmiedet wurde. War das Eisen zu weich, so wurde die Form gehoben. Wollte man Stahl machen, was in denselben Herden geschah, so blies man fast horizontal und setzte keine Luppenbrocken und nur wenig Schlacken zu. — In Uza kostete dieses Frischverfahren ⅙ mehr an Kohlen und gab 1/15 weniger Abbrand als früher. Es hatte den Vorteil, dass man das hierbei erhaltene Eisen sofort zu kleinen Waren verschmieden und dass man Roheisen verarbeiten konnte, das sich sonst nur schwer frischen ließ. Das Eisen von Uza wurde in Bordeaux mit 18 bis 20 Lire der Zentner verkauft und konkurrierte mit dem spanischen.
Die zahlreichen Versuche, welche man in England gemacht hatte, Eisen mit Steinkohlen zu verfrischen, hatten bis 1780 nur wenig Erfolg gehabt. Rinman beschreibt ein eigentümliches Verfahren, wie folgt:
Die Engländer versuchten auf jedem Wege das Ziel, Stabeisen mit Steinkohle zu frischen, zu erreichen. Nachdem sie sich überzeugt hatten, dass bei direkter Berührung des Eisens mit Steinkohle oder Koks niemals ein gutes Eisen zu erzielen sei, probierten sie es auf andere Weise. Das Frischen in Tiegeln vorzunehmen, wurde von vielen versucht, und gelangte man endlich auch zu befriedigenden Ergebnissen. Herr Quist, dessen Bericht Rinman benutzte, meldet hierüber folgendes.
Das Hauptverdienst hiervon komme einem Mr. Bacon zu, welcher das erste Werk zum Tiegelfrischen zu Lowermill, vier engl. Meilen von Whitehaven, nicht weit von Egremont, angelegt habe. Er hätte dieses Werk mit allen seinen Privilegien Herrn Wood überlassen, der die Anlage erweitert und auch auf dem Eisenwerk zu Merthyr-Tydwill sechs solcher Öfen gebaut habe.
Dass ein Mr. Bacon ein solches Patent erworben habe, darüber konnte ich nichts auffinden, wohl aber nahm John Wood am 5. Februar 1761 ein Patent auf einen Prozess, dessen Beschreibung annähernd mit dem von Quist beschriebenen übereinstimmt.
Das Verfrischen oder die Umwandlung in geschmeidiges Eisen geschah danach statt in offenen Herden in geschlossenen Gefäßen oder Tiegeln, um die schädliche Einwirkung der Steinkohlen auf das Eisen zu verhindern. Die Tiegel wurden aus feuerfestem Ton in verschiedener Größe angefertigt. Die größten waren 2 Fuß hoch, 1 Fuß weit und 4 Zoll stark, die kleinsten 9 bis 11 Zoll hoch, 5 Zoll weit und 3 Zoll stark. Die Frischöfen — „flourishing furnaces“ —, d. h. Flammöfen, in welche die Tiegel eingesetzt wurden, waren den Gießereiflammöfen ähnlich. Außer diesen hatte man noch kleinere, „ball furnaces“ genannt, die nur dazu dienten, die Eisenkörner, die beim ersten Schmelzen nicht frischen wollten, noch einmal umzuschmelzen.
Das Roheisen musste erst granuliert werden und geschah dies gleich bei dem Hochofen zu Merthyr (Marthar) in Glammorganshire. Man nahm halbiertes Roheisen, welches mit Koks erzeugt war. Beim Granulieren wurde das flüssige Roheisen in eine gusseiserne Rinne geleitet, an deren unterem Ende sich ein Loch von ½ Zoll im Durchmesser befand, durch welches das Eisen, wie durch ein Sieb, 8 Fuß tief auf eine hölzerne Walze von 18 Zoll im Durchmesser fiel, welche 3 Zoll hoch mit Wasser bedeckt war und durch eine Kurbel mit der Hand umgedreht wurde. Jeder einzelne herabfallende Eisentropfen prallte gegen die Walze an und wurde dadurch in viele kleine Körner zerteilt, die durch das Härten im Wasser so spröde wurden, dass man sie nötigenfalls unter einem Stampfer oder in einem Pochwerk noch mehr zerteilen konnte. Die Granalien sammelten sich in einer hölzernen Kiste unter dem Wasser, welche von Zeit zu Zeit leer gemacht wurde. — Wenn der Schmelzprozess angehen sollte, wurden zu einer Tonne Roheisengranalien 1½ Ztr. (84 kg) feingesiebte und gewaschene Garschlacke aus dem Reckherd abgewogen und dieser Schlacke setzte man dann gewöhnlich fünf kleine Schüsseln voll fein gepulverten Kalk zu. Das Granuliereisen, welches unterdessen in einer Lauge von Kaliasche (Pottasche) gelegen hat und darin gewissermaßen gebeizt worden ist, wird dann aus dieser Lauge genommen und mit dem Gemenge von Schlacke und Kalk auf dem Beschickungsboden gehörig durchgearbeitet. Mit dieser Beschickung werden alsdann etwa 26 von den gerösteten Tiegeln, von denen ein jeder 93 Pfund enthält, angefüllt, mit einem Deckel wohl verschlossen, verklebt und mit großen Zangen in den Flammofen — flourishing furnace — eingesetzt. Wenn der Ofen einen guten Zug hat und ganz neu ist, kann das Eisen bei einer sehr starken Hitze in höchstens 3½ bis 4 Stunden zu einem Klumpen zusammengeschmolzen sein, welches man bei einiger Übung an der Farbe der Tiegel in dem Ofen erkennt. Glaubt der Schmelzer, dass der rechte Zeitpunkt gekommen ist, so wird der Tiegel herausgenommen, geöffnet, zerschlagen und ausgeleert und man findet das Schmelzstück dann, wenn alles gut gegangen ist, als einen Klumpen, der einer gewöhnlichen Luppe gleicht, mit einer dünnflüssigen, schwarzen, obsidianähnlichen Schlacke umgeben. Das Schmelz- oder Frischstück pflegte gewöhnlich 80 Pfund zu wiegen; es wurde sogleich zusammengeschlagen und an den Reckhammer geliefert. Missglückte, roh gebliebene Güsse kamen in den Ball-furnace. Das Eisen war von geringer Güte, kurzsehnig und brüchig.
An dieses Tiegelfrischen schließt sich ein anderer, ebenfalls im vorigen Jahrhundert in England angewendeter Prozess, das sogenannte Brockenschmelzen in Tiegeln. Es ist dies das Zusammenschmelzen oder richtiger Zusammenschweißen von altem Schmiedeeisen (Schrott) in Tiegeln. Auch dieser Prozess war nur denkbar bei den außerordentlich hohen Holzkohlenpreisen auf der einen und den billigen Steinkohlenpreisen auf der anderen Seite.
Die Öfen, in denen dieser Prozess vorgenommen wurde, hießen Scrap-furnaces, Schrottöfen; man hatte dergleichen zu Duffield bei Derby, zu Sheffield und anderen Plätzen. Die Eisenbrocken wurden von armen Leuten gesammelt und bestanden aus allen möglichen Abfällen. Mit diesen wurden etwa sechs Tiegel von 2 Fuß Höhe und 10 Zoll Weite ohne Zusatz angefüllt und die Masse möglichst zusammengedrückt. Die offenen Tiegel wurden in den Schrottöfen einem starken Steinkohlenfeuer ausgesetzt, so dass der Inhalt zusammenschweißte. Die Tiegel wurden alsdann aus dem Ofen genommen, umgestürzt und die ausgestürzte, zusammengeschweißte Masse zusammengeschlagen, unter einem Wasserhammer geschmiedet und nach oft wiederholtem Glühen zu Stäben, wie sie für Kleinschmiede passen, ausgereckt. Karsten gibt an, dass die Tiegel mit Inhalt nach dem Schweißen unter den Hammer gebracht wurden. Rinman sagt: „man soll“ manchmal die Erhitzung bis zum Schmelzen der Masse, die dann unter einer Decke von Glaspulver oder Hochofenschlacke flüssig würde, fortsetzen und erhielte so das reinste Eisen, welches die Engländer tincture of iron nannten. Hier ist wohl eine Gussstahlerzeugung aus Stahlbrocken gemeint.
Statt dieses Verfahrens hatte man nach Quists Bericht um 1780 bereits ein anderes Verfahren, Schrott im Feuer zu verarbeiten, indem man denselben in Flammöfen mit Steinkohlenfeuer zusammenschweißte. Man verarbeitete auf diese Weise namentlich alte Nägel und Abfälle der Nagelschmiede, aus denen man auf runden Stücken von Sandstein kleine Kegel aufrichtete und diese im Reverberierofen (air furnace) bei geschlossenen Türen der Hitze aussetzte. Die geschweißten Klumpen wurden mit Handhämmern zusammengeschlagen und dann unter einem kleinen Wasserhammer zu Stäbchen ausgereckt, die größtenteils zu Sheffield zum Schmieden von Messerklingen angewendet wurden.
Der Vollständigkeit wegen wollen wir hier noch einige ältere Vorschläge und Versuche, Roheisen mit Mineralkohlen zu frischen, aufführen.
1724 erhielt Roger Wodehouse ein Patent, Roh- und Gusseisen mit Hilfe roher Steinkohle schmiedbar zu machen.
1727 nahm Fallowfield ein Patent, Eisen mit Torfkohlen aus feinen Erzen zu schmelzen und in Schmiedeeisen zu verwandeln.
1728 bekam John Payne ein Patent, welches wir schon wiederholt angeführt haben, weil in demselben auch die Anwendung kannelierter Walzen zum ersten Mal patentiert wurde. Der erste Teil desselben bezieht sich auf die Herstellung von Schmiedeeisen durch gewisse Zusätze und lautet: Roheisen schmiedbar zu machen, um es unter dem Hammer zu strecken u. s. w. „Asche von Holz oder anderen Vegetabilien, alle Arten von Glas und Sand, gewöhnliches Salz und Steinsalz, Kali, Pottasche, Eisenschlacken von Schmelzöfen und Frischfeuern werden in entsprechenden Mengen mit Roheisen oder sonstigem spröden Eisen in einem Frisch- oder Schmiedeherd zusammengeschmolzen, wodurch dieselbe Umwandlung bewirkt wird, wie durch Holzkohle, so dass es schmiedbar wird und in Stäbe oder andere Formen geschmiedet werden kann.“
Dieses Patent verdient deshalb Beachtung, weil darin die Idee des Martinverfahrens zum ersten Mal entfernt angedeutet ist. Das englische Tiegelfrischen, wofür Francis Wood 1761 ein Patent erhielt und welches wir oben beschrieben haben, ist damit verwandt.
1771 erhielt James Goodyer ein Patent, Stahl aus Roheisen zu machen. Das beschriebene Verfahren entspricht dem deutschen Stahlfrischverfahren und muss man daraus schließen, dass das Stahlfrischen in England nicht bekannt war.
„Man setze Roh- oder Gusseisen in ein Frischfeuer, gerade wie wenn man Stabeisen machen wollte; aber das angewandte Gebläse muss schwächer sein. Sobald einiges von dem Eisen im Herd niedergegangen ist, muss man vom Boden aus es durcharbeiten, wie beim Eisenmachen; mit dem Einschmelzen fährt man dabei aber anfangs fort. Wenn es genug ist, um eine Luppe zu machen, lässt man das ganze auf den Boden niedergehen, bringt die Luppe sofort zu dem Hammer, um sie zu zängen und zu recken wie Eisen. Man hält den Herd so frei von Schlacke wie nur möglich. Ein Zusatz von Salz oder salzigen Substanzen, tierischen Abfällen oder Holzkohlenstaub verbessert den Stahl. Um feinen Stahl zu machen, nimmt man den so bereiteten und zementiert ihn in derselben Weise, wie gewöhnlicher Stahl aus Stabeisen gemacht wird.“
Richard Jesson nahm mehrere Patente für die Stabeisenbereitung mit Steinkohle. Das erste vom 30. Oktober 1773 erhielt Jesson zusammen mit John Wright für die Darstellung von weichem Eisen aus Roheisen (pig or sow metal) oder Gusseisen und aus Schaleneisen (scull and zinder iron) oder anderem Gusswerk mit roher Kohle oder Koks und einem Gebläse. Die erhaltenen Luppen werden heiß unter einem Stempel oder Hammer in Platten ausgeschlagen, welche, wenn sie kalt geworden sind, in kleine Stücke zerbrochen werden, um den Staub und die schweflige Masse, welche das Metall aus den Kohlen aufgenommen haben können, abzuscheiden. Hierauf werden diese Stücke noch völlig von Unreinigkeiten gereinigt, entweder mit der Hand oder in Scheuertonnen. Alsdann erhitzten die Erfinder die gereinigten Stücke in einem Flammofen, in Tiegeln oder sonst wie und schmiedeten sie dann von einem Reckherd (chafery) in der gewöhnlichen Weise wie bei der Schmiedeeisenbereitung aus. Wenn das Eisen aber rot oder kaltbrüchig ist, so wird es unter Zusatz von Schrotteisen (scrap iron or nutt iron) in Tontiegeln in einem Flammofen erhitzt und dann erst, wie zuvor erwähnt, ausgereckt.
Am 14. November 1783 erhielt Richard Jesson ein neues Patent für denselben Zweck und folgendes Verfahren: Guss- oder Schaleneisen wird in einem Frischherd erhitzt mit Gebläse, aber ohne Flüsse oder Aufgüsse (infusions). Die erhaltenen Metallklumpen werden heiß in Platten oder sonstige Formen ausgeschmiedet. Diese werden in Haufen (Garben — piles) oder sonst wie, aber ohne Tiegel oder Gefäße, in einem kleinen, für diesen Zweck erbauten Ofen erhitzt und darauf in Stücke von Schmiedeeisen in einer oder mehreren Hitzen mit oder ohne Reckherd ausgeschmiedet. — Kleine Brocken des Metalls, welche bei dem Hämmern abfallen, können in Tiegeln oder Gefäßen oder ohne diese in einem Flammofen, wenn rot oder kaltbrüchig unter Zusatz von Schrott erhitzt und dadurch in gutes Schmiedeeisen verwandelt werden. Dieses Verfahren finden wir zum Teil bei der Südwalisischen Frischschmiede in Anwendung.
Frischen am Harz und in Österreich zu Ende des Jahrhunderts.
Über das Eisenfrischen am Schluss des 17. Jahrhunderts liegen ausführlichere Nachrichten vor, aus denen wir auszugsweise das Nachfolgende mitteilen.
Das Kaltfrischen oder die Kaltbläserarbeit, welche am Rhein gebräuchlich war und deshalb auch rheinisches Frischen genannt wurde, war diejenige Abänderung der deutschen Frischarbeit, bei welcher das zu frischende Eisen, um es schneller aufbrechen zu können, abgeschreckt wurde.
Das Kaltfrischen unterschied sich von dem Warmfrischen (dem eigentlichen deutschen Frischen) dadurch, dass man das Eisen, sobald es im Frischherde eingeschmolzen war, bis zur völligen Erstarrung kalt werden ließ, zu welchem Zwecke man die Schlacke von dem auf dem Boden befindlichen flüssigen Eisen mit der Handschaufel wegscharrte und die Erstarrung des Eisens durch Aufgießen von Wasser beförderte. Wenn die Arbeit so etwa eine halbe Stunde unterbrochen worden war, wurde der erstarrte Eisenklumpen aufgebrochen, umgewendet, Kohlen darunter gebracht und noch einmal langsam eingeschmolzen. Das Eisen wurde hierbei dem Winde des Gebläses von neuem ausgesetzt, frischte dadurch gleichmäßig und schnell und pflegte nach dieser zweiten Schmelzung schmiedbar zu sein. Wurde die Hitze im Anfange bis zum Kochen des Roheisens fortgesetzt und dann erst abgekühlt, so nannte man dies Rohfrischen. Das Kaltfrischen wurde um die Mitte des 18. Jahrhunderts in Schmalkalden eingeführt und werden wir bei der Landesgeschichte darüber noch nähere Angaben machen.
Am Harz war das deutsche Frischverfahren in Gebrauch und zwar diejenige Abänderung, welche man das Klumpfrischen nannte.
Man verschmolz dabei graues oder halbiertes Roheisen. Der Herd war aus vier eisernen Zacken einschließlich der Bodenplatte zusammengesetzt. Letztere war 2 Fuß 1 bis 2 Zoll im Quadrat, 2½ Zoll dick und wurde von unten durch Wasser gekühlt.
Der Formzacken war 2 Fuß 2 Zoll lang und 1 Fuß 2 bis 3 Zoll hoch, der Gichtzacken war 2 Fuß 6 bis 12 Zoll lang und 1 Fuß 3 Zoll hoch, der Hinterzacken 2 Fuß 2 Zoll lang und 1 Fuß 4 Zoll hoch; alle waren 2 Zoll dick.
Die Vorderseite hatte keinen Zacken, sondern wurde mit Gestübbe zugemacht, dagegen befand sich hier die eiserne Schlackenrinne oder Lachtsohle, 1 Fuß 6 Zoll lang, 6 bis 8 Zoll weit und 4 bis 5 Zoll hoch. Sie war an beiden Seiten des Mauerwerks befestigt und mit einer starken Eisenplatte, dem Schlackenblech, bedeckt, das 3½ Fuß lang und 1 Fuß breit war. Sie diente beim Arbeiten mit dem Spieß (Spalt) als Unterlage. In diesen Kasten wurde der Herd von Gestübbe geschlagen. Die Tiefe des Herdes war vom Formmaul bis auf den Boden 11½ Zoll, vom Formmaul bis zum Hinterzacken 7½ Zoll, seine Länge vom Formmaul bis zum Gichtzacken 2 Fuß 4 Zoll; die Form ragte 3½ Zoll in den Herd.
Der Hinterzacken hing 1½ Zoll rückwärts, der Gichtzacken um 1 Zoll einwärts. Der Formzacken stand senkrecht und war einige Zoll niedriger als die anderen, weil auf ihm die Form ruhte. Der Frischboden war einige Grade nach der Ecke, welche Form und Hinterzacken bildeten, geneigt. Die Lachtsohle lag 4 Zoll über dem Frischboden. Die Lage des Frischbodens zur Form war besonders wichtig. Bei grauem Eisen legte man den Boden höher, um das Frischen zu beschleunigen, bei weißem (grellem) Eisen legte man ihn tiefer, um das Frischen zu verlangsamen, weil dieses Eisen leichter frischte. Die Frischer nannten das grelle, leicht frischende Roheisen garschmelzig, das graue rohschmelzig.
Die Form ließ man so viel stechen, dass der Wind entweder den Gichtzacken 1 bis 2 Zoll vom Boden berührte, oder dass er auf den Boden selbst, 2 bis 3 Zoll von der Mitte desselben, nach dem Gichtzacken zu fiel; ersteres bei halbiertem, letzteres bei grauem Roheisen. Das Formmaul war halbkreisförmig oder länglich viereckig, im ersteren Falle 1⅜ Zoll breit und 1⅛ Zoll hoch, im zweiten Falle 1½ Zoll breit und 1⅛ Zoll hoch. Die Neigung der Form wurde mit einem halben Gradbogen, der Formwaage, bestimmt. Die Balgdeuten oder Düsen hatten 1⅛ Zoll weite Mündungen und lagen 3½ Zoll in der Form zurück. Die Bälge waren 10 Fuß 8 Zoll im ganzen lang und fassten etwa 80 Kubikfuß. Die Holzkohle, der man sich am Harz bediente, war Fichtenkohle (Pinus picea. Lin.).
Der Frischprozess zerfiel in folgende Operationen: 1. das Roheinschmelzen; 2. das Garmachen; 3. das Rohaufbrechen oder erste Aufbrechen; 4. das Klumpfrischen; 5. das Garaufbrechen; 6. das Luppenschmelzen.
Das Frischen begann damit, dass man den Herd halb mit Kohlen füllte, hierauf grob zerschlagene Schurre, d. h. den Abfall von der vorigen Luppe nebst einigen Eisenstückchen von ⅛ Ztr. Gewicht auftrug. Dann setzte man die Roheisenstücke, welche 2 Ztr. wogen, zu vier bis fünf Stücken nebeneinander auf den Gichtzacken, mit ihrer Längenachse der Form zugerichtet, ein. Das größte untere Roheisenstück ragte etwas vor, etwa 6½ Zoll in den Herd hinein. Man gab den Roheisenstücken hinten eine Unterlage, damit sie sich vorn in den Herd neigten. Alsdann stürzte man den Herd mit grober Kohle voll, warf glühende Kohlen vor die Form und ließ den Wind an. Damit begann das Roheinschmelzen. Das Roheisen tropfte langsam vor der Form nieder und vereinigte sich mit der Masse am Boden, welche gleichzeitig einschmolz. Zur Schlackenbildung warf man einige Schaufeln Frischschlacken ein. Die Bälge wechselten sieben- bis achtmal bei halbiertem Roheisen, bei grauem etwas rascher. Da das Einschmelzen keine Arbeit erforderte, so benutzte man das Feuer zum Wärmen und Ausschmieden der Luppenstücke von dem vorhergehenden Frischen. Hierüber ist nichts weiter zu bemerken. Das Roheinschmelzen dauerte 1½ Stunden. Der Frischer untersuchte mit dem Spatt, ob viel Lacht in dem Herde ist, welcher dann zum ersten Male abgestochen wurde. Der Lacht war bei grauem Eisen hochrot und dünnflüssig, bei grellem Eisen weiß und steif. An dem Lacht erkannte man, ob das Schmelzen zu gar oder zu roh war, in ersterem Falle setzte man Frischschlacke, im zweiten Garschlacke oder Hammerschlag zu. Das nach beendetem Roheinschmelzen im Herde befindliche Eisen bildete keineswegs eine flüssige Masse, sondern war äußerlich erhärtet, innen aber breiartig. Man brach mit dem Spatt auf und zerteilte sie in mehrere größere und kleinere Klumpen. Bei grellem Roheisen setzte man mehrere Mal Frischschlacke zu. Je behutsamer das Einschmelzen geschah, umso besser verlief das Frischen.
Das dem Winde am nächsten gelegene Eisen wurde nur leicht aufgebrochen und in einigen Klumpen vor die Form gebracht, dies nannte man das Garmachen, welches beendet war, sobald der Klumpen vor dem Winde eine weiße Farbe bekam und sich an den Spatt anhing. Nun beginnt die dritte Operation, das Rohaufbrechen. Man bringt dabei sämtliches Eisen vom Boden über die Form und lässt es aufs Neue so einschmelzen, dass der Wind auf jedes Teilchen gehörig wirkt. Der Frischer nimmt den großen Spatt von 7 bis 8 Fuß Länge und fährt damit beim Gichtzacken auf den Boden nieder und sucht nun die fest aufsitzende Masse durch Wuchten des Spatts, indem er sich mit Gewalt auf denselben legt, loszumachen und in die Höhe vor den Wind zu bringen. Sie bricht dabei gewöhnlich in mehrere Stücke. Diese werden in die Höhe gebracht und in umgekehrter Lage, so dass die untere Seite mit der anhängenden Schurre nach oben zu liegen kommt, über dem Winde aufgesetzt. Der Frischer reinigt nun den Boden und beginnt alsdann mit dem Unterspatten. Hierbei fährt der Frischer mit dem großen Spatt vom Schlackenblech vor der Form bis auf den Boden durch und gibt ihm dann eine diagonale Richtung nach der Ecke zu, wo Gicht und Hinterzacken zusammenstoßen; dann fährt er in der Mitte des Herdes durch, dann wieder nach der anderen Ecke und so kreuzweise fort. Hierdurch überzeugt er sich, ob der Boden gehörig rein sei. Hat sich etwas angesetzt, so wird es mit Gewalt weggestoßen. Dies geschieht aber vorzüglich nur beim Rohgang, wenn graues Roheisen verfrischt wird, bei halbiertem und grellem ist es selten oder nie der Fall. Die unter der Form sich frischende Masse wird nun aufgebrochen und in die Höhe gebracht. Man fasst daher mit dem Spatt dicht auf den Boden, drückt hinten scharf nieder, bricht den größten Klumpen auf und wirft ihn vor den Gichtzacken, dann werden die übrigen kleineren ebenfalls dahin gebracht und nun alles vor den Wind geführt. Einige beim vorherigen Aufbrechen auf die Seite geworfene Schurre werden ebenfalls darauf geworfen. Nachdem nun vom Gichtzacken alles weg und vor die Form gebracht, diese selbst gereinigt und der Herd gelüftet ist, werden frische Kohlen in den Herd gestürzt und man lässt das Gebläse, welches während der ganzen Operation etwas langsamer ging, wieder geschwinder gehen. Die Zeit des Rohaufbrechens dauert etwa ¼ Stunde. Die Schurre, die hauptsächlich aus oxidiertem Eisen bestehen, werden ebenso wie der Hammerschlag als garende Mittel zugesetzt. Wenn nun das Eisen nach und nach anfängt sich zu senken und niedergeht, so kommt es in einem bereits halbgefrischten Zustande auf den Boden, wird zäh und vereinigt sich schon weit lieber zu einem Ganzen als vorhin. Es bildet auf dem Frischboden ein zusammenhängendes Ganzes, den sogenannten Klump, weshalb diese Arbeit das Klumpfrischen genannt wird. Der Frischer scharrt die einzelnen Stücke vom Gichtzacken nach der Form, indem er darauf achtet, dass das Einschmelzen nach und nach geschieht, und dass der Wind die Masse beständig gehörig durchstreiche und alle Teile derselben hinlänglich berühre. Mit dem Spatt muss daher immer so gearbeitet werden, dass der Wind den Gichtzacken erreichen und folglich den ganzen Herd durchstreichen kann. Um den Eisenverbrand zu vermindern, hält man die Masse vor der Form etwas dicht und schlägt sie etwas zusammen. Nach 10 Minuten werden die Kohlen im Feuer mit den Haken zur Seite gebracht, die niedergehende Masse mit dem Spatt gelüftet, die Form rein gehalten und an der Gicht etwas aufgebrochen, alles dem Winde zugeführt, damit nichts rohes eingehe, am Hinterzacken Wasser gegossen und nun das Ganze etwas in Ruhe gelassen. Nach halbstündiger Arbeit hat sich der Klumpen auf dem Herdboden gebildet.
Es folgt nun das Garaufbrechen oder Luppenaufbrechen, welches etwa 10 Minuten erfordert. Der Frischer fährt zu dem Ende mit dem großen Spatt beim Formzacken nieder und hebt hier den Klump etwas in die Höhe, alsdann fasst er beim Gichtzacken unter den Klump und hebt ihn nach und nach immer mehr, bis er fast eine senkrechte Stellung bekommen hat. Nun macht er die Form rein, stürzt Kohlen in den freien Raum und wuchtet alsdann den Klump so herum, dass die Seite desselben, welche vorhin an der Gicht lag, nun vor die Form und also die untere oder Bodenseite oben zu liegen kommt. Der ganze Klump liegt daher jetzt über der Form. Nachdem er abermals mit Kohlen bedeckt ist, bleibt er nun eine kurze Zeit sich selbst überlassen.
Hierauf folgt das Luppenschmelzen, die letzte Operation, welche als der dritte Verfrischungsgrad zu betrachten ist. Das zu frischende Eisen wird dabei zum drittenmale vor der Form niedergeschmolzen. Den aufgebrochenen Klump darf der Frischer aber nur sehr behutsam und vorsichtig eingehen lassen, damit keine ungefrischte Stelle darin bleibt. Der über der Form befindliche Klump wird deshalb so lange als möglich schwebend erhalten, damit der Wind nur auf den unteren Teil desselben wirken und diesen nach und nach wegschmelzen kann. Das Feuer hält der Frischer dabei immer dicht und gießt dann und wann etwas Wasser darüber. — Ist der Klump so weit niedergegangen, dass die sich auf dem Boden bildende Luppe beinahe fertig ist, so entblößt man ihren oberen Teil und drückt etwaige lose Brocken daran fest. Da jetzt der Wind unmittelbar auf das Eisen bläst, so verbrennt ein geringer Teil desselben und sprüht mit strahlenden Funken in der Esse umher; um nicht zu viel zu verbrennen, lässt man das Gebläse etwas langsamer gehen. Wegen der zunehmenden Schwerflüssigkeit des Eisens dauert dieses Luppenschmelzen etwa ½ Stunde. — Ist alles zusammengeschmolzen, so wird nochmals Wasser darüber gegossen und endlich die nun fertige Luppe, indem sie der Frischer mit dem Spatt vor der Gicht aufhebt und zwei andere Arbeiter mit dem Luppenhaken zu Hilfe kommen, aus dem Herde heraus auf die Hüttensohle gewälzt und nach dem Hammer gebracht. Sie hat jetzt eine eiförmige, etwas gedrückte Gestalt.
Dieses Verfahren gilt für graues Roheisen; garschmelziges, leicht frischendes Eisen wird immer unter dem Winde gehalten.
Zwei Arbeiter schaffen mittels des Luppenhakens die Luppe zum Hammer. Sie wird nun mit der Luppenzange unter den Hammer geschoben und zwar so, dass sie auf der hohen Kante liegt. Bei den ersten Hammerschlägen fließt die noch bei der Luppe befindliche Schlacke ab. Ist jene oben und unten etwas gedichtet, so wird sie gedreht und mit der flachen Seite auf den Amboss gelegt. Nachdem sie durch Hin- und Herschieben geebnet und zu gleicher Stärke ausgebreitet ist, wird sie zerhauen oder mittels des Setzeisens in vier bis fünf Stücke zersetzt; das erstere ist das Gichtstück, dann folgen die Mittelstücke, zuletzt das Formstück. Jedes Stück wird mit einer Zange gefasst und zum Auswärmen in den Herd geschoben. Sie werden dann gezängt oder gezaggelt und zu Stäben ausgeschmiedet.
Zu einer Frischhütte gehörte ein Meister, drei Knechte und ein Lehrbursche. Der Meister hielt den Feuerbau und den Hammer in Ordnung und half beim Zersetzen und Ausschmieden der Luppe. Die Knechte machten die Luppen und schmiedeten sie aus. Man rechnete auf den braunschweigischen Hütten auf einen Zentner (zu 114 Pfund) Stabeisen 3 Maß Kohlen = 240 Pfund. 3 Zentner Roheisen gaben 2 Zentner Stabeisen. Überschuss wurde vergütet, doch litt durch das Überschussmachen oft die Qualität. Wöchentlich wurden 50 bis 60 Zentner Stabeisen geschmiedet.
Dieses Klumpfrischen hatte einen großen Abbrand, gab aber ein gutes zuverlässiges Eisen, deshalb wurde es für Drahtseil- und Gewehrplatineneisen auf der Königshütte auch im 19. Jahrhundert noch lange beibehalten.
In den österreichischen Alpenländern war das Löschfrischen in allgemeiner und fast ausschließlicher Anwendung, bis in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts ein Gewerke namens Dietrich in Hollenstein ein verbessertes Frischverfahren einführte, welches Eingang fand und sich allmählich auf die österreichischen und steirischen Nachbarwerke ausdehnte, bis es endlich auch auf allen hauptgewerkschaftlichen Hütten eingeführt wurde. Dieses Verfahren ist bekannt als österreichische Schwallarbeit.
Der Herd war dabei mit Zacken oder Abbrändern ausgesetzt und hatte die folgenden Maße:
Länge der Herdgrube oben 27 Zoll, unten 22 Zoll, Breite der Formwand oben 18 Zoll, am Boden 13 Zoll, die Windseite war um 2 Zoll breiter. Höhe vom Rande des Sinterbleches bis zum Schwallboden 14 Zoll, vom Formabbrande bis dahin 11 Zoll, von der Formmündung 8 bis 9 Zoll. Der Formabbrand stand senkrecht oder war 1 Zoll in die Grube geneigt, das Sinterblech auf der Arbeitsseite 3½ Zoll und der Wolfabbrand auf der Hinterseite 1½ Zoll aus der Grube geneigt. Die Form oder das Esseisen lag 4 Zoll über, die Düsen 4½ Zoll zurück; das Stechen der Form 24 bis 26 Grad. Das Formmaul war halbrund und 3/4 Zoll breit und hoch.
Das Charakteristische dieser Frischmethode war die Herstellung des Herdbodens aus Schlacken (Schwall). Zu diesem Zwecke wurde die Herdgrube erst bis auf 13 bis 14 Zoll vom Rande des Formabbrandes entfernt mit zerkleinerter Frischschlacke gefüllt, die geebnet die Unterlage des Schwallbodens bildete. Diese Unterlage war 3 bis 5 Zoll dick. Hierauf wurde aus großen Stücken garer Schlacke oder Schwall der Herdboden hergestellt, ähnlich wie ein Steinpflaster. Die Oberfläche musste ganz eben sein, die Zwischenräume wurden mit kleinen Stücken und zuletzt mit fein gepochter Schlacke sorgfältig hergestellt. War dieser Schwallboden gut gemacht, so war es nicht nötig, ihn vor dem Frischen festzuschmelzen, indem dies dann bei der ersten Charge von selbst geschah. Ein gut hergestellter Schwallboden konnte Monate lang halten, indem man ihn bei der Arbeit selbst immer nach Wunsch regulieren, ihn erhöhen oder erniedrigen konnte. Die Decke des Schwallbodens betrug 6 bis 7 Zoll. Der Frischer musste fortwährend auf den ordnungsmäßigen Zustand des Schwallbodens Acht geben. Bei normalem Gange sollte er sich bei der Arbeit 1 bis 2 Zoll tief erweichen. Die gare Schlacke des Schwallbodens wirkte zum Frischen mit. Bei zu großer Hitze im Herde, oder zu starker Neigung der Form war aber immer die Gefahr vorhanden, dass der Schwallboden an einer Stelle durchschmolz oder sich ganz auflöste. Dies nannte man das weiche Durchzerennen. Es passierte nur unerfahrenen oder unaufmerksamen Frischern. Größer war die Gefahr, dass das Roheisen zu rasch niederschmolz und das hitzige Eisen und die rohe Schlacke auflösend auf den Schwallboden wirkten, was man das rohe Durchzerennen nannte. Hiergegen musste der Arbeiter fortwährend auf der Hut sein. Er half sich durch Einstellen der Arbeit, Ausräumen des Herdes, Einbetten frischer Schwallstücke und Aufgießen von kaltem Wasser.
Das geeignetste Roheisen für die Schwallarbeit war der großluckige Floß. Bei grellerem Eisen musste man das Einschmelzen verlangsamen, bei weicherem Eisen es beschleunigen, dagegen die darauf folgenden Prozesse verzögern. Das Roheisen wurde in unregelmäßigen Stücken, den Floßenbrocken, eingesetzt. Die Arbeit zerfiel in fünf Abteilungen:
1. die Vorbereitung des Herdes;
2. das Ausheizen;
3. die Bildung des Zerenn- oder Frischbodens;
4. das eigentliche Zerennen oder Frischen, und
5. das Zu- oder Nachzerennen.
Beim Beginn der Arbeit wird der Herd bis auf den Schwallboden ausgeräumt und gereinigt, sodann ringsum an den Rändern feuchte Lösche oder Stübbe festgeschlagen und auf den freien Schwallboden in der Mitte eine Schaufel Weich (Schlacke) aufgeworfen. Die Herdgrube wird mit Kohlen gefüllt, über der Essbank (Formseite) 4 bis 6 Zoll hoher Wall aus nasser Lösche errichtet und rings um den Herd ein Löschkranz aufgeführt. Anders ist die Vorbereitung, wenn man nach ausgebrochenem Dachel den heißen Herd für die folgende Charge vorrichten will. Dann kühlt man erst durch Aufgießen von Wasser ab, reinigt den Herd, ebnet die entstandenen Vertiefungen durch Einschlagen von Lösche ein, füllt dann mit Kohlen und bildet den Löschkranz, wie zuvor beschrieben.
Da der Dachel (die Luppe) bei der Schwallarbeit in acht Masseln zerteilt wird und jede Massel wenigstens zwei Hitzen bekommt, so hat man mindestens 16 Hitzen auszuheizen.
Der Ausheizprozess ist für den Frischer die angestrengteste Periode, umso mehr, weil er während derselben schon einen Teil des Frischprozesses vollenden muss. Von den acht Masseln werden nur drei mit den Masselzangen eingelegt, die übrigen vorläufig in einem einfachen Feuer warm gehalten. Gleichzeitig mit den ersten drei Masseln wird auch schon von der Windseite die erste Floßengarbe mit 50 bis 60 Pfund Roheisen eingehalten. Die Floßengarbe liegt einige Zoll höher als die Masselzangen. Alle liegen möglichst dicht zusammen, um die Hitze gehörig auszunutzen. Bei den Masseln unterscheidet man die Kernstücke und die Ranftmasseln. Letztere sind unreiner, bedürfen stärkerer Hitze, und da mehr weggeheizt wird, tragen sie mehr zur Bildung des Frischbodens bei als die Kernmasseln, weshalb man sie zuerst ausheizt. Man unterscheidet ferner bei jeder Massel die Haarseite und die Reinseite. Erstere ist die unreine Seite und muss mehr geheizt werden, wonach man sich bei dem Einlegen richtet. Ist alles in Ordnung, so gibt man Kohle auf und zwar türmt man gewöhnlich einen Haufen Kohlen auf, den man durch Aufgießen von Lehmwasser von außen vor dem Verbrennen schützt. War der Herd kalt, so muss man langsam anblasen und da der Herdboden noch keinen Saft gibt, weich über die eingehaltene Massel werfen, welcher dieselbe überzieht und vor dem Verbrennen schützt. War der Boden und die Massel heiß, so kann man gleich stärker blasen und das Ausheizen dadurch beschleunigen. Mit dem Aufgeben des Weich muss man sich besonders auch nach der Beschaffenheit des Herdbodens richten.
Die Masselzangen werden anfangs horizontal gehalten, so dass sie 2 bis 3 Zoll über dem Formrand liegen. Die noch höher liegende Floßenzange wird, damit sie nicht nachsinkt, durch Gewichte an ihren Schäften in der Höhe gehalten. Die mittlere Massel, die der Form am nächsten liegt, wird zuerst niedergelassen, so dass sie in das Bereich der flüssigen Schlacke kommt, doch darf sie nicht bis zum Schwallboden sinken. Die Massel wird mehrere Mal gewendet. Hierbei wird sie vorn etwas tiefer eingetaucht, in der Schlacke umgedreht und dann wieder gehoben. Man muss danach streben, eine möglichst saftige Schweißhitze zu geben; eine sengende Hitze ist sorgfältig zu vermeiden. Wird die erste Massel unter dem Hammer zu einem Kolben ausgeschmiedet, so rückt man die zweite über der Form liegende an die Stelle der ersten und schiebt den Kolben mit der Kolbenzange an die frei gewordene Stelle der zweiten Massel ein. Wird ein Platz frei, so folgt das Einsetzen der dritten, vierten u. s. w. Massel und wenn es dann gegen Ende des Ausheizens Platz im Herde gibt, werden weitere Floßengarben nachgetragen. Die Dauer des Ausheizprozesses, wenn ein Hammer zwei Feuer zu bedienen hat, wie das die gewöhnliche Einteilung ist, beträgt 1½ höchstens 2 Stunden.
Während des Ausheizens bildet sich hauptsächlich aus den von den Masseln abschmelzenden Teilen der Schweißboden, auf dem nachher das Zerennen des Roheisens vor sich geht und den man deshalb auch Zerenn- oder Frischboden nennt. Das Einschmelzen des Roheisens darf erst beginnen, wenn der Schweißboden eine gewisse Dicke erlangt hat, damit es nicht zu tief niedersinkt und infolgedessen roh bleibt. Diese genügende Stärke und Ausbreitung, um ihn als Frischboden zu benutzen, erlangt er erst nach einem dreiviertelstündigen Verlaufe des Ausheizprozesses. Er muss dann 4 bis 5 Zoll unter der Form sich befinden und sich eben, fest und klebrig, nicht rau und hart anfühlen. Bildet sich eine Vertiefung, was besonders vor der Form leicht geschieht, so bringt man gare Zuschläge, am besten Stockweich, an die Stelle, sticht etwa vorhandene flüssige Schlacke ab und schwächt den Wind. Nach der dritten Hitze soll sich der Schweißboden bis zur rechten Höhe angesetzt haben, wenn nicht, muss man mit garen Zuschlägen und Schwächung des Windes nachhelfen. Der Frischer muss also fortwährend den Schweißboden mit dem Räumeisen durch die Form untersuchen. Sobald der Schweißboden die richtige Höhe erreicht hat, verstärkt man den Wind und der Frischer schiebt die Masselgarbe so nahe zu der Form, dass sie abzuschmelzen beginnt. Geschieht dies früher, so erhält man einen rohen und zu tiefen Frischboden. Zu langes Warten ist ein direkter Kohlenverlust. Man nimmt zur ersten Floßengarbe die weicheren Floßen. Nachdem etwa die Hälfte der Masseln ausgeheizt ist, wird die zweite Floßengarbe von abermals 50 Pfund Roheisen auf der Windseite eingelegt. Sind nur noch zwei Masseln im Feuer, so lässt man die Floßengarbe neben der mittleren Massel tiefer in das Feuer, wodurch sie rasch einschmilzt. Sofort wird die dritte Garbe von 50 Pfund an die Stelle der zweiten eingelegt. Diese wird in den Schmelzraum gerückt, sobald die letzte Massel herausgenommen ist. Nach beendetem Ausschmieden wird die vierte Floßengarbe an der Gichtseite aufgelegt. Inzwischen ist die erste Garbe nahezu eingeschmolzen. Die Zange wird durch Niederdrücken an den Schäften aufgehoben und der Rest glühendes Eisen, der etwa noch darin hängt, oben auf die Kohlen geschafft. Die zuletzt eingelegte vierte Garbe kommt nun an die Stelle der ersten, worauf noch die fünfte und letzte mit etwa 30 Pfund aufgelegt wird, so dass der ganze Einsatz 230 Pfund beträgt. Diese Teilung in fünf kleinere Garben ist viel vorteilhafter als das Einlegen von zwei höchstens drei großen; die Arbeit ist dabei allerdings etwas anstrengender, weil das Aufgeben von Kohlen und Schlacken immer nur in kleinen Mengen erfolgen kann.
Der Frischprozess selbst muss in einem entsprechenden garen Gange weiter geführt werden, was hauptsächlich durch die richtige Schnelligkeit des Einschmelzens erreicht wird, ferner durch die Menge und Art der Zuschläge, durch das Abstechen des Sinters und durch die Verschiedenheiten in der Stärke des Windes. Die Beschaffenheit des Frischbodens, die Menge und Art der Schlacken und das Aussehen der Flamme, „des Lauches“, geben dem Frischer die nötigen Kennzeichen. Der Boden wächst näher zur Form und das niederträufelnde Eisen gart unter gelindem Aufkochen. Man hält das Eisen absichtlich längere Zeit bei starker Hitze flüssig. Dies ist das „Dünneisen“. Seine Bildung ist erwünscht und seine Bildung wird befördert, je garer der Gang ist. Gegen Ende des Zerennens, wenn der Boden der Form schon sehr nahe kommt und eine Pfanne vor derselben bildet, findet es sich oft in Menge ein. Richtiges Dünneisen legt sich schnell um das kalte Räumeisen und erscheint nach dem Herausziehen als schweißwarmes Eisen mit glatter Oberfläche und blendend heller Farbe; es lässt sich hämmern und ist schwer von dem Spieß abzubringen, während rohes oder wildes Dünneisen bricht und abfällt. Noch schärfer tritt dieser Unterschied hervor nach dem Ablöschen in Wasser. Wildes Dünneisen ist immer ein Fehler.
Das Dünneisen begleitet das Frischen, dessen Schluss das Verkochen des letzten Dünneisens bildet. Sobald Dünneisen gebildet ist, schiebt man die Floßengarben vor und verstärkt den Wind. Ein Fehler, der besonders vermieden werden muss, ist das Herausfallen von Roheisenbrocken aus der Zange, weil diese rohen Durchschuss der Luppe geben, den Boden verderben und die Dünneisenbildung verhindern. Auch zu viel Schlacke verhindert die Dünneisenbildung, weil dann die genügende Hitze nicht erreicht wird. Zu viel Dünneisenbildung ist aber auch schädlich, weil es vom Winde herumgeworfen wird oder zu heftig kocht und leicht die Form angreift. Die Schlacke lässt man gewöhnlich 3 bis 4 Zoll hoch im Herde stehen. Die gare Schlacke erscheint am Räumeisen licht und gleichmäßig verteilt, erkaltet langsam und gleichmäßig und fällt erst nach mehreren Schlägen ab. Gare Schlacke wird nur dann abgestochen, wenn ihre Menge so groß ist, dass sie die Form verlegt. Gewöhnlich geschieht dies ein- bis dreimal. Rohe Schlacke sticht man sofort ab. Vor dem Schluss des Zerennens wird die Schlacke möglichst vollkommen abgelassen. Die Stärke des Windes pflegt etwa 24 Zoll Wassersäule zu betragen. Sind alle Garben aus dem Feuer, so folgt das Nachzerennen. Diese Arbeit dauert 10 bis 20 Minuten und da bei deren Schluss alle Kohlen verzehrt sein sollen, so muss man sich mit dem Kohlenaufgeben danach richten. Der Zweck dieser Arbeit ist, das Dünneisen zu verkochen, alle noch im Feuer befindlichen losen Brocken, welche von den letzten Floßenresten und den Zusätzen stammen, die Ränder und Ansätze vom Dachel abzustoßen und wieder einzuschmelzen und endlich die Schlacke zu entfernen und die Reinseite (Oberfläche) zu kühlen. In dem Maße, als die Kohlenmenge abnimmt, wird der Wind geschwächt und der Löschkranz weggeräumt. Ist alles Dünneisen verkocht, so wird die Schlacke abgestochen. Alsdann wird zum Ausbrechen des Dachels geschritten. Dies geschieht mit der großen Brech- oder Dachelstange von der Ecke zwischen Sinterblech und Windseite aus und wird dabei der Dachel gewendet, so dass er mit der Reinseite auf die Essbank zu liegen kommt, von wo er mittels der Zugstange, oder, wo keine vorhanden ist, mit einem Karren zum Hammer gebracht wird. Bei dem Aufbrechen helfen dem Frischer noch zwei Arbeiter mit Haken.
Nach dem Aussehen des Dachels kann der Frischer auf seine Beschaffenheit schließen. Seine Oberfläche muss voll, eben und glatt sein. Noch deutlicher zeigt sich die Güte des Dachels unter dem Hammer. Bei einem guten Dachel fällt beim Drücken oder Zängen beinahe nichts ab. Wenn der Hammer von Anfang an hart auffällt, so ist der Dachel zu roh, fällt er auch nach fortgesetztem Schlagen immer weich auf, so ist er schwammig und übergar. Der Dachel wird mit der Reinseite nach unten etwas ausgebreitet und dann mit der Schrothacke in zwei Hälften gehauen, welche in acht gleiche oder in sieben ungleiche Masseln geteilt werden. Dies Schroten und Drücken geht bei ununterbrochenem Gange des Hammers fort, so dass es in 7 bis 8 Minuten beendet ist, wobei der Hammermeister, der Hammerknecht und der Wassergeber zusammen arbeiten. Ein roher Dachel, der sich unter dem Hammer „stößt“, d. h. Risse bekommt, muss bei geringerer Hitze und langsamen Schlägen bearbeitet werden. Beim Ausschmieden jeder Massel muss man dieselbe zum Ganzmachen erst parallel mit der Ambossbahn halten und dann erst zum Ausrecken rechtwinkelig dazu. Das beste Eisen der Mittelstücke wurde zu Drahteisen ausgereckt, das nächstgute zu Nageleisen, das übrige zu Zaggeleisen. Andere Sorten wurden bei der österreichischen Schwallarbeit, welche nur auf Weicheisen arbeitete, nicht gemacht.
Wenn ein „Schlag“, d. h. ein Hammer, zwei Frischfeuer bediente, wie dies die Regel war, so wog er 500 Pfund, hatte 18 bis 20 Zoll Hub und machte 120 Schläge in der Minute. Bei einem Feuer, bei dem 4 Dachel den Tag (12 bis 16 Stunden) gemacht wurden, waren gewöhnlich drei bis vier Mann, bei doppelter Besetzung, wenn nachts durchgearbeitet wurde und 8 Dachel erzeugt wurden, sechs Mann erforderlich; bei zwei Feuern zu einem Schlag, wo 10 Dachel in der Schicht gemacht wurden, waren sechs Mann, bei doppelter Besetzung, wo 14 Dachel in 24 Stunden gemacht wurden, noch zwei bis drei Mann mehr erforderlich. Die Bezahlung geschah nach Gewicht und wurde für Draht- und Nageleisen etwas mehr vergütet. Das Kilo betrug 14 bis 15 Proz., der Kohlenverbrauch 23 bis 25 Kubikfuß Fichtenkohle auf 100 Pfund fertiges Eisen.
Der Kohlenaufwand zur Erzeugung von Schmiedeeisen in Herden war je nach der Natur der Eisenerze und des Eisens, sowie auch der Holzkohlen selbst, ein sehr verschiedener und haben die angegebenen Gewichte nur ganz entfernt einen Maßstab zur Vergleichung der Ökonomie der betreffenden Methoden.
Nach Hassenfratz und Hasse betrug Ende des Jahrhunderts der Aufwand an Holzkohlen für die Darstellung von 100 Pfund Schmiedeeisen aus den Erzen
bei den Katalonschmieden 400 Pfd.
„ dem indirekten Verfahren in Frankreich 500 bis 800 „
im Depart. Lot 1000 bis 1400 „
in Lauchhammer 629 „
„ Malapane 645 „
„ Peitz 672 „
„ Burghammer in der Lausitz 712 „
„ Schmiedeberg bei Dresden 770 „
zu Turrach 573 „
„ Horzowitz in Böhmen (angeblich) 353½ „
in Sibirien 493 „
Diese schwankenden Zahlen können kaum zu einer Vergleichung dienen. Je nach der Natur der Erze fanden schon beim Ausschmelzen im Hochofen die größten Verschiedenheiten in Bezug auf den Kohlenverbrauch statt.
Aus einer Zusammenstellung Marchers über die Resultate verschiedener Verfrischungsmethoden ergibt sich an Produktion in 24 Stunden und Kohlenverbrauch auf 10 Ztr. geschmiedetes Eisen:
Ausbringen Kohlenverbrauch auf 10 Ztr.
Für die Steierische Wallonschmiede 642 Pfd. 457 Kbfss.
„ schmalkaldisches Löschfeuer 1015 „ 677 „
„ die deutsche Frischschmiede 800 „ 360 „
„ „ märkische Osemundschmiede 560 „ 430 „
„ „ Kochschmiede in Altwied — „ 350½ „
„ das Kaltfrischfeuer 500 „ 463⅘ „
„ die Kärntner Schmiede: Plattlheben,
Braten und Einschmelzen 908 „ 369 „
„ die Luppenfeuer in Korsika 255 „ 217½ „