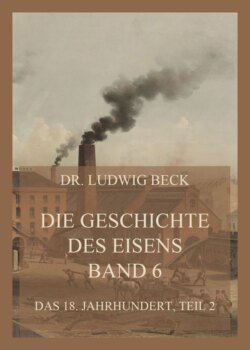Читать книгу Die Geschichte des Eisens, Band 6: Das 18. Jahrhundert, Teil 2 - Dr. Ludwig Beck - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Hochofenbetrieb Ende des 18. Jahrhunderts.
ОглавлениеIndem wir uns zu den Fortschritten der Roheisenerzeugung in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts wenden, müssen wir zunächst einiger Verbesserungen der Steinkohlen- und Torfverkohlung Erwähnung tun.
Graf Dundonald führte in England geschlossene Verkokungsöfen mit gleichzeitiger Gewinnung der Nebenprodukte ein.
Das Patent, welches Graf Archibald Dundonald am 30. April 1781 nahm, war erteilt für Herstellung von Teer, Pech, ätherischen (essential) Ölen, flüchtigem Alkali, mineralischen Säuren, Salzen und Koks (zinders) aus Steinkohlen. Die Erfindung bestand nach der Beschreibung darin, „dass man durch Gefäße oder Bauwerke, in welchen man die Steinkohlen, aus denen man die oben erwähnten Substanzen destillieren will, einsetzt, die äußere Luft durch einen oder mehrere Zugänge zulässt, einerlei ob die Kohlen allein oder mit Kalkstein, Kiesel, Eisenerz, Backsteinen oder anderen Substanzen so gebrannt werden, dass sie durch ihre eigene Hitze, ohne zu flammen, und ohne Hilfe eines anderen Feuers durch Destillation oder Verdampfung ihre Teere, Öle, Alkalien, Säuren und Salze in Vorlagen oder Kondensationsgefäße abgeben“. — Diese Methode, Teer, Öl u. s. w. aus Steinkohlen zu gewinnen, war verschieden von dem gebräuchlichen Verfahren der Destillation der Kohlen in geschlossenen Gefäßen. Die Kondensation der flüchtigeren Gase wurde befördert durch Vermischung mit Wasserdampf und darauf folgende Anwendung von kaltem Wasser. Durch die Zuleitung der Luft und die Durchleitung der Dämpfe durch verschiedene Kondensationsgefäße wurden verschiedene Öle entsprechend ihrer Kondensationsfähigkeit gewonnen.
Die Koksöfen des Grafen Dundonald fanden zwar hauptsächlich der mit denselben verbundenen Teergewinnung wegen Verbreitung, doch lieferten sie auch einen sehr brauchbaren Schmelzkoks, weswegen sie auch auf vielen Eisenhütten eingeführt wurden; so fand Svedenstjerna auf dem Eisenwerk Calcutt bei Brosley 20 Dundonaldöfen im Betrieb.
Die Versuche, Torf und Torfkohle in der Eisenindustrie zu verwenden, hatten auch in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts nur mäßigen Erfolg. Der große Aschengehalt des Torfes machte seine Anwendung zu jedem Schmelzprozess nahezu unmöglich. Ebenso war die Asche durch ihre schädlichen Bestandteile da von Nachteil, wo es sich um Prozesse handelte, bei welchen das Brennmaterial mit dem Metall in unmittelbare Berührung kam.
In Kärnten hatte man wiederholt vergeblich versucht, Eisenerze im Hochofen mit Torf oder Torfkohlen zu schmelzen, so 1772 zu Gmünd nur mit Torf. 1799 machte v. Marcher Versuche in der Heft mit Zusatz von ⅓ Torfkohlen zu Holzkohlen, die angeblich gut ausgefallen waren, aber doch nicht fortgesetzt wurden.
Versuche, mit Torf zu frischen, wollten natürlich noch weniger gelingen. Solche Versuche wurden beispielsweise anfangs der 70 er Jahre in Oberschlesien gemacht. Graf Preysing machte 1789 ähnliche Versuche mit verkohltem Torf von Wildenwart auf dem Hammerwerk zu Hohenaschau in Oberbayern.
1793 wurden auf Veranlassung der bayerischen Regierung Schmelzversuche mit rohem, trockenem Torf in dem Hochofen der Eisenhütte zu Bergen angestellt, worüber Fr. M. Wagner ausführlich berichtet hat. Man begann mit Torf von Einsiedlermoos im Inngebiet und setzte dann 1794 die Versuche mit Torf von Wildenwart fort, die dann auch 1796 und 1798 noch weiter geführt wurden. Das Ergebnis war, dass ein Zusatz von ⅕ zu der Holzkohle den Betrieb nicht beeinträchtigte, dass aber schon beim Zusatz von ¼ Torf üble Folgen eintraten.
1792 hatte man ähnliche Versuche in Oberschlesien auf den Eisenhütten zu Malapane und Kreuzburger Hütte unternommen. Aus diesen ergab sich, dass der Torf die Holzkohle nicht ersetzen konnte, dass guter Torf bis zu ⅓ dem Volumen nach zugesetzt werden durfte, wobei etwa ⅕ an Holzkohle erspart wurde; dass aber die meisten Torfaschen die Schlacken zähflüssig machten und einen strengen Ofengang herbeiführten, so dass der Zusatz von Torf von Zeit zu Zeit ausgesetzt werden musste. Außerdem verminderte der Torfzusatz die Produktion. Ein Vorteil wurde also durch den Torfzusatz nicht erzielt. Mit diesen Ergebnissen standen diejenigen, welche Lampadius bei einem Versuchsschmelzen auf einer Hütte des Grafen Sternberg mit einem Gemenge von 1 Tl. trockenem Torf und 4 Tln. Holzkohlen erlangt haben wollte, in Widerspruch. Wagner, welcher die Frage der Torfverwendung sehr eingehend geprüft hat, sprach aber diesen Versuchen jeden Wert ab.
Nach Wagners Erfahrungen konnte bei ⅙ Zusatz von Torf durch 3 Tle. Torf nur 1 Tl. Holzkohle gespart werden und das Roheisen hatte einen größeren Abgang bei seiner Verarbeitung, als ohne Torfzusatz.
Beim Frischen erzeugte ein Torfzusatz fast immer Rotbruch. Dagegen wendete man in den Gegenden, wo der Torf billig war, denselben mit Vorteil zu Glühfeuern an. Guter Torf erwies sich bei richtiger Luftzuführung auch als ein geeignetes Material für Flammenfeuerung, und Versuche auf der Kreuzburger Hütte in Oberschlesien vom Jahre 1797 ergaben, dass Torfkohle in der Esse des Zainschmiedes fast dieselben Dienste leistete, als ein ebenso großes Volumen von Holzkohlen.
Im Hochofenbau und -Betrieb gab sich seit der Mitte des Jahrhunderts ein eifriges Streben nach Verbesserungen kund; am meisten war dies in England und Schweden der Fall. In England war es veranlasst durch den Übergang zum Koksofenbetrieb und die Einführung stärkerer Gebläsemaschinen, in Schweden wurde es herbeigeführt durch ein sachgemäßes Zusammenwirken von Regierung, Hüttenbesitzern und Technikern.
Der Hochofenbetrieb war nach Schweden aus dem Auslande gekommen; im 16. Jahrhundert hatten deutsche Hüttenleute Hochöfen angelegt, im 17., mehr wie hundert Jahre später, kamen Franzosen (Wallonen) in das Land, welche solche nach ihrer Weise bauten. Lange Zeit hielten sich diese Methoden ganz getrennt. Bau und Betrieb wurden nach Überlieferung und Zunftregeln ausgeführt. Die Meister, welche den Hochofenbau besorgten, waren streng geschieden von den Schmelzmeistern, welche den Betrieb leiteten; die ersteren hießen Stegresare, die letzteren Masmästare. Da diese Trennung auch in Deutschland bestand, so scheint sie von dorther übertragen worden zu sein. Jeder der Meister betrieb seine „Kunst“. Die Masmästare hießen in Deutschland Massen- oder Maschenbläser von dem Hochofen, der Massenofen (schwed. Massugn) hieß. Zweifellos ist aus der deutschen Bezeichnung das schwedische Wort entstanden. Anders war es mit dem ebenfalls sehr eigentümlichen Wort Stegresare. Dieses war schwedischen Ursprungs, aus steges upresande, was „Aufrichten der Leiter“ heißt, gebildet, indem von alters her der Ofenbaumeister sich einer Art Leiter, der Hochofenleiter (Masugns-stege) bediente, um das Profil des Ofeninnern zu bestimmen und den Ofen danach zu erbauen. Wir fanden dies bereits bei Swedenborg dargestellt (s. S. 139). Diese Ofenbaumeister wurden früher in den einzelnen Bergrevieren von den Bergmeistern und Bergrichtern angestellt. Sie waren aus den Hochofenarbeitern hervorgegangen, hatten außer ihrer Erfahrung weiter keine Ausbildung und hingen fest an dem Herkommen. Als man nun gegen Mitte des 17. Jahrhunderts Verbesserungen im Hochofenbau anstrebte, leisteten sie entweder Widerstand oder machten die Sache verkehrt; ganz ähnlich, wie in Deutschland. Die Hüttenbesitzer, meist verständige Grundbesitzer, die zusammenhielten und unter sich eine Gesellschaft — Brucks-Sozietät — zur Förderung des Eisenhüttenwesens gegründet hatten, sahen ein, dass der alte Schlendrian nicht so fort gehen konnte und beriefen theoretisch und praktisch gebildete Hüttenleute, welchen sie die Förderung des Hüttenwesens, die Aufsicht über Neubauten, Anlagen und Einrichtungen und den Betrieb übertrugen. Dies waren die Oberhochofenmeister. Der erste war der berühmte Sven Rinman, dem am 4. März 1751 dieses Amt übertragen wurde. Der Nutzen dieser Einrichtung zeigte sich alsbald. Da die Arbeit für einen Mann aber zu viel war, so stellte man noch einen zweiten, dritten und zuletzt noch einen vierten Oberhochofenmeister an. Einer von diesen war Garney, der in seinem berühmten Werke über die Hochöfen in Schweden die Ergebnisse der Tätigkeit dieser Beamten und der erzielten Fortschritte im schwedischen Hochofenwesen in der Zeit von 1750 bis 1790 ausführlich geschildert hat. Danach gab es, wie schon erwähnt, um die Mitte des Jahrhunderts zwei Arten von Hochöfen, die deutschen und die französischen, die wesentlich voneinander verschieden waren. Beide Arten von Öfen waren nach der neuen Hüttenordnung von 1766 gestattet.
Die deutschen Hochöfen waren in der Regel am Abhang eines Hügels erbaut und in denselben eingegraben. Die Eckpfeiler der Abstichseite und die Balgseite wurden aus Balken gezimmert und der Raum innerhalb dieses Zimmerwerks bis zum Ofenfutter mit Steinen und Tonmörtel ausgefüllt. Ebenso wurde der Rauschacht durch ein Zimmerwerk von Holz mit ähnlicher Füllung, dem sogenannten Erdgezimmer (Mulltimmer) ersetzt. Innerhalb dieser Wände wurde dann der eigentliche Ofenschacht aus feuerfesten Steinen eingemauert. Die Höhe der Öfen überstieg nie 12 Ellen (6,92 m). Die Rast begann 45 cm unter der halben Ofenhöhe. Die Gestalt war meist achteckig und wurde nach einer von Riegeln und Latten in Form einer Leiter zusammengeschlagenen Schablone aufgeführt. Die Fundamentierung war oft mangelhaft, aber für Luftzirkulation unter dem Gestell wurde immer gesorgt. Man beförderte diese womöglich durch fließendes Wasser, weshalb man den Ofen gern über einer Quelle erbaute. Die Zustellung war breiter, kürzer und niedriger unter der Form als bei den Öfen der Wallonen, auch machte man Form, Tümpel und Damm von Gusseisen. Letzteren hatte man nach und nach durch einen Wallstein, meist aus Kalkstein, mit einem Stichloch und einem Lacht- oder Schlackenloch auf der gegenüberliegenden Seite ersetzt. Der eigentliche Abstich lag nach der Formseite zu. Die hölzernen Bälge waren nur 6 Ellen (3,46 m) lang. Einen wesentlichen Unterschied im Betriebe machte es, dass die Schlacke nicht frei abfloss, sondern förmlich abgezapft oder abgezogen werden musste. Man arbeitete auf hellgraues bis halbiertes („mäßig hartgrelles“) Roheisen, welches für die deutsche Frischschmiede am geeignetsten war.
Der wallonische oder französische Hochofen unterschied sich zunächst dadurch, dass er ganz in Stein aufgeführt wurde. Dies erforderte ein stärkeres Fundament. Man stellte den Ofen nicht an den Berg, sondern frei. Schon aus diesem Grunde musste man das Fundament mehr heraus bauen, um für die Abzüchte das nötige Gefälle zu bekommen. Der Schacht war geräumig und kreisförmig. Die Ofenhöhe betrug 14 bis 15 Ellen (8 bis 8,65 m). Der Kohlensack lag auch hier 42 cm unter der mittleren Ofenhöhe. Die Ofenbrust wurde auf eisernen Tragbalken (Trachten) aufgeführt und so geräumig, dass die größeren Bälge von 8 bis 9 Ellen (4,6 bis 5,2 m) genügenden Platz hatten. Das Gestell war länger, schmäler und tiefer unter der Form und mit steiler aufgezogener Rast als bei den deutschen Öfen. Die Form bestand nur in einem quadratischen Loch von 6 Zoll Seitenlänge in der Gestellwand für die Balgdüsen, welches während des Blasens, soweit es nötig schien, mit Ton zugeschmiert wurde. Tümpel und Damm waren von Stein. In letzterem war kein Abstichloch angebracht, sondern dieses wurde in dem freibleibenden Schlitz zwischen Wallstein und Windbacken (blåsväggen), der mit Ton ausgefüllt wurde, ausgespart. Man erblies bei hohem Erzsatz weißes Eisen, wie es für die Wallonschmiede verlangt wurde. Die Schlacken flossen beständig frei ab.
Die Verbesserungen, welche in dem schwedischen Hochofenbetrieb eingeführt wurden, bestanden nicht in großen Reformen oder neuen Erfindungen, sondern in der wissenschaftlichen Grundlage, welche dem Hochofenbau und -betrieb, welche bis dahin von der krassesten Empirie geleitet worden waren, gegeben wurde. Es war sogar das eifrige Bestreben der Oberhochofenmeister, die überlieferten Einrichtungen möglichst zu schonen und zu entwickeln. Die schwedischen Verhältnisse verlangten das.
Die Hochofenbesitzer waren teils reiche Adlige, teils arme Bauern. Diese konnten nicht mit demselben Maß gemessen werden. Die deutsche Art des Hochofenbaues war bei dem außerordentlich niedrigen Holzwert viel billiger und wurde deshalb von den Bauern vorgezogen. Die Reichen konnten sich eher massive Öfen aus Stein bauen. Allmählich verbanden sich aber benachbarte Bauern, um statt mehrerer kleiner Öfen mit Holzumkleidung einen größeren steinernen Ofen zu errichten, und so verschwand nach und nach die erstere Art von Hochöfen. Die genauen Vorschriften über die Fundamentierung, den Bau des Raumauerwerks, der Ofenbrust oder Rast, des Schachtes und der Gicht, welche in Garneys Werk mitgeteilt werden, hatten nur für Schweden Bedeutung. Wir heben deshalb nur einige historisch wichtige Einzelheiten daraus hervor.
In Bezug auf die Wahl des Standortes der Hochöfen ging man von dem alten nationalen Grundsatz — denn auch die alten Bauernöfen waren so gebaut gewesen —, dem Anbau an einem Bergabhang, ab und stellte die Öfen möglichst frei (Fig. 186, a. v. S.).
Man führte das Raumauerwerk aus Steinen auf. Für einen so schweren Mauerblock, dessen Gewicht sich auf 9000 bis 10000 Schiffspfund (etwa 1600 Tonnen) berechnete, gehörte ein festes, dauerhaftes Fundament. Am besten war eine Unterlage von festem Felsen; war diese nicht zu haben, so wählte man einen guten Kiesgrund, wobei man aber erst die Grundfläche ebnen und, wo der Untergrund nicht sicher genug schien, durch künstliche Mittel nachhelfen musste. Hierfür diente in dem holzreichen Schweden ein starker Holzrost. Derselbe bestand aus doppelten, kreuzweise gelegten, horizontalen Balkenlagen. Die Balken waren aus fettem, harzreichem Tannenholz, 9 Zoll dick, auf zwei Seiten behauen, welche, damit sie nicht ausweichen konnten, mit starken Holzpflöcken verbunden waren. Fig. 186, 187 und 188 a a zeigen die Anordnung eines solchen Balkenrostes. Der Rost musste so tief liegen, dass er unter dem Niveau des Grundwassers lag. Die Balken mussten so lang sein, dass sie 1½ Ellen über das Fundament hinausragten. Zum Wassergraben stellte man den Hochofen so, dass jener mit dem Wasserrad hinter der Rückwand des Ofens lag. In der Regel lag der Brustpfeiler, welcher das Blasegewölbe von dem Arbeitsgewölbe trennte, rechts. In Schweden baute man aber nicht selten zwei Hochöfen nebeneinander in ein gemeinschaftliches Raugemäuer ein (Fig. 189). Dies geschah namentlich auf den Hütten, wo Kanonen gegossen wurden, die oft so groß waren, dass aus zwei Öfen zugleich abgestochen werden musste. In diesem Fall war der Brustpfeiler des einen Ofens links, der des anderen rechts, wie auch die Blasegewölbe sich gegenüber lagen. Die beiden Ablassgewölbe waren durch den gemeinschaftlichen Pfeiler M getrennt.
Das Material für das Mauerwerk in Schweden war grauer Granit, sogenannter Graustein (Gråsten). Das Fundament des Hochofenschachtes wurde in dem Fundament des Raugemäuers, dem Ofenstock, besonders eingebaut. Das Grundmauerwerk der beiden Gewölbe wurde nur mit gewöhnlichen Füllsteinen aufgeführt.
Das Einbauen des Gestelles war nicht Sache des Ofenbaumeisters, sondern des Schmelzmeisters. Dies bleibt deshalb vorläufig außer Betracht; der Ofenbaumeister hatte nur Platz für dasselbe zu lassen.
Was die alten Meister, welche die steinernen Öfen nach wallonischer Art gebaut hatten, nicht verstanden hatten, war die richtige Abführung der Feuchtigkeit aus dem nassen Mauerwerk und die Verankerung. Infolgedessen war es sehr gewöhnlich gewesen, dass diese Öfen große Risse und Sprünge bekamen, was sehr nachteilig auf den Betrieb einwirkte. Daher lässt es sich erklären, dass sich in Schweden ein Vorurteil gegen die steinernen Öfen ausbildete und man die Öfen mit Erdzimmerung vielfach vorzog. Zu den wichtigsten Verbesserungen, welche in diesem Zeitraum von den Oberhochofenmeistern eingeführt wurden, gehörte die richtige Ventilation und Verankerung des Raumauerwerks, welches ihm die nötige Festigkeit gab, um der Ausdehnung der Hitze von innen während des Betriebes und der Zusammenziehung durch die Abkühlung nach dem Ausblasen Widerstand leisten zu können. Zu dem doppelten Raumauerwerk nahm man gute, lagerhafte Grausteine, namentlich zu der inneren Mauer.
Aber das beste Material und die sorgfältigste Maurerarbeit würde keine Dauerhaftigkeit gewährt haben, wenn man dasselbe nicht durch eiserne Anker befestigt und verbunden hätte. Früher hatte man sich mit einer Verklammerung von Holzbalken von außen begnügt. Die wenigen eisernen Anker, die man allenfalls angewendet hatte, waren ziemlich willkürlich eingelegt. Jetzt legte man ein ganzes Netzwerk von eisernen Ankern in regelmäßigen Lagen ein, wie es Fig. 190 zeigt. Die Anker in den unteren Lagen waren 2½ Zoll breit und ½ Zoll dick; die in den oberen, von der fünften Lage an, 2 Zoll auf ½ Zoll. Wo die Stangen nicht lang genug waren, verband man sie durch Augen (A A).
An den Außenwänden befestigte man die Anker mit Schließen und Scheren (siehe Fig. 186, 188). Die unterste Lage lag im Fundament.
Den oberen Teil des äußeren Raumauerwerkes führte man zuweilen statt in Bruchsteinen in Erdzimmerung aus, wie aus Fig. 186 ersichtlich ist. Die äußere Zimmerung wurde dabei aber sorgfältiger und mit beschlagenem Holz ausgeführt, während man früher diese Bekleidung sehr roh aus unbeschlagenen Stämmen, deren Enden man übereinander gehen und vorstehen ließ, gemacht hatte.
Durch das Blasegewölbe und das Arbeitsgewölbe gelangte man zu dem inneren Schmelzofen. Die Decke dieser Zugänge war entweder wirklich gewölbt oder sie war auf starken eisernen Tragebalken (Trachten) treppenförmig aufgemauert. Früher hatte man Steinplatten eingemauert, welche auf hölzernen Balken auflagen. Die eisernen Tragebalken auf beiden Seiten im Raumauerwerk waren meistens aus Gusseisen, wo aber Gusseisen mangelte, aus Schmiedeeisen. Es war die Aufgabe des Hochofenbaumeisters, die Decke hoch genug zu machen, um den Bälgen und den Arbeitern bequem Zugang zu verschaffen, ohne das Mauerwerk so zu schwächen, dass die Wirkung der Hitze in der Rast, welche zum Teil auf der Decke aufruhte, unangenehm wurde. Diese sorgfältigere Herstellung der Ofenbrüste, wie sie Garney nennt, gehörte zu den neueren Verbesserungen. Die gewölbte Hochofenbrust hatte Rinman zuerst in Schweden eingeführt. Sie war vordem nur in England angewendet worden. Über den Bau derselben berichtet Garney ausführlich.
Von großem Interesse sind die Betrachtungen über die richtige Gestalt des Ofeninneren. Der Verfasser geht dabei sowohl von theoretischen als auch von praktischen Erwägungen aus. Nach der Theorie muss die richtigste Form aus den Bedingungen der Verbrennung und der Schmelzung sich ergeben. Die Verbrennung muss, um zur Wirkung zu kommen, in dem eingeengten Raum des Gestelles geschehen. Sie findet aber nicht momentan, sondern allmählich statt. Der aufsteigende Gasstrom vermehrt sich und erfordert einen größeren Raum, bis zu einem gewissen Maximalpunkt. Von da an nimmt die Erzeugung und Spannung der Gase in ihrer fortgesetzten Bewegung nach oben ab. Umgekehrt werden die Erze und Kohlen oben eingestürzt, bedürfen einer gewissen allmählichen Erwärmung, bis sie den Hitzegrad erreicht haben, dass die Schmelzung der Schlacken und die Reduktion beginnt. Dafür ist eine gewisse Auflockerung und Ausbreitung zweckmäßig. Wenn der Beginn der Schmelzung mit dem Moment der größten Ausdehnung des Gasstromes zusammenfällt, so sind die Bedingungen am besten erfüllt. Diese theoretische Betrachtung gibt schon das eine wichtige Resultat, welches die schwedischen Baumeister auch festhielten, dass, da der Übergang dieser Expansion und Kontraktion der Hochofengase ein allmählicher, kein sprungweiser ist, auch die Übergänge im Querschnitt des Hochofens, die Erweiterung und Verengerung nicht durch Winkel, sondern durch Kurven ihren Ausdruck finden müssen. Die richtige Kurve in jedem Falle theoretisch zu ermitteln, war schwer, da die wirkenden Faktoren zu wenig bekannt waren. Da trat dann eine praktische Erwägung helfend ein. Man beobachtete die Form ausgeblasener Hochöfen, die in gutem Gange gestanden hatten. Alle Öfen verändern während der fortgesetzten Schmelzung ihre Gestalt und gehen erst am besten, wenn diese Veränderung einen gewissen Punkt erreicht hat. Diese Form könnte man nur dann finden, wenn man den Ofen in dem Augenblick des besten Ganges ausbliese. Da dies nicht möglich war, so musste man sich damit begnügen, die Formen ausgeblasener Öfen, wie sie vorkamen, zu vergleichen.
Diese Untersuchung führte aber doch zu gewissen Ergebnissen, deren wichtigste Garney, wie folgt, angibt:
Der größte Nutzen der Schmelzung wird erhalten, wenn der Schmelzraum in einem Hochofenschacht so viel Hitze bekommt, als bewirkt werden kann und wenn der Vorbereitungs- oder Röstraum so geräumig wie möglich ist. Man muss also den Schmelzraum zusammenziehen, was durch Verminderung des Inhalts oder Verrückung des Schmelzpunktes nach innen und unten geschehen kann. Die andere Regel ist die, dass, obgleich nicht alle Eisensteine von gleicher Beschaffenheit sind, sie doch darin übereinstimmen, dass sie einen gleich tiefen Schmelzraum erfordern. Was aber sowohl die verschiedenen Durchmesser des Schmelzraumes auf ungleichen Höhen, als die Tiefe und verschiedenen Durchmesser des Vorbereitungsraumes anbetrifft, so muss solches nach der Art und dem Verhalten jedes Erzes im Feuer eingerichtet werden.
Nach dem Verhalten der schwedischen Erze konstruierte Garney drei Normalprofile, deren Hauptunterschied in der Schachthöhe, welche für leichtschmelzige Erze geringer sein kann als für strengflüssige, bestand.
Zur richtigen Herstellung des Profils dient die Leiterschablone, deren Kernstock in Zapfen läuft (Fig. 191), die genau in der Verlängerung der Mittellinie des Ofeninneren befestigt werden. Die Sprossen, welche das Längenprofil bilden, stehen nur 15 cm voneinander ab, so dass sie wirklich als Leiter von den Arbeitern benutzt werden konnten. Als Baumaterial für den Hochofenschacht dienten in Schweden feuerfeste Natursteine, Glimmerschiefer, Sandstein und Schiefer, namentlich ein Talk-Glimmergestein aus Nora-Bergrevier, von dem ein Schacht bei Nors 80 Kampagnen ausgehalten hatte. In einigen Gegenden, wie in Dannemora und Lindes-Bergrevier, machte man künstliche Schachtsteine aus Schlacken, dieselben waren aber von sehr ungleicher Güte; für die Hütten war dieses Material das billigste. Als Mörtel diente nur feiner, feuerfester Lehm.
Die Schachtmauerung begann in den Gewölben über den Schachttrageisen, im übrigen Ofen etwas unterhalb auf dem Schachtfundament. Bis zur Höhe des Gestelles (Fig. 188 u. 191 c c) wurden die Wände senkrecht aufgeführt und sprangen etwas zurück. Von da an begann der eigentliche Ofenschacht. — Vom obersten Schachtring, dem Kranz ab gab man dem Kranzboden oder der Gicht nach allen Seiten hin etwas Fall. Wo man Schlackenziegel anwendete, mauerte man den Schacht in zwei gleichförmigen Schichten auf, zwischen denen man eine Sandfüllung von 2 bis 3 Zoll anbrachte. Zwischen Schacht- und Raumauerwerk blieb immer eine stärkere Isolierschicht (Fig. 188 T T) von 6 Zoll, welche mit reinem Sand ausgefüllt wurde. Da die Gichtmündung viel zu leiden hatte, so schützte man sie innen durch eiserne Ringe; obenauf legte man die 12 bis 18 Zoll breiten gusseisernen Kranzplatten. Manchmal erhöhte man auch den Schacht über dem Gichtboden, indem man einen Schachtkranz aufmauerte, was da, wo man mit Körben aufgab, ganz zweckmäßig war. — Außerdem war der Gichtboden selbst von einer Schutzwand, dem Gicht- oder Hochofenkranz, eingeschlossen, welcher entweder aus Brettern oder aus Mauerwerk hergestellt war. Das Holzwerk wurde, um es vor dem Anbrennen zu schützen, mit roter Erdfarbe und mit Vitriollauge bestrichen. Für gemauerte Gichtkränze waren Schlackenziegel sehr geeignet. Der Umbau um die Gicht (s. Fig. 186) war in dem rauen, nordischen Klima unentbehrlich und geschah mit größerer Sorgfalt als in den südlicheren Ländern.
Das Einbauen und die Zurichtung des Ofengestelles war, wie schon erwähnt, Sache des Hochofen- oder Schmelzmeisters (Masmästare) und die schwedische Hochofenordnung von 1766 erkannte keinen als Meister an, der außer der Betriebsleitung nicht auch die Zustellung (Ställa) verstand; man nannte dies die Gestellmeisterkunst. Für jede neue Kampagne wurde ein neues Gestell eingebaut, während der Ofenschacht möglichst viele Reisen aushalten musste. Die Größe des Gestelles richtete sich hauptsächlich nach der Stärke der Blasebälge. — Das Gestell zerfiel in das Untergestell, das Obergestell und die Rast. Die Bodenplatte bedurfte eines gewissen Grades der Abkühlung, um nicht wegzuschmelzen. Diese wurde erreicht durch eine entsprechende Luftkühlung unter derselben. Sie wurde befördert durch Zirkulation von kaltem Wasser in den Abzüchten, wobei die gebildeten Dämpfe durch Dunströhren abgeleitet werden mussten. Hatte man kein Wasser am Boden selbst, so leitete man solches aus dem Wassergraben, dem Gefluder, zu. Hatte man viel Grundwasser, so musste man die Abzüchte sehr hoch bauen und für starken Luftzug sorgen. Der mittlere hohle Raum unter dem Bodenstein wurde zunächst mit einer dicken Eisenplatte, der Grundplatte, bedeckt, zwischen der und der Oberfläche des Bodensteins ein Abstand von wenigstens 4 Zoll verbleiben musste. Man legte von dem Hohlraum unter dem Ofen eine Abzucht von 9 bis 12 Zoll Breite und 6 bis 8 Zoll Höhe nach der Ablassseite zu zur Einführung des Wassers und nach der Balgseite eine Abzucht von 12 Zoll im Quadrat zur Abführung des Wassers an. In beide wurden eiserne Dammröhren eingesetzt. Auf die eiserne Grundplatte goss man eine Schicht Mörtel aus Lehm und Sand und darüber weiter 2 Zoll Sand, worauf der Bodenstein gelegt wurde. Man gab auch in Schweden damals noch dem Gestell eine rechtwinklige Gestalt; Versuche, dasselbe nach hinten abzurunden, hatten keinen Erfolg gehabt.
Fig. 192 soll die Anordnung des Untergestelles, Herdes oder Eisenkastens zeigen. Nachdem der Bodenstein gelegt war, setzte man zuerst den Hinterknobben (Rückenstück, la rustine). Diesem gab man zuweilen eine kleine Drehung gegen das Gebläse, so dass die der Form gegenüberliegende Ecke etwas mehr als einen rechten Winkel betrug. Man nannte das im Winkel zustellen (ställa i vrå). Alsdann setzte man die Seitensteine (Form- und Windstück), und zwar den Formstein zuerst. Auf die kleinen Abweichungen bei der Zustellung, wie die Winkelstellung, der Abstand der Form vom Hinterknobben, legte man einen außerordentlichen Wert.
Die Tiefe des Gestelles unter der Form betrug 14 bis 18 Zoll, doch vergrößerte man dies Maß in Schweden zum Gießen großer Kanonen, wozu viel Roheisen, folglich ein sehr großes Gestell nebst großen und starken Bälgen erforderlich waren, bis zu 24 Zoll. Das Vordergestell war der Raum vom Wallstein bis unter den Tümpel. Der Tümpel war mit der wichtigste Teil der Zustellung. Er hatte auch am meisten durch die Hitze zu leiden. Man machte ihn aus einer Platte von Stein, Schmiedeeisen oder Gusseisen. Das letztere war das Gewöhnliche und machte man ihn alsdann 2 Zoll dick und 7 bis 8 Zoll breit. Ein Steintümpel war dann vorzuziehen, wenn das Gusseisen mit Kellen ausgeschöpft wurde, weil dann das Eisen zu rasch verbrannte. Man legte den Tümpel 2 Zoll über die Höhe des Formsteins. Über den Tümpel legte man das Tümpelblech, eine breite Platte, auf welcher die ganze Tümpelbrust aufgemauert wurde. Den Wallstein machte man so hoch, dass er mit der darauf liegenden Platte 2½ Zoll tiefer als die Form lag. Auf manchen Hütten ließ man die Schlacke über den Wallstein laufen, in anderen stach man sie durch ein besonderes Schlacken- oder Lachtloch, welches dem Stichloch gegenüber 4 Zoll unter dem Schlackenblech angebracht war, ab. Der Abstand des Walls von der Mittellinie des Ofens durfte nicht über 48 Zoll betragen. Die Form war entweder nur ein Loch in der Gestellwand, in dem die Formöffnung mit Ton hergestellt wurde, oder sie war von Eisen. Das Loch im Stein machte man 3 bis 3½ Zoll breit und 2½ bis 3 Zoll hoch an der Mündung, während es nach dem Balg zu 12 auf 9 Zoll hatte. Die Mündung der eisernen Form war auch rechtwinklig, 3 bis 3½ Zoll auf 2 bis 2½ Zoll. Der beste Gestellstein war ein Sandstein von Rosslagen, doch hielt er höchstens Kampagnen von einem Jahre aus. Gegossene Schlackenziegel wurden zu Dannemora und in Norbergs- und Lindes-Bergrevier auch für die Rast, Hinter- und Seitenmauern des Gestelles gebraucht.
Vordem spielte auch bei der Ofenzustellung der Aberglauben eine große Rolle, namentlich richteten sich die alten Meister in Schweden nach dem zu- und abnehmenden Mond, indem sie glaubten, dass keine Schmelzung glücklich ablaufen könne, wozu nicht das Gestell bei zunehmendem Mondlicht eingesetzt war.
Garney gibt genaue Maße für 14 verschiedene Zustellungen für mehr oder weniger leicht- und schwerschmelzige Erze, sowie für den Guss von Kanonen von 8- bis 24-Pfündern an. In dem, was Garney über den Betrieb der Hochöfen sagt, sind neue Gesichtspunkte nicht enthalten und haben seine ausführlichen Angaben hauptsächlich nur für schwedische Erze und Verhältnisse Interesse. Bemerkenswert sind seine Beschreibungen der besonderen Arbeiten beim Hochofen, dem Dämpfen, bei Versetzungen, wenn der Abstich zugeht, das Gestell sich ausbläst, Bühnen sich ansetzen, die Gichten hängen und stürzen, das Eisen vor der Form kocht u. s. w.
Man bediente sich damals noch allgemein der hölzernen Blasebälge, nur bei dem Hochofen von Nyhytte in Norbergs-Bergrevier war in den 80 er Jahren ein englisches Zylindergebläse aufgestellt worden, welches sich sehr gut bewährte.
Die Fabrikation der Schlackensteine war damals ein ganz einträgliches Nebengeschäft bei den schwedischen Hütten. Der Preis für das Hundert betrug 16 Schillinge, welche den Hochofenarbeitern zugute kamen. Die Schlacken wurden in eiserne Formen gegossen und gibt Garney eine genaue Beschreibung des ganzen Verfahrens.
In Deutschland wendete man ebenfalls dem Hochofenbau in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts größere Aufmerksamkeit zu und bildeten sich auch hier gewisse Regeln aus. In einigen Punkten wich die deutsche Bauart von der schwedischen ab. Die Abzüge für die Feuchtigkeit im Fundament, welche zugleich zur Kühlung des Bodensteins dienten, fehlten nie und meist legte man sie in Kreuzform in der Weise an, dass zwei Kanäle in den Diagonalen des Grundmauerwerks ausgespart wurden, welche sich unter dem Ofenmittel kreuzten, man nannte sie deshalb die Kreuzabzüge oder auch Andreaskreuz.
Sie wurden ganz mit Stein- oder Eisenplatten bedeckt und mündeten außerhalb des Fundamentes im Freien. Bei trockenem Terrain konnte man sie außerhalb des Ofenmauerwerks unter die Hüttensohle und hier in die Höhe führen, wo man sie leicht bedeckte.
Das äußere Ofenmauerwerk baute man entweder so auf, dass man den unteren Teil bis zur Höhe des Kohlensacks senkrecht aufführte, so dass es die Gestalt eines Würfels bekam, auf dem man dann den oberen Teil in Gestalt einer abgestutzten, vierseitigen Pyramide verjüngt zulaufen ließ, oder man führte den Ofen in mehreren Absätzen in Gestalt aufeinandergesetzter vierseitiger Prismen auf, wie bei dem Harzer Hochofen (Fig. 193). An den Absätzen pflegte man öfters von außen Schlingen von Holz oder von Eisen um den Ofen zu legen. Man verstärkte das Mauerwerk ferner durch eiserne Anker, die man parallel den Außenwänden in das Mauerwerk legte. Die Blas- und Arbeitsöffnungen waren meist gewölbt und hießen deshalb auch Blas- und Arbeitsgewölbe. Eine wichtige Eigentümlichkeit der deutschen Bauart bestand darin, dass man mindestens von der Höhe der Gewölbe an in den vier Ecken des Raumauerwerks Luftzüge anlegte, welche man untereinander durch schwach aufsteigende Röhren verband (Fig. 194, a. f. S.) und denen man von Zeit zu Zeit einen Ausgang in das Freie gab. Dieses System von Luftkanälen diente zur Austrocknung des Raumauerwerks. Die Verankerung begann erst in der halben Höhe der Gewölbe. Über diese legte man die Anker so, dass einer rechts und einer links an den Luftschächten vorbeiging, so dass acht Anker in einer Ebene lagen. Sie wurden außerhalb des Mauerwerks „versplettet“ oder mit Riegeln versehen.
Dazu nahm man oft lange Stäbe, welche die oberen und die unteren Anker zugleich verspletteten. Wo sie übereinander lagen, gab man ihnen einen Falz. Man mauerte sie nicht fest ein, sondern ließ ihnen etwas Spielraum, damit sie sich frei ausdehnen konnten und das Mauerwerk nicht auseinander trieben. Den Rauschacht machte man etwa 0,75 m dick. Oben ließ man zwischen Raugemäuer und Rauschacht einen freien Raum von einem Fuß, in welchen die aufsteigenden und die horizontalen Zugröhren von Backsteinen eingebaut wurden; der Zwischenraum wurde mit Sand, Pferdemist und Schlacken, der sogen. Füllung, ausgefüllt. Diese Füllung verbreiterte sich nach oben, weil das Raumauerwerk inwendig senkrecht aufstieg, der Rauschacht aber enger wurde. In den Gewölben ruhte der Rauschacht auf starken Trachteisen. Das Ofeninnere legte man durch Ziehen von Schnüren fest, nicht, wie in Schweden, durch eine Schablone. Da das Mauerwerk des Kernschachtes nach oben zu schwächer wurde, so bildete sich auch hier wieder zwischen Kern- und Rauschacht ein Hohlraum, der ebenfalls mit Steinen und Lehm ausgefüllt wurde. Der Kernschacht ruhte in den Gewölben auf Trachteisen, sonst auf dem senkrecht aufgeführten Kernschachtfutter. Machte man den Schacht rund, so brach man erst die Ecken und mauerte auf eingelegten eisernen Stäben die erste Schicht als ein Achteck auf, die zweite Schicht als ein Sechzehneck, bis man in der fünften Schicht etwa die runde Form erreicht hatte. Die untere Rundung war oval und ging erst gegen die Gicht zu in die Kreisform über. Auch der Raum zwischen Kreuzkanal und Bodenstein wurde mit größerer Sorgfalt, namentlich in Bezug auf die Abführung der Feuchtigkeit, ausgefüllt als in Schweden. Man brachte erst an dem unteren Teil des Kernschachtfutters ringsum Röhren von Backsteinen an, welche mit Öffnungen versehen waren, um die Feuchtigkeit aufzunehmen, die sie zu einer senkrechten Röhre, meist von Blech, leiteten, durch welche sie nach außen abgeführt wurde. Zwischen diese Röhren wurde dann eine doppelte Backsteinplättung gelegt, auf welche eine eiserne Platte folgte. Dieses nannte man den unteren verlorenen Boden. Hierauf folgte eine zweite doppelte Plättung, wobei man zwischen den Backsteinen offene Fugen ließ, zur Abführung der Dämpfe, und bedeckte diese wieder mit einer schließenden eisernen Platte. Dies war der obere verlorene Boden. Auf diesen wurde 1 Fuß Lehm aufgestampft und dann der Bodenstein gelegt.
In dem Eisenmagazin von Tölle und Gärtner findet sich ein ausführlicher, wichtiger Aufsatz „von der ganz alten Art bis zu der jetzt gewöhnlichen Schmelzfeuer zum Eisensteinschmelzen, der Hochöfen“, in welchen die Entwicklung des Hochofenbaues, namentlich am Harz, geschildert wird. Daraus erfahren wir, dass die alten Harzer Öfen an dem Fehler zu enger Gestelle gelitten hatten. Die alten Öfen hatten Gestelle, welche nur 5 Kubikfuß Raum umschlossen, so dass nur etwa 3 Kubikfuß Kohle der unmittelbaren Einwirkung des Gebläses ausgesetzt waren. Das Gestell ging sehr unvermittelt in den Schacht über, indem die Rast sehr niedrig und flach war, während der Schacht im Verhältnis zum Schmelzraum zu geräumig war. Dadurch mussten sich auch die Gase rasch abkühlen und so kam es, dass sich leichte Ansätze oder Bühnen über dem Gestell bildeten oder sich gar die ganze Beschickung festhing. Hans Sien hatte schon im 16. Jahrhundert die Öfen dadurch zu verbessern gesucht, dass er sie beträchtlich erhöhte, von 16 auf 24 Fuß (6,84 m); da er aber das enge Gestell beibehielt, war nicht viel damit erreicht. Im Jahre 1706 baute man in Tanne einen Ofen nach abgeänderten Massen, der lange als Muster galt. Man machte das Ofenfutter stärker, indem man ihm 7 Fuß (2 m) Seitenlänge gab. Der Ofen war 25 Fuß (6,20 m) hoch, die Gicht 2 Fuß 9 Zoll (0,855 m) weit, dem entsprechend erweiterte man auch das Gestell etwas. Diese Art der Zustellung blieb mit geringen Abweichungen längere Zeit maßgebend. In dem Aufsatz sind die genauen Maße für einen solchen Ofen mitgeteilt, woraus wir folgende Hauptmasse entnehmen:
Höhe vom Bodenstein bis zur Gicht 21 Fuß — Zoll (5,987 m)
Höhe des Gestelles 3 „ 4 „ (0,95 m)
Weite des Gestelles oben 1 „ 6 „ (0,428 m)
Weite des Gestelles unten 1 „ 1 „ (0,31 m)
Länge des Gestelles 4 „ 6 „ (1,283 m)
Die Rast hatte „8 Zoll Fall“, d. h. sie war nur 8 Zoll hoch und ging in dieser geringen Höhe in den Schacht über. Die Form lag 1 Fuß über dem Bodenstein, war 2¼ Zoll breit und 2 Zoll hoch und hatte 2 Zoll Steigen. Fig. 195 a u. b stellen die senkrechten Schnitte durch ein Harzgestell mit der charakteristischen flachen Rast dar.
Bald danach erfreuten sich die „Schwabenöfen“ eines besonderen Rufes. Deshalb schickte die Fürstlich Walkenriedsche Hüttenadministration im Jahre 1725 einen gewissen Michel Teichmann nach dem Württembergischen, um Erkundigungen über deren Betrieb einzuziehen. Teichmann und namentlich aber einige im Jahre 1729 aus Schwaben berufene Hüttenverständige führten verschiedene Verbesserungen am Harz ein. „Die Hochöfen erbauten sie auf einem festen und sicheren Grund, richteten auf diesem doppelte Abzüchte vor, führten hierauf ein überaus großes und starkes Raugemäuer beinahe ins Gevierte und lotrecht in die Höhe, welches sie vielfältig mit mächtigen Ankern und Bolzen so versahen, dass man hätte glauben können, ein solches Werk würde selbst der Zeit trotzen können; aber sie gaben dem Raugemäuer zu wenig Röhren, sie sprangen und von diesen Öfen ist seit 60 Jahren der einzige Rübeländer hohe Ofen ein Muster der schwäbischen Bauart geblieben.“ Die Maße dieser Öfen waren:
Höhe vom Boden bis zur Gicht 25 Fuß — Zoll (7,125 m)
Höhe des Gestelles 5 „ 4 „ (1,521 m)
Weite des Gestelles oben 1 „ 9 „ (0,501 m)
Weite des Gestelles unten 1 „ 5 „ (0,405 m)
Länge des Gestelles 5„ — „ (1,425 m)
Die Rast hatte auch hier nur 8 Zoll (0,192 m) Fall oder Höhe.
Die schwäbische Zustellung war dadurch charakteristisch, dass man das Gestell aus vielen, aber kleineren Steinen wie sonst zusammenfügte: so bestand der Hinterknobben, der sonst aus einem Stein hergestellt wurde, aus fünf Steinen. Ferner war der Wallstein niedriger, um bei dem Betriebe die Schlacke fortwährend ablaufen zu lassen.
Von den Schwabengestellen unterschied man die Harzgestelle, welche etwas andere Größenverhältnisse aufwiesen. Sie hatten zwei Bodensteine, einen stärkeren Tümpel, der aus zwei Steinen gebildet war; die Form hatte eine halbrunde Öffnung, der Wallstein war etwas höher.
Gärtner gibt folgende Maße für ein Schwabengestell und ein Harzgestell, welche gleiche Schachte haben:
Die Abweichungen sind demnach keine große. Sie sind geringer als die der Zustellungen, welche Tiemann für verschiedene Erzarten angegeben hat.
A für kieselhaltige Beschickung, B für tonhaltige Beschickung, C für kalkhaltige Beschickung, D für magnetischen Eisenstein (in Schweden?), E für strengflüssige Beschickungen überhaupt, F für leichtflüssige Beschickungen überhaupt. Alle Schächte waren rund, außer für B, indem man bei tonhaltiger Beschickung noch an der viereckigen Zustellung festhielt. Die Ofenhöhe war bei allen 26 bis 30 Fuß.
Man hielt trotz aller Theorie noch fest an dem Hergebrachten und wich nur wenig von den überlieferten Normen ab.
Der Tümpel lag in der Regel 16 Zoll (0,381 m) über dem Bodenstein. Die Form war von Kupfer. Auf dem Wallstein ruhte das Ende eines etwa 5½ Fuß (1,567 m) langen gegossenen Eisens, welches auf der Hüttensohle befestigt wurde, so dass es geneigt lag. Es diente für den Schlackenabfluss und hieß die Jungfrau. Neben der Jungfrau lag in gleicher Neigung das Schlackenblech, worüber die Schlacke aus dem Gestelle abfloss oder von den Arbeitern heruntergezogen wurde. Die Jungfrau war nur bei den Schwabenöfen gebräuchlich, bei den übrigen Hochöfen hatte man nur das Schlackenblech. Die Neigung der Form wurde nach Graden durch die Formwaage bestimmt. Besonders charakteristisch für die Ofenzustellung am Harz war die sehr flache Rast. Mit welch eigentümlichen Gründen man die hergebrachte flache Rast verteidigte, lesen wir bei Tiemann (§. 230). Nach ihm soll die Rast bloß zur Unterstützung der Beschickungssäule dienen, die Gichten sollten sich darauf ausbreiten und die musig gewordene Masse von hier aus nun dem strengsten Feuergrade langsam näher treten. — „Es kommt sehr auf die Lage der Rast an, die man ihr gibt, ob man sie viel oder wenig steigen lässt, d. h. ob man sie hoch, niedrig oder horizontal macht. Zuviel Steigen der Rast ist ihr mehr schädlich als nützlich, indem dadurch erstlich die Gattierungsmasse zu schnell und mithin zu roh in das Gestell kommen würde, und zweitens, indem dadurch das vorhandene Verhältnis der Form und Gestellhöhe, worauf viel ankommt, aufgehoben wird. Eine niedrige Rast wird viel andauernder als eine hohe sein, indem die auf ihr liegenden Kohlen bald mit einer Schlackenhaut überzogen werden und diese alsdann gegen das zu frühe Wegschmelzen derselben schützt. Bei einer horizontalen Rast würde vorzüglich der Vorteil sein, dass die Gestellhöhe immer dieselbe bleiben und also das vorhin erwähnte Verhältnis nie aufgehoben würde.“ Tiemann hält also danach eine ganz horizontale Rast für am besten. Tiemann war selbst ein Harzer und ganz in den Harzer Vorurteilen befangen. Es ist von selbst einleuchtend, wie fehlerhaft und schädlich ein so plötzlicher Übergang aus dem engen Gestell in den weiten Schacht und die dadurch bedingte rasche Abkühlung der Feuergase sein muss. Nur wenige aber wagten es, sich von dem überlieferten Vorurteil freizumachen. Ein solcher war gegen Ende des Jahrhunderts der sächsische Kabinettsminister Graf Detlev von Einsiedel, der auf seinem berühmten Hüttenwerke Lauchhammer bei Mückenberg die wichtigsten Neuerungen und Verbesserungen vornahm. Im Jahre 1791 ließ er einen neuen Hochofen nach ganz neuen Maßverhältnissen erbauen, dessen Inneres er statt aus Steinen aus Masse aufführte. Massengestelle hatte man bis dahin in Deutschland noch nicht angewendet. Der Hüttenverwalter Lohrisch hatte es 1790 zuerst unternommen, ein Gestell aus Masse auszuführen, wobei er sich eines ganz eigentümlichen Verfahrens bediente. Er stampfte nämlich die Masse nicht zwischen Holzschablonen ein, sondern in eiserne Kasten, die er dann wie Steine benutzte und daraus das Gestell aufbaute. Die Blechkasten ließ er darin. Der gute Erfolg, den man mit diesem Gestelle erzielte, veranlasste den Grafen, auch Rast und Schacht des neuen Ofens aus Masse herstellen zu lassen; nur der oberste Teil des Schachtes wurde aus Steinen gemauert. Gestell und Rast machte man rund. Der Ofen selbst, der in Fig. 196 (a. f. S.) in der Ansicht und Fig. 197 (a. f. S.) im senkrechten Durchschnitt dargestellt ist, erhielt folgende Dimensionen: Ganze Höhe des Ofens 32 Fuß (9,06 m), Schachthöhe 22 Fuß 10 Zoll (6,21 m), Durchmesser der Gicht 4 Fuß (1,132 m), der Rast 8 Fuß 4 Zoll (2,357 m), Rastneigung 50 Grad, senkrechte Höhe der Rast 4 Fuß 4 Zoll (1,225 m), Höhe des Gestelles 4 Fuß (1,132 m), Durchmesser des Gestelles 1 Fuß 4 Zoll (0,377 m) vor der Form. Das Raugemäuer bestand aus einem starken Sockel, auf den der Rauschacht, mit eisernen Reifen und Stäben gebunden, kegelförmig aufgesetzt war. Der Gichtmantel war als Esse in die Höhe geführt. Diese Konstruktion stellt einen großen Fortschritt dar und entspricht bereits ganz der Ofenzustellung des 19. Jahrhunderts.
In Sibirien, wo bei den vortrefflichsten Erzen noch ein unbegrenzter Holzreichtum zur Verfügung stand, hatte man die Holzkohlenöfen von Anfang an geräumig gebaut und sie im Laufe des Jahrhunderts immer mehr vergrößert. So entstanden in Russland die größten Holzkohlenöfen des Kontinents, auf deren nähere Beschreibung wir später noch zurückkommen werden.
Auch die sibirischen Öfen hatten eine ziemlich flache Rast, doch wurde die Steilheit der Rastwände dadurch größer, dass die Gestelle vom Boden bis zur Rast sich erweiterten. Steile Rasten wurden bei den Hochöfen mit offener Brust zuerst in England bei den Kokshochöfen gebräuchlich.
Dagegen hatte man bei den Floßöfen in Steiermark und Kärnten meist gar keine getrennte Rasten, oder, wie bei den Öfen zu Turrach und zu Treybach, sehr steile.
Wie verschieden die Produktion der Hochöfen war, zeigt folgende Zusammenstellung des wöchentlichen Ausbringens:
Johann-Georgenstadt, Sachsen 103 Ztr.
Heinrichsgrün, Böhmen 125 bis 130 „
Königshütte, Harz 185 „
Königsbronn, Württemberg 305 „
Söderfors in Roslagen 348 bis 360 „
Torgelow, Pommern 405 „
Siegen 462 bis 484 „
Russland, Sibirien 666 „
Die späteren großen Öfen in Russland von 35 bis 42 Fuß Höhe schmolzen sogar 1200, 1300 bis 1700 Ztr. die Woche.
Wie vorteilhaft sich der Betrieb der großen sibirischen Öfen hinsichtlich des Kohlenverbrauchs stellte, geht aus folgender Zusammenstellung Hermanns hervor:
Nischnetagilsk 1 1/15 Kohle auf 1 Eisen
Polowskoi 1 5/96 „ „ „
Kaslinsk 1 12/25 „ „ „
Newiansk 1⅔ „ „ „
Siegen 1⅗ „ „ „
Steiermark (Eisenerz u. Vordernberg) 2 4/7 bis 2¾ „ „ „
Turrach 4 1/12 „ „ „
Tschuber 4⅙ „ „ „
Kammenegoriza (Krain) 4 1/13 „ „ „
Alivard 2 44/100 „ „ „
Articol 2 88/100 „ „ „
In Frankreich bediente man sich noch um 1775 ziemlich allgemein der niedrigen Öfen von 17 bis 18 Fuß Höhe, welche sogar theoretisch von Bouchu als die besten für die Erze von Burgund und der Champagne verteidigt worden waren. Grignon suchte eine Reform herbeizuführen, indem er Öfen von 24 Fuß (7,80 m) Höhe mit elliptischem Querschnitt, bei welchem Gicht und Rast ineinander übergingen, vorschlug. Er eiferte besonders gegen das in Frankreich allgemein übliche Einziehen der Formseite bis in die Mittellinie des Ofens, indem er mit Recht darauf hinwies, dass nicht die Form, sondern der Focus der Verbrennung in der Mitte des Gestelles liegen müsse, was viel richtiger erreicht würde, wenn die Mittellinie des Gestelles mit der Mittellinie des Schachtes zusammenfiele. Auch das starke Wegschmelzen der Windseite, welches man bei den ausgeblasenen Hochöfen beobachten könnte, bewiesen dies.
Mehr als Grignons theoretische Erörterungen wirkte aber das Beispiel der Engländer. Man fing an, deren Fortschritte zu beachten. Es entstand sogar ein großes, ganz nach englischem Muster eingerichtetes Werk bei Creuzot, welches Ende der 70 er Jahre unter der Leitung eines Engländers Wilkinson erbaut wurde.
In England hatte man die Holzkohlenöfen, nach Einführung der stärkeren Gebläse, vergrößert, in der Hoffnung, dadurch mit den Koksöfen konkurrieren zu können. Im allgemeinen überschritt man aber bei den Holzkohlenhochöfen eine Höhe von 30 Fuß (9 m) nicht.
Das größte Interesse bietet aber die Entwicklung der englischen Kokshochöfen dar, deren Zahl in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts rasch zunahm. Coalbrookdale war die klassische Heimat des Kokshochofenbetriebes. Von da aus verbreitete sich derselbe von der Mitte des Jahrhunderts an mit zunehmender Geschwindigkeit. Um das Jahr 1740 war Englands Roheisenproduktion auf den tiefsten Punkt gesunken. Von ungefähr 300 Hochöfen waren nur 59 in Betrieb, die 17350 Tons produzierten. 1750 betrug die Produktion auch nicht mehr als 22000 Tons und scheint Coalbrookdale immer noch die einzige Kokshochofenhütte gewesen zu sein. 1760 wurde die Eisenhütte zu Carron mit Koksbetrieb errichtet; die Produktion Englands betrug damals 27000 Tons, 1770 32000 Tons und 1780 40000 Tons, dagegen betrug die Einfuhr von Schweden und Russland 1781 50000 Tons. Von da an stieg die Eisenproduktion Englands gewaltig, besonders seit Einführung des Flammofenfrischens im Jahre 1785. 1788 betrug die englische Produktion schon 68300 Tons. In diesem Jahre gab es in England nur noch 24, in Schottland nur noch 2 Holzkohlenöfen, dagegen in England 53 und in Schottland 6 Kokshochöfen. Die Holzkohlenöfen produzierten 14500 Tons, die Koksöfen 53800 Tons. 1790 betrug die Produktion von Großbritannien bereits 80000 Tons und 1796 125079 Tons. Um diese Zeit waren die Holzkohlenhochöfen schon fast ausgestorben. Am Schluss des Jahrhunderts, im Jahre 1800, bezifferte sich die Produktion auf 156000 Tons, sie war also in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts um mehr als das Siebenfache gestiegen.
Man baute die Kokshochöfen ursprünglich nicht höher wie auch die Holzkohlenöfen. Die Öfen zu Carron waren nach Jars’ Bericht 1765 nur 30 Fuß hoch und 8 Fuß weit. Man hatte aber bald herausgefunden, dass die Kokshochöfen umso besser gingen, je stärkere Gebläse man anwendete. Die Holzbälge, welche noch allgemein im Gebrauch waren, nahmen riesige Dimensionen an und gaben doch nur ungenügenden Wind. 1768 baute Smeaton im Auftrage von Dr. Roebuck ein neues, sehr gutes Gebläse, welches durch ein Wasserrad getrieben wurde. Vielleicht war dieses das erste Zylindergebläse. Um diese Zeit wendete man auch bereits Feuermaschinen auf den Eisenhütten an, aber sie bewegten die Bälge nicht direkt, sondern sie pumpten nur Wasser auf ein Wasserrad, welches durch die Kammen an seiner Welle die Bälge niederdrückte. Obgleich gewöhnlich das Jahr 1775 als das Jahr der Erfindung des englischen Zylindergebläses angegeben wird, so sprechen viele Gründe für eine frühere Verwendung desselben, und dass es zuerst in Carron mit Erfolg benutzt wurde, beweist auch der Umstand, dass man den Hochofenbetrieb mit Zylindergebläsen als Carronsche Schmelzmethode bezeichnete. Seine Erfindung fiele danach in dieselbe Zeit wie die der Dampfmaschine von Watt. Die englischen Hüttenwerke nahmen nach deren Einführung bald gewaltige Dimensionen an.
1784 waren (nach Smiles) um Coalbrookdale 8 Hochöfen, 16 Feuermaschinen, d. h. Dampfmaschinen, 9 Hämmer, ohne die Flammöfen, Walzwerke und die Gießerei. Nach einer anderen Angabe (in Köhlers Bergmännischem Journal) hatte Herr Reynolds zu Coalbrookdale 5 Hochöfen, davon machte einer zu Ketley 120 Tons wöchentlich; ferner 24 Feuermaschinen, die die Bälge und Hämmer in Bewegung setzten und wöchentlich 720 Tons Steinkohlen brauchten. Zum Schmieden von 5400 Zentner wöchentlich wurden 1200 Tons gebraucht und für die Gießerei 460 Tons.
Die Hütte zu Carron umfasste um 1792 5 Hochöfen, 16 Flammöfen, eine Tonmühle, welche nur für den eigenen Gebrauch arbeitete, eine Pumpmaschine, die bei jedem Hub 4½ Tons Wasser hob und durchschnittlich 7 Hübe in der Minute machte. Diese Maschine ging in Zeiten der Trockenheit und verbrauchte 16 Tons Steinkohlen in 24 Stunden. Außerdem wurden auf dem Werke und von den Arbeitern täglich 120 Tons Kohlen verbrannt. Außer den Flammöfen hatte man drei Kupolöfen mit künstlicher Windzuführung. Die Maschinenwerkstätten waren sehr ausgedehnt.
In dem Zeitraum 1770 bis 1792 entstanden zwei weitere große Hochofenwerke in Schottland. Von diesen war die Devon-Hütte (the Devon ironworks) besonders bemerkenswert durch ihre eigentümliche Anlage. Der Hochofen war dort in den Felsen eingebaut. Das natürliche Gestein bildete das Raugemäuer und das Gestell war durch in den Felsen gehauene Gewölbe zugänglich. Es standen zwei Hochöfen nebeneinander, welche 40 Fuß (12 m) hoch waren und 14 Fuß (4,20 m) Durchmesser hatten. Auch das Dach der Gießhalle, welche 70 Fuß (21 m) lang und 50 Fuß (16 m) breit war, hatte seine Auflagerung auf den Wänden des Steinbruchs. Ebenso war das Maschinenhaus gebaut, und die Maschine, welche die beiden Öfen mit Wind versehen sollte, drückte mittels eines großen Zylinders mit jedem Hub die Luft in ein langes, in den Felsen eingehauenes Gewölbe, das als Regulator diente. Diese große Windkammer fasste über 10000 Kubikfuß Wind, war sorgfältig luftdicht verschlossen und hatte nur zwei Öffnungen, eine für den Eintritt, die andere für den Austritt des Windes. Das Werk war in Betrieb bis in die Mitte der 50 er Jahre in diesem Jahrhundert und machte sehr gutes Eisen.
Das Eisenwerk von Crammond war ursprünglich eine Zementstahlfabrik, welche ihr Eisen hauptsächlich von Russland und Schweden bezog, und zwar über 1000 Tonnen jährlich. Der große Preisaufschlag des russischen Eisens in den 80 er Jahren veranlasste die Besitzer, Hochöfen am Clyde, nahe bei Glasgow, zu erbauen, in der Hoffnung, ein passendes Eisen für ihre Fabrikation selbst herstellen zu können. In der Zeit von 1788 bis 1796 wurden weitere Hochöfen in Schottland erbaut zu Glenbuck, Muirkirk, Wilsontown oder Cleugh, Calder, Clyde und Omoa in Lanarkshire, so dass 1796 bereits 17 Kokshochöfen in Schottland in Betrieb standen, welche 18000 Tonnen Eisen im Jahre machten. Die berühmte Clyde-Hütte (Clyde Ironworks) wurde 1786 begonnen; 1792 waren zwei Hochöfen daselbst im Betrieb, 1798/99 erbaute man den dritten; alles Eisen wurde damals zu Kanonen und Munition vergossen.
Welchen Aufschwung die Eisenwerke in Südwales seit Einführung des Puddelprozesses nach 1785 nahmen, haben wir schon erwähnt. Ein gewisser Bacon hatte dort 1765 zuerst bei Merthyr Tydwil eine Eisenhütte erbaut und gute Geschäfte gemacht. Als er 1782 sich zurückzog, teilte er seinen Gruben- und Hüttenbesitz in vier Distrikte, die er einzeln verpachtete, Dowlais, Pennydarran, Cyfartha und Plymouth Works, nördlich, östlich, westlich und südlich von Merthyr Tydwil. Die Werke nahmen alsbald einen großartigen Aufschwung, namentlich Cyfartha, welches in die Hände des rührigen, geschäftsgewandten Richard Crawshay kam. Man schmolz in Südwales mit roher Steinkohle, welche den Charakter einer Anthrazitkohle hatte, sich nicht verkohlen ließ, im Hochofen aber nicht backte. Da man aber noch kein anderes Mittel kannte, das Roheisen in Schmiedeeisen umzuwandeln, als mit der teuren Holzkohle, so waren Produktion und Bedarf klein und betrug die Wochenerzeugung von Schmiedeeisen von recht geringer Güte bis in das Jahr 1787 nur 10 Tonnen. Nach Einführung von Corts Puddelprozess erhöhte sich die Produktion der Eisenwerke von Südwales rasch und sie erfuhr eine noch größere Steigerung durch den Bau des Kanals, welchen Crawshay mit Homfray von Pennydarran nach dem nächsten Seehafen führten und der 1795 eröffnet wurde. 1706 waren nach der offiziellen Statistik 24 Kokshochöfen in Südwales im Betrieb, und das Eisenwerk zu Cyfartha hatte bei weitem die größte Produktion in ganz Großbritannien.
Die Anwendung der Dampfmaschine als Motor für Hochofengebläse ist das Verdienst von John Wilkinson, der dies zuerst auf der Hütte von Bersham ausführte.
Die Eisenindustrie von Staffordshire war vor der Einführung des Koksbetriebes höchst unbedeutend gewesen. Jars beschreibt die Steinkohlengruben von Staffordshire, erwähnt aber keine Silbe von einer Eisenhütte. Nach einer Schilderung aus dem Jahre 1780 war die ganze Gegend um Wednesbury herum damals noch eine mit Wald und Haide bedeckte Öde. Nach der Statistik von 1796 waren in diesem Jahre bereits 14 Kokshochöfen in Staffordshire im Betrieb.
Auch in England hielt man lange Zeit an der alten Überlieferung fest, dass jeder Hochofen mit nur einer Form blies. Es scheint aber, dass man Ende der 80 er Jahre anfing, Öfen mit mehreren Formen zu erbauen. Es fehlen hierüber, wie über so manches andere aus jener wichtigen Zeit, nähere Angaben; es lässt sich dies aber aus einem Aufsatz in Tölle und Gärtners Eisenmagazin von 1791 schließen. Sicher ist, dass man Ausgangs des Jahrhunderts mehrformige Öfen in England hatte. Svedenstjerna sah 1802 auf dem Eisenwerk Leven in Schottland einen Hochofen mit drei Formen; zwei davon lagen auf einer Seite und die dritte auf der gegenüber stehenden Seite so, dass ihr Windstrom gerade in die Mitte der beiden ersten Windströme traf. Der Ofen hatte 38 Fuß Höhe und lieferte wöchentlich über 30 Tonnen Roheisen.
Die englischen Hochöfen schwankten sehr in ihrer Höhe, nach John Wilkinsons Angabe zwischen 30 und 70 Fuß (9 bis 21 m). Svedenstjerna sah 1802/3 in Südwales bei Neath einen Hochofen von 62 Fuß (18,60 m) Höhe, der aber trotzdem nur 15 bis 16 Tonnen Roheisen in einer Woche produzierte.
Bonnard macht folgende nähere Angaben über die Hochöfen bei Merthyr Tydwil in Glamorganshire und Coalbrookdale in Shropshire und in Staffordshire. Die Hochöfen waren am Schluss des 18. Jahrhunderts von 40 bis 60 Fuß (12 bis 18 m) Höhe, in Glamorgan sogar 65 Fuß (19,50 m). Der größte Durchmesser des Schachtes war gewöhnlich 12 Fuß (3,60 m) bei den Öfen von 45 Fuß (13,50 m) und 14 Fuß (4,20 m) bei jenen von 60 Fuß (18 m) Höhe und befand sich meistens ungefähr im Drittel der ganzen Höhe bei dem Zusammenstoßen des Schachtes mit der Rast. Das Gestell war bald ein gleichseitiges, bald ein längliches Viereck und hatte bis zum Anfang der Rast 6 bis 7 Fuß (1,80 bis 2,10 m) Höhe. Gestell und Rast machte man zuweilen aus gutem Sandstein, in der Regel wurde aber der ganze innere Ofen aus gebrannten Ziegeln erbaut, wobei er acht bis elf Jahre aushalten konnte. Hinter dem Kernschacht befand sich oft eine zweite Ziegelwand (Rauschacht), dazwischen ein freier Raum von etwa 3 Zoll (0,075 m) Breite, der mit einem Gemenge von Kohlenstaub und Ton ausgeschlagen wurde. In Bergländern wie Glamorgan und Shropshire waren oft mehrere Hochöfen aneinander gereiht und an Felswände gelehnt, deren Höhe ungefähr mit der Gicht gleich war. Die Öfen hatten die Gestalt abgestumpfter Pyramiden, wobei die Seiten der Grundfläche mehr als ein Drittel der Höhe betrugen. In Staffordshire standen die Öfen isoliert in der Ebene, waren nicht so dick und hatten einen Überbau oder Schornstein von 6 bis 10 Fuß (1,80 bis 3 m) über der Gicht.
Die Gebläse bestanden aus gegossenen eisernen Zylindern von 6 bis 9 Fuß (1,80 bis 2,70 m) Durchmesser und Höhe mit Regulatoren. Windmesser mit Quecksilber gefüllt zeigten den Druck an. Die Gebläse wurden von Dampfmaschinen oder großen Wasserrädern bewegt. Ein Zylindergebläse von 42 Zoll (1,05 m) Durchmesser und 13 bis 14 Hub in der Minute, das zwei Hochöfen und drei Frischfeuer versah, kostete 2500 £, nämlich 1500 £ für die Dampfmaschine und 1000 £ für das Gebläse.
Beim Anheizen bekleidete man die Wände zum Schutz mit aufrechtstehenden Ziegeln. Das Anheizen dauerte ½ bis 1 Monat.
Die Zahl der Sätze, die Beschickung, das tägliche Ausbringen waren nach der Güte des Koks, der Art der Eisensteine und den sonstigen Eigentümlichkeiten auf den verschiedenen Hütten ungleich. In Glamorgan setzte man bei den 50 bis 65 Fuß hohen Öfen und bei etwas aufsteigender Form 80- bis 90mal in 24 Stunden jedes Mal ungefähr 4 Ztr. Koks, ebenso viel Eisenstein und 1 Ztr. Fluss; man stach zweimal ab und erhielt jedes Mal 3 bis 3½ Tonnen Roheisen, somit auf einen Ofen wöchentlich 42 bis 49 Tonnen oder 2000 bis 2500 Tonnen im Jahre. In Shropshire und Staffordshire, wo die Steinkohlen von geringerer Güte und die Öfen niedriger waren, setzte man weniger Gichten und bei jeder mehr Koks als Eisenstein, z. B. 3½ Ztr. Koks, 3 Ztr. Eisenstein und 1 Ztr. Fluss. Man brachte täglich 5 bis 6½, wöchentlich 35 bis 45, jährlich 1800 bis 2200 Tonnen aus. Das Roheisen war in Glamorgan bei hoher Produktion weiß, sonst war es grau. In Coalbrookdale erzeugte man fast nur graues Gießereieisen.
Die größten Erfolge erzielten die Engländer durch ihre guten Zylindergebläse. Mushet berichtet 1798: alle englischen Hochöfen, mit Ausnahme einiger weniger Holzkohlenhochöfen, sind mit Zylindergebläsen versehen.
Die großartigen Fortschritte des Hochofenwesens in England übte ihre Rückwirkung auf den Kontinent. Man stellte Vergleichungen an und fand, dass man gegen England sehr zurückgeblieben war. Dies kam besonders in Deutschland zum Ausdruck.
In Crells Annalen wurde 1790 ein vorzüglicher Aufsatz veröffentlicht: „Über einige Hauptmängel verschiedener Eisenhütten in Deutschland“, worin der anonyme Verfasser (Graf August Ferdinand v. Veltheim, früher Oberberghauptmann zu Clausthal), der mit den englischen Verhältnissen wohl vertraut war, einen Vergleich zwischen englischem und deutschem Hüttenwesen zieht, welcher sehr zum Nachteil Deutschlands ausfällt. Deshalb macht der Verfasser eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen für unsere Industrie, welche am besten über den Stand derselben aufklären. Wir lassen die wichtigsten derselben hier folgen.
„1. Die deutschen Hochöfen sind noch viel zu niedrig und sollten 34 bis 36 Fuß (10 bis 11 m) hoch sein. Diese Höhe haben jetzt die mit Holzkohlen in England und Schottland betriebenen Hochöfen, deren gewiss über 20 sind.
2. Die Rast ist oberhalb viel zu flach und müsste weit abschüssiger gebildet sein, damit der Satz oder die Gichten in den abschüssigen Trichter beständig und gleichförmiger fortrücken, auch nirgends einen Aufenthalt finden können.
3. Das Gestell müsste aus gleicher Ursache oberhalb verhältnismäßig noch um etwas weniges weiter und mehr trichterförmig sein. Dieses wird jetzt auch in Schweden mit viel Vorteil befolgt.
4. Der Schacht kann bleiben, dagegen muss das Gestell im Verhältnis weiter gemacht werden, als dies in Deutschland üblich ist. Nicht nur in Schweden, sondern besonders in England befolgt man dieses auf allen gut eingerichteten Hütten.
5. Das Gebläse ist viel zu schwach und müsste sowohl bei der vorhin bemerkten Erweiterung des Gestelles, als auch außerdem schon um ein Beträchtliches verstärkt werden. Wo hinreichende und beträchtliche Wasserfälle sind, verschaffen die englischen Zylindergebläse hierin einen ganz außerordentlichen Vorteil.
6. Aus diesen und noch mehreren Gründen wäre ein Hochofen am besten mit zwei oder mit vier Formen, wobei dann das Gestell eine ovale Gestalt erhielte, zu versehen. Hierfür müsste man einen Windregulator und Windleitungen anlegen.“
Die übrigen Vorschläge des Verfassers sind teils ökonomischer Natur, teils sind sie selbstverständlich, nur ist noch das eine zu bemerken, dass er das hergebrachte Aufgeben nach Maß in Körben, Kistchen, Trögen u. s. w. auf das Entschiedenste verwirft und verlangt, dass die Beschickung und das Brennmaterial gewogen wird. Er verwirft ferner das häufige Abstechen, alle sechs bis acht Stunden, und will in 24 Stunden nur zweimal abgestochen haben.
Die Folge aller der vielen Mängel sei, dass man in Deutschland gewöhnlich nur 160 bis 200 Zentner in der Woche produziere, während doch 400 bis 500 Zentner fallen müssten. Letzteres erfolge jetzt regelmäßig in England, und zwar nicht etwa bei Kokshochöfen, die wöchentlich 700 Zentner erzeugten, sondern bei Holzkohlenhochöfen.
Diese Vorschläge bildeten das Programm, nach welchem sich die Fortschritte bei den Hochöfen in Deutschland in den folgenden Jahrzehnten, freilich nur langsam, vollzogen.
Mit viel größerer Energie hatte man die Reform des Hüttenwesens in Russland angefasst. Dort standen den reichen Besitzern der großartig angelegten sibirischen Werke fast unbeschränkte Mittel zur Verfügung und da sie weder durch staatliche Bevormundung noch durch die Fesseln der Überlieferung und Gewohnheit eingeengt waren, bauten sie ihre Hochöfen zum Teil mit Hilfe englischer Ingenieure nach den neuesten Grundsätzen und Erfahrungen um. Dieses geschah in so großartiger und zugleich so zweckmäßiger Weise, dass die sibirischen Hochöfen die größten und besten Holzkohlenöfen wurden, die bis dahin gebaut worden waren, und alle, auch die englischen, an Produktion weit übertrafen. Sie wurden mit starken Zylindergebläsen mit Wasserbetrieb ausgestattet und die sibirischen Hüttenanlagen, mit denen namentlich der russische Hofrat Hermann die deutschen Hüttenleute durch Schriften und Zeichnungen bekannt machte, wurden mustergültig. Die sibirischen Hochöfen hatten 35 bis 45 Fuß (10,50 bis 12,96 m) Höhe, 12 bis 13 Fuß (3,6 bis 3,9 m) Durchmesser im Kohlensack, waren mit sechs Zylindergebläsen versehen und produzierten 2000 bis 3000 Zentner die Woche, welche Leistung selbst von den größten englischen Koksöfen damals nicht erreicht wurde. Dieser Erfolg war hauptsächlich durch die zweckmäßige Verwendung der englischen Zylindergebläse erreicht, deren Überlegenheit seitdem auch unbedingt anerkannt wurde. Einen der größten Hochöfen hatte die Eisenhütte in Newjansk (Fig. 198), derselbe war 18 Arschin, 10 Werschock oder 43 engl. Fuß (= 13,20 m) hoch. Die Weite im Kohlensack betrug 5 Arschin (3,55 m). Umstehende Skizze zeigt das Profil des Hochofens und die Anordnung des Gebläses, welches aus vier Zylindern von Gusseisen, 1,42 m hoch und ebenso weit, bestand. Das Wasserrad war 3,20 m hoch und 2,13 m breit. Eigentümlich war die gabelförmige Düse von Gusseisen, deren Windströme parallel einströmten und welche angeblich die Ofenwände weniger angreifen sollte als eine weitere Düse. Die Zustellung war die althergebrachte, die Formseite befand sich zur Rechten der Abstichseite.
Von geschichtlicher Bedeutung ist ferner die Einführung des Kokshochofenbetriebes in Preußen. Dieselbe erfolgte durch die Staatsregierung auf den königlichen Hütten in Oberschlesien. Es geschah auf die unmittelbare Veranlassung des hochverdienten Ministers v. Reden, welcher dadurch der Schöpfer der großartigen Eisenindustrie Oberschlesiens geworden ist. Die Steinkohlenlager jener Provinz bildeten die Grundlage dieser neuen Gewerbstätigkeit und Oberschlesien bietet das erste und glänzendste Beispiel von dem Erblühen einer großartigen, auf die Verwendung der Steinkohlen begründeten Eisenindustrie auf dem Kontinent. In ähnlicher Weise war die Eisenindustrie Schottlands mit Anlage der Hütte zu Carron und zu Südwales mit den Eisenwerken bei Merthyr Tydwil entstanden. In Schlesien war es Gleiwitz und die Königshütte, welche den Anfang der modernen Eisenindustrie machten. Erst war es v. Reden, damals Berghauptmann von Schlesien, gelungen, den König Friedrich den Großen zu veranlassen, eine Dampfmaschine in England für die wiedereröffneten Blei- und Silberwerke bei Tarnowitz zu beschaffen und reiste v. Reden mit dem später als Staatsminister berühmten v. Stein, der damals Oberbergrat in Westfalen war, im Herbst 1786 deshalb nach England, wo er auch Soho besuchte und Watts Bekanntschaft machte. Im Jahre 1790 wurde das erste Zylindergebläse mit drei eisernen Blasezylindern für Preußen von Graf Reden in England gekauft und 1791 nebst einem großen Windregulator auf der Eisenhütte zu Malapane aufgestellt. Anfang der 90 er Jahre wurde die Königsgrube eröffnet und hier ebenfalls eine Dampfmaschine aufgestellt, und im September 1796 wurde endlich der erste Kokshochofen in Deutschland auf der königlichen Hütte zu Gleiwitz, deren Gründung Reden im Jahre 1790 veranlasst hatte, angeblasen. 1798 wurde die Königshütte gegründet; 1801 konnte Gleiwitz bereits die ersten dort aus Koksroheisen gegossenen und gebohrten Dampfzylinder abliefern. Die Einzelheiten über diese wichtigen Ereignisse werden wir noch genauer in der preußischen Eisenindustriegeschichte mitteilen.
Der Kokshochofen zu Gleiwitz ist nach Lampadius’ Zeichnung in Fig. 199 dargestellt. Er war 40 rhein. Fuß (12,19 m) hoch (genauere Maßangaben folgen auf S. 745).
Das Gebläse bestand im Jahre 1822 aus vier gusseisernen Zylindern, welche durch ein Kropfrad bewegt wurden; nur bei Wassermangel bediente man sich einer Dampfmaschine. Das Gebläse lieferte 1991 Kubikfuß Wind in der Minute; da der Kubikinhalt des Ofens 2330 Kubikfuß betrug, so war das Verhältnis der Windmenge pro Minute zum Ofeninhalt wie 0,8 : 1. In 24 Stunden wurden aus 45 Gichten 50 Ztr. Roheisen erzeugt. Die Windpressung betrug in der ersten Zeit 1½ Pfund auf den Quadratzoll, später bei vollem Gange 2¼ Pfund.
In Frankreich hatte der Engländer Wilkinson in den 70er Jahren einen Hochofen für Koksbetrieb zu Creuzot erbaut. Derselbe war 39 Fuß hoch und hatte eine 8 Fuß weite Gicht.
Welche Mannigfaltigkeit in Form und Größe die Hochöfen im Laufe des 18. Jahrhunderts hatten, zeigt folgende Zusammenstellung bekannter Ofenformen nach ihrem Größenverhältnis (nach Hassenfratz).
Fig. 200 bis 207 (a. f. S.) sind Holzkohlenöfen. Fig. 208 und 209 (S. 745) Koksöfen.
Fig. 200. Steierischer Floßofen mit elliptischem Querschnitt.
Fig. 201. Steier. Floßofen mit viereckigem Querschnitt (Neuberg).
Fig. 202. Steierischer Floßofen mit zwei Blaseformen (Vordernberg).
Fig. 203. Hochofen von Schmalkalden.
Fig. 204. Französischer Hochofen von Großouvre mit achteckigem Querschnitt.
Fig. 205. Sächsischer Hochofen mit konischem Schacht (Johann-Georgenstadt).
Fig. 206. Schwedischer Hochofen mit zylindrischem Schacht (Laurwig).
Fig. 207. Großer Ofen zu Newiansk mit zwei Formen.
Fig. 208. Kokshochofen zu Creuzot mit einer Form.
Fig. 209. 60 Fuß hoher Ofen zu Glamorgan mit zwei Formen und rundem Rauhmauerwerk.
Von Interesse ist nachstehende Zusammenstellung der Maße der zwei ältesten Kokshochöfen auf dem Kontinent, des zu Creuzot und zu Gleiwitz:
Creuzot Gleiwitz
Höhe des Gestelles 1,62 m 1,83 m
Höhe der Rast 4,22 „ 2,74 „
Höhe des Schachtes 6,17 „ 7,62 „
Ganze Höhe 12,01 m 12,19 m
Durchmesser des Kohlensacks 3,24 m 3,36 m
Durchmesser der Gicht 1,19 „ 1,22 „
Breite des Gestelles am Boden 0,70 „ 0,44 „
Länge des Gestelles von der Rückseite
bis zum Tümpel 0,89 „ 0,71 „
Länge des Gestelles von der Rückseite
bis zum Wallstein 1,62 „ 0,93 „
Abstand der Form von der Rückseite 0,38 „ 0,31 „
Höhe der Form über dem Boden 0,56 „ 0,53 „
Die Verbesserungen im Hochofenwesen, welche wir im Vorhergehenden geschildert haben, bezogen sich fast ausschließlich auf den Bau und die Konstruktion der Hochöfen und die Verbesserung der Betriebswerkzeuge. Der Betrieb selbst wurde empirisch meist nach überkommenen Regeln geführt. Die Chemie war noch nicht so weit vorgeschritten, die metallurgischen Vorgänge richtig erklären zu können und der Praxis eine brauchbare theoretische Grundlage zu geben. Das Wesen der Schlackenbildung war noch ganz in Dunkel gehüllt; man wusste nur erfahrungsmäßig, dass für gewisse Erze gewisse Zuschläge vorteilhaft seien. Einige Aufklärung, nicht für die chemische Erkenntnis, sondern für die hüttenmännische Praxis gewährte eine Untersuchung Duhamels im Jahre 1786 über die Verschmelzung reicher Erze in Hochöfen. Es war eine öfter und schon früher beobachtete Tatsache, dass die reichsten besten Erze für sich oder nur mit dem zur Verschlackung ihrer Gangart nötigen Zuschlag verschmolzen, schlechten Ofengang und schlechtes Eisen gaben. Duhamel untersuchte die Sache und kam zu dem Schluss, dass die Ursache in einem Mangel an Schlacke liege. Gehen reiche Erze für sich durch den Ofen, so tritt ihre Reduktion leicht ein, aber das reduzierte Eisen, welches im Übermaß vorhanden ist, umhüllt die Gangart und hindert deren Vereinigung und Verschlackung. Die entstehende zähe, musige Schlacke ist nicht imstande, das Eisen einzuhüllen und vor der unmittelbaren Einwirkung des Windes vor der Form zu schützen, infolgedessen verbrennt ein Teil des Eisens und es entsteht schlechtes Eisen und schlechte Schlacke. Es ist also für einen guten Verlauf des Schmelzprozesses eine gewisse Menge von Schlacke notwendig, welche dem Volum nach die Menge des Eisens bedeutend übertreffen muss. Bei einem gewöhnlichen Erz von 30 Pfd. Eisen im Zentner und 30 Pfd. Kalkzuschlag und einer Produktion von 3600 Pfd. Eisen pro Tag würden nahezu 12000 Pfd. Schlacke gebildet werden. Das Gewicht der Schlacke zu dem des Eisens verhielte sich wie 10 zu 3. Dem Volum nach würde aber die Schlackenmenge das sechs- bis siebenfache von dem Volum des Eisens betragen. Duhamel hatte aus vielen Beobachtungen den Schluss gezogen, dass mindestens die vier- bis fünffache Menge Schlacke dem Volum nach erforderlich sei, um eine gute Schmelzung im Hochofen zu bewirken. Man müsse also bei sehr reichen Erzen nicht nur die der Gangart entsprechende Menge Fluss zusetzen, sondern noch so viel Kalk und Tonerde, als zu der erforderlichen Schlackenmenge noch fehle. Solche Erze ließen sich allerdings nach Duhamels Meinung mit größerem Vorteil in Katalonschmieden verschmelzen, indem hierbei der Kohlenverbrauch nur ½ bis ⅔ beträgt.
Der Gedanke, das Roheisen in Hochöfen mit Koksbetrieb durch Einblasen von Dampf zu verbessern, welcher späterhin öfter wieder aufgetaucht ist, erscheint in England zuerst in einem Patent von John Barber vom 21. April 1773. Seine „Maschine“ zur Reinigung der Steinkohlen im Schmelzofen besteht außer einer Art von Wassersäulmaschine, welche ein Zylindergebläse bewegt, darin, dass über einem niedrigen Schachtofen ein Dampfkessel angebracht wird, welcher mit Urin oder mit einer Lösung von flüchtigem Alkali (Ammoniak?), oder einer sonstigen reinigenden Substanz gefüllt ist. Der Dampf aus dem Kessel wird in den Ofen geleitet, unmittelbar über den Wind. Hierdurch soll die Reinigung während der Schmelzung vor sich gehen. Der Patentbeschreibung (Nr. 1041) ist eine etwas phantastische Zeichnung beigegeben.
Das Roheisen beim Verfrischen durch Zusatz von Chemikalien zu reinigen, wurde beim Tiegelfrischen ausgeführt. Ker, Chapman und Ireland nahmen 1776 ein gemeinschaftliches Patent für die chemische Reinigung des Eisens, wodurch es so hart wie Brennstahl würde, ohne seine Zähigkeit zu verlieren. Sie bedienten sich dazu eines Zementierofens und ihre Zusätze bestanden in Holzkohle, vegetabilischen Salzen und Ölen.