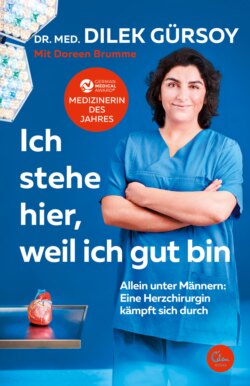Читать книгу Ich stehe hier, weil ich gut bin - Dr. med. Dilek Gürsoy - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Deutsche Heimat, türkische Wurzeln
Оглавление1975 kam mein Bruder Fikri in Neuss zur Welt, und nur anderthalb Jahre später folgte ich. Der Abstand zwischen unseren beiden Geburten war so klein, dass wir im Grunde wie Zwillinge aufwuchsen. Ich habe bis heute eine besonders starke und enge Bindung zu Fikri, er ist mir im Herzen ein Zwillingsbruder. Bei wichtigen Lebensentscheidungen frage ich ihn immer wieder um Rat und nehme mir seine Meinung zu Herzen.
Frage ich meine Mutter heute, wie wir als kleine Kinder so waren, sagt sie immer: »zusammen«. Sie beschreibt mich als ein willensstarkes Mädchen, das schon von klein auf wusste, was es wollte. Und ich wollte offenbar mit meinem Bruder Fikri spielen, am liebsten von morgens bis abends. Wenn wir uns im Spiel rauften, behielt ich – sicher auch dank Fikris zurückgehaltener Kraft – oft die Oberhand, saß rittlings auf ihm und genoss meinen Sieg. Fikri lag dabei geduldig unter mir und lachte. Selbst dann, wenn ich ihn im Schwitzkasten hielt, ließ er es über sich ergehen. Er wusste sicher, dass er auf jeden Fall der Stärkere war.
Meine Mutter blieb nach unseren Geburten nie lange zu Hause, sondern ging recht schnell wieder zurück zu Pierburg ans Fließband. Da sie noch immer nicht gut Bescheid wusste über das Neusser Kinderbetreuungssystem, brachte sie uns während der Arbeitszeit zu inzwischen ebenfalls in der Stadt ansässigen Verwandten. Für sie war es nicht einfach, ihre Schwägerinnen, Schwestern meines Vaters, und mitunter auch Bekannte zu bitten, auf uns achtzugeben. Als ich etwa anderthalb Jahre alt war, hörte meine Mutter über Arbeitskollegen von einem Kindergarten gleich bei uns um die Ecke, der von 6 bis 18 Uhr, also zu fabrikarbeiterfreundlichen Zeiten, geöffnet hatte. Als sie dort nach Plätzen für Fikri und mich anfragte, bekam sie von Frau Bisping, die die Einrichtung mit ihrem Mann führte, die Antwort, dass ihre gewünschten Betreuungszeiten kein Problem seien und es im Kindergarten so viele ausländische Kinder gäbe, dass man sich wie in Klein-Ankara vorkäme.
Eines Tages, ich war etwa zwei, brannte es in unserer Wohnung in der Neusser Kapitelstraße. Mein Vater war an diesem Tag zu Hause, weil er krank war, und passte auf Fikri und mich auf. Mein Vater arbeitete damals als Reinigungskraft im Neusser Kaufhaus Horten an der Oberstraße. Als meine Mutter von der Arbeit kam und ihr Wohnhaus, Rauch, Polizei und Feuerwehr erblickte, blieb ihr das Herz stehen. »Wo sind meine Kinder?« Mit diesen Worten stürzte sie auf die Beamten zu. Als sie uns und unseren Vater sicher und wohlbehalten in der Bäckerei im Nachbarhaus fand, fiel ihr ein Stein vom Herzen.
Den Aufruhr vor unserem brennenden Haus hatte auch Frau Bisping mitbekommen. Sie sagte zu ihrem Mann: »Das Haus, das da brennt, das ist doch das Haus von der Dilek und dem Fikri! Da muss ich hin, die Kinder holen!« Und so marschierte sie im Stechschritt in die Bäckerei, schnappte sich Fikri und mich, klemmte einen von uns links, den anderen rechts unter ihre kräftigen Arme und meinte: »Was machen denn die Kinder hier? Die beiden können doch nicht in dem Durcheinander bleiben! Die kommen jetzt erst mal mit mir mit in den Kindergarten!« Dann drehte sie sich mit uns, die wir beide überrascht und sprachlos unter ihren Achseln hervorlugten, um und marschierte mit resolutem Schritt los.
Das schon ältere Ehepaar Bisping führte seinen Kindergarten mit strenger, aber fürsorglicher Hand. Für Fikri und mich bedeutete der Kindergartenbesuch eine recht große Umstellung unseres Alltags: Bei den Verwandten und Bekannten, die uns bisher mehr oder weniger beaufsichtigten, liefen wir so nebenher mit. Wir wurden von ihnen versorgt und hatten meist machen können, was wir wollten. Bei den Bispings lief es nun anders: Der Tagesablauf war geordneter und strukturierter. Plötzlich stand unsere Bildung auf dem Plan, und wir Kinder waren der Mittelpunkt des Geschehens. Die Bispings kümmerten sich um unsere deutsche Sprache und Aussprache. Damit öffneten sie uns die Tür ins deutsche Bildungssystem. Herr und Frau Bisping belehrten uns zu allem, was ihnen wichtig schien. Sie waren Gymnasiallehrer der Vorkriegsgeneration. Bis heute hat sich mir Frau Bispings energische Hand ins Gedächtnis eingebrannt, mit der sie den Bleistift hielt und schrieb. Weil ich noch klein war, ich konnte kaum über die Tischkante schauen, hatte ich ihre schreibende Hand genau im Blick und immer das Gefühl, gleich würde das Papier reißen, auf dem sie schrieb. So fest drückte sie dabei auf. Ordnung, Sauberkeit und Disziplin waren Werte, die die beiden sehr hochhielten und uns Kindern offensichtlich so überzeugend vermittelten, dass sie mir in Fleisch und Blut übergegangen sind.
Unsere Familie profitierte von unserem Kindergartenbesuch enorm. Meine Mutter war heilfroh, nicht mehr von Tür zu Tür laufen und die Verwandtschaft anbetteln zu müssen, um uns halbwegs beaufsichtigt zu wissen. Im Gegenteil: Sie war sehr stolz darauf und überaus dankbar, dass ihre beiden Kinder einen deutschen Kindergarten besuchen konnten. Erst viel später erfuhr ich von Frau Bisping, dass ihre Zuwendung zu und ihr Verständnis für uns Kinder mit ausländischen Wurzeln auch daher rührte, dass sie selbst als Belgierin, also Ausländerin, nach Deutschland gekommen war, als sie noch ein Kind war.
Als zuerst Fikri und dann ich in die Grundschule kamen, bestand unser inzwischen sehr gutes Verhältnis zu den Bispings weiterhin. Ich erinnere mich gut daran, dass Herr Bisping mich im sogenannten Silentium auch bei Hausaufgaben für die Schule noch regelmäßig unterstützte. Nach dem Tod meines Vaters, so erzählt es die heute 94-jährige Frau Bisping, habe ihr Mann erklärt, dass er jetzt die Rolle des »Mannes im Hause Gürsoy« übernehmen würde. Er reduzierte sofort die Betreuungskosten für uns Kinder, von damals 120 auf 12 Mark. Das war ein Segen für meine Mutter. Frau Bisping erzählte mir auch, dass ihr Mann besonders auf mich große Stücke hielt – und mich und meine Entwicklung stets mit nahezu väterlichem Stolz betrachtete. Er habe immer gesagt, dass er Dilek fördere, weil sie »sein Mädchen sei und er sie fördern müsse«. Er sei sich immer sicher gewesen, dass ich durchkäme, erklärt die alte Dame mir heute spitzbübisch lächelnd, während ihre flinken, hellwachen Augen mich durch die Brillengläser hindurch ansehen. Ihm sei es immer gleich gewesen, dass wir türkische Wurzeln hätten, er habe immer gesagt: »Das ist mir egal, für mich sind es Kinder!«
In die Neusser Martin-Luther-Grundschule gingen Fikri und ich jeden Morgen zusammen. Ein Stück des Wegs dorthin fuhren wir auch mit dem Bus. Darin stritten wir uns immer um den Fensterplatz ganz vorne rechts neben dem Busfahrer. Auf dem wollte ich jeden Morgen unbedingt sitzen, und Fikri machte ihn mir Morgen für Morgen streitig. Die Erinnerung daran schreibt mir gerade ein breites Grinsen ins Gesicht. Und ich empfinde heute auch ehrliches Mitleid mit den Busfahrern, die sich damals allmorgendlich unser nerviges Geschwistergeplänkel anhören mussten.
Derselbe Bäcker, bei dem wir einst Zuflucht fanden, als unsere Wohnung gebrannt hatte, war Jahre später noch immer unsere Anlaufstelle: Dort machten wir auf dem Heimweg von der Schule täglich halt. Meine Mutter hatte jedem von uns morgens fünfzig Pfennig mitgegeben. Zusammengelegt reichte unsere Mark für ein Brötchen, einen Schokokuss und eine Haselnussschnitte. Das Essen teilten wir stets zwischen uns auf, wie genau, das weiß ich heute nicht mehr. Doch ein Gefühl wie Neid kannten wir damals nicht.
Das Mehrfamilienhaus in Neuss/Weckhoven, in dem wir inzwischen wohnten, stand in einem Viertel, das man heute wohl als Getto bezeichnen würde. Ich wusste Verwandte in der Nähe und kannte die Wege zu ihnen. Die lief ich, wenn ich musste. Auf der Straße spielten wir damals nicht so viel. Meist verbrachte ich meine Nachmittage nach der Schule drinnen, nicht selten saß ich vor dem Fernseher. Wenn ich höre, wie andere erzählen, dass sie als Kind ein Buch nach dem anderen regelrecht verschlungen hätten, dann ist es mir immer ein bisschen unangenehm, dass ich nicht viele Bücher gelesen, sondern stundenlang vor dem Fernseher gehockt habe. Aber ganz ehrlich: Der Kasten lehrte mich das echte Leben! Ich saugte die Informationen auf wie ein trockener Schwamm das Wasser. Noch heute kann ich das gut: stundenlang vor dem Fernseher sitzen und mich von ihm berieseln lassen. In dieser Zeit fing ich an, mich für Technik zu interessieren: Ich konnte so schnell wie kein anderer in der Familie Geräte und zugehörige Fernbedienungen programmieren und bedienen.
Fikri sah sich als mein älterer Bruder stets in der Beschützerrolle, und auch in meinen Augen hatte er diese inne. Obwohl er zwei Klassen über mir war, passte er immer auf mich auf. In der Grundschule tat er das ganz offen: Wenn mich mal jemand ärgerte, trat Fikri für mich ein, auf dem Schulflur oder auf dem Schulhof. Und ich habe je nach Situation auch nach meinem Bruder gerufen oder meinem Gegenüber damit gedroht, meinen großen Bruder zu holen. Später, als sich unsere Schulwege trennten und Fikri die Hauptschule besuchte, wo er später seinen Realschulabschluss machte, und ich das Gymnasium, gab es mal einen Jungen in meiner Klasse, der mich so richtig triezte. Ich erzählte meinem Bruder davon. Der hatte Kumpel auf meiner Schule, und die schickte er damals vor, um die Angelegenheit zu regeln. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie Fikris Kumpel dem Ärgerling ordentlich die Meinung sagte. Die klare Ansage allein, dass er es mit meinem Bruder zu tun bekäme, falls er nicht aufhören würde, mich zu ärgern, reichte schon, damit der Junge mich fortan in Ruhe ließ.
Dass ich überhaupt aufs Gymnasium kam, habe ich Herrn Bisping zu verdanken. Der hatte mich nie aus den Augen verloren, und als er erfuhr, dass ich von der Grundschule keine Empfehlung fürs Gymnasium bekommen hatte, nahm er die Sache höchstpersönlich in die Hand. Er ging mit mir zunächst zu einem kirchlichen Gymnasium in Neuss. Frau Bisping erinnert sich, dass die Nonnen dort damals jedoch abweisend auf mich reagiert hätten, denn sie hätten gerade zwei spanische Kinder und ein portugiesisches Kind aufgenommen und wollten kein türkisches dazu. Ihr Mann habe darauf bloß geantwortet: »Dankeschön, auf Wiedersehen! Ich krieg’ sie unter!« Er brachte mich dann zum Direktor des damaligen Theodor-Schwann-Gymnasiums, wo er bereits einen Termin gemacht hatte, und erklärte, dass ich unbedingt auf das Gymnasium müsste. Er setzte sich sehr für mich ein: »Das Mädchen hat das Zeug fürs Gymnasium, es wäre eine Schande, wenn ihm diese Chance verwehrt würde!«, sagte er. Und auch, dass das Mädchen, also ich, Ärztin werden wollte und er sich sicher sei, dass mir das auch gelänge. Am Ende schaffte er es, dass das Gymnasium mich aufnahm – trotz fehlender Empfehlung von meiner Grundschule, dafür aber wärmstens empfohlen von Herrn Bisping.
Heute, wo ich das, was er für mich getan hat, noch weitaus mehr zu schätzen weiß als damals, laufen mir beim Erinnern daran die Tränen. Der liebe Herr Bisping hat immer an mich geglaubt. Ohne Zweifel traute er mir die medizinische Laufbahn zu und setzte alles daran, sie mir zu ermöglichen. Er öffnete mir die entscheidende Tür, die ich zu dem Zeitpunkt schon für geschlossen hielt. Wie traurig war ich damals gewesen und wie enttäuscht. Auch Wut empfand ich darüber, dass meine Grundschullehrer mir diesen Beruf offensichtlich nicht zutrauten. Was wäre wohl aus mir geworden, wenn er nicht für mich eingetreten wäre?
Ich bin mir dessen absolut bewusst, was ich Herrn Bisping verdanke, und ihm bis heute zutiefst dankbar für seinen Einsatz. Ich bin froh, dass ich bis zu seinem Tod im Mai 2019 mehrfach Gelegenheit hatte, mich bei ihm persönlich zu bedanken. Frau Bisping ist inzwischen Mitte neunzig und bewundernswerterweise noch bei äußerst klarem Verstand. Und mit dem verfolgt sie meinen Werdegang aufmerksam. Als ich ihr bei unserem letzten Treffen in einem Neusser Café gegenübersaß, fühlte ich mich trotz meiner 43 Lebensjahre wieder wie damals mit vier Jahren. Unter dem noch immer klaren, strengen Blick meiner ersten Lehrerin setzte ich mich gleich aufrechter hin, stellte die Beine gerade nebeneinander auf und legte beide Hände brav auf die Knie. Gelernt ist gelernt, Frau Bisping!
Ich bin mir sicher, dass die strenge frühkindliche Bildung, um an dieser Stelle mal den Fachbegriff zu bemühen, die mir die Bispings zuteilwerden ließen, meinen Lebensweg geebnet hat. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter: Das Ehepaar hat mich mit seiner deutschen Erziehung zu einem sehr frühen Zeitpunkt geprägt, zu dem viele andere Kinder der ersten Gastarbeitergeneration in Deutschland, der meine Eltern ja angehörten, diese Chance noch nicht hatten. Insofern verdanke ich den Bispings die Grundzüge meiner deutschen Seite, meiner deutschen Identität. Sie legten den Grundstein dafür, dass ich mich heute als die fühle, die ich bin: Dilek Gürsoy aus Neuss.
Ich weiß nicht, mit wie viel Selbstsicherheit und Selbstvertrauen ich in diese Welt geboren wurde. Sicher war es nicht mehr, als jedes andere Kind auch davon mitbekommt. Mein großes Glück als Kind war jedoch, dass die Erwachsenen um mich herum mir das niemals genommen haben. Mein Urvertrauen in meine eigene Stärke wurde nicht gebrochen. Ich war mir meiner selbst stets sicher. Dass ich als Kind mal Selbstzweifel hegte, würde ich aus der Rückschau rigoros verneinen.
Ich konnte zudem immer darauf bauen, dass meine Familie zu mir hält. Mir zur Seite steht oder mich auffängt, wenn ich mal stolpere oder hinfalle. Mit diesem Gefühl durchs Leben gehen zu dürfen, das ist das größte Geschenk, das meine Familie mir machte und macht: Sie lässt mich fühlen, nicht allein auf dieser Welt zu sein.
Maßgeblich dafür verantwortlich ist meine Mutter. Sie war für eine Frau, die aus einer türkischen Dorfgemeinschaft stammte, deren Dorfältester ihr Vater war und die streng traditionell funktionierte, extrem mutig. Viele türkische Frauen in unserem Umkreis, die im Rahmen des zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei vereinbarten Familiennachzugs ihren schon hier unter Vertrag arbeitenden Männern folgten, kümmerten sich nach ihrer Ankunft weiterhin ausschließlich um die Kinder und den Haushalt. Sie blieben Hausfrauen. So waren sie es aus der Heimat gewohnt, und so machten sie es hier in Deutschland weiter. Sie verschlossen sich damit sicher ein Stück weit der möglichen frühen Integration in die deutsche Gesellschaft: Statt sich Schritt für Schritt ins deutsche Alltagsleben einzumischen, blieben sie unter sich, bildeten ihre eigene parallele Gesellschaft, eine türkische Welt inmitten der deutschen.
Meine Mutter dagegen brach aus dem klassischen Rollenbild aus, indem sie nicht zu Hause blieb, sondern sich selbst eine Arbeit suchte und arbeitete. Dazu muss man wissen, wie meine Mutter über Deutschland dachte, als sie hier ankam. Es klang bereits an, dass sie sich hier Freiheit und Sicherheit erhoffte und beides schließlich ja auch fand. Meine Mutter zeigte sich, anders als viele türkische Frauen ihrer Generation in unserem Bekanntenkreis, von Anfang an sehr offen für das Land, in dem sie fortan lebte. Ich habe sie für das Buch extra noch einmal gefragt, warum das so war: »Ich habe Deutschland nie als Durchreise betrachtet, sondern als meine neue Heimat«, antwortet meine Mutter. »Die Deutschen waren mir anfangs zwar fremd«, erzählt sie weiter, »aber nur so lange, bis ich auf sie zuging, sie ansprach und sie mitunter auch um Rat und Hilfe bat. Dann waren es Menschen wie du und ich. Ich wurde immer liebevoll angenommen, die Neusser haben mich respektiert wie ich sie. Ich bekam Hilfe, wenn ich drum bat. Aber das muss man auch können: um Hilfe bitten. Ich konnte das. Ich hatte immer meinen gesunden Stolz, und den ließ man mir, so wie ich den Leuten den ihren ließ.«
In dem Moment, wo meine Mutter deutschen Boden betrat, machte sie Deutschland zu ihrer Heimat und damit auch zu der Heimat ihrer Kinder. Insofern gab sie uns mit Stolz und Freude in die Hände der Bispings und fürchtete nicht um den Verlust unserer türkischen Wurzeln. Im Gegenteil, sie sah es als Chance, uns mit den deutschen Gepflogenheiten, Bräuchen und ja, auch Regeln, bekannt zu machen. Damit wir in Deutschland bestehen konnten. Es einmal besser hätten als sie. Sie wünschte sich für uns eine Zukunft hier. Dass aus uns etwas werden würde, wir einen Beruf erlernen und ergreifen würden, der uns zufriedenstellt, ideell wie materiell. Und dafür arbeitete meine Mutter hart. Bis zum Renteneintritt stand sie Tag für Tag am Fließband und schuftete körperlich schwer.
Und weil sie bei Pierburg Schichten im Akkord arbeitete, verdiente sie auch 200, 300 Mark mehr als mein Vater. Doch das war in Ordnung, denn das Geld meiner Eltern wanderte in einen Topf, aus dem alles bezahlt wurde. Ein gemeinsames Konto ist für meine Mutter ein Muss für Eheleute, darauf besteht sie strikt. Für meinen Vater war der Mehrverdienst meiner Mutter übrigens auch kein Problem. Das finde ich schon bemerkenswert, kommt er doch aus einer Kultur, die ihm von klein auf an eingetrichtert hatte, dass der Mann der Hauptversorger der Familie ist. Mein Vater hatte anfangs als Putzkraft bei Horten gearbeitet, war dann bei Ideal Standard beschäftigt, einem Unternehmen, das bis heute Keramik und Möbel für Bäder produziert. Zum Schluss arbeitete er beim Hersteller der Papiertaschentuchmarke Tempo.
Meine Mutter hat sich von Anfang an auch als ein Teil der deutschen Gesellschaft, der deutschen Arbeiterschaft empfunden. Als ein Teil, der eine Stimme hat. Und diese auch erhebt, wenn es sein muss – ohne Repressalien befürchten zu müssen. 1973 war so ein Moment, an dem meine Mutter nicht schweigen wollte: Sie war eine der Arbeiterinnen, die an den über 300 Streiks teilnahm, die in jenem Jahr in ganz Westdeutschland stattfanden. Die Fließbandarbeiterinnen streikten damals für mehr Lohn, bessere Arbeitsbedingungen und Gleichberechtigung. Meiner Mutter und ihren Kolleginnen bei Pierburg in Neuss ging es beispielsweise um die Abschaffung aller Leichtlohngruppen, die dafür sorgten, dass Frauen weniger als Männer verdienten, und um eine Erhöhung des Stundenlohns um eine Mark. So ist es zumindest in dem Buch Wilder Streik. Das ist Revolution. Der Streik der Arbeiterinnen bei Pierburg in Neuss 1973 zu lesen, das Peter Braeg zum 40. Jahrestag des in die Geschichtsbücher eingegangenen Streiks im Jahr 2013 im Berliner Verlag Die Buchmacherei herausgab.
Das muss man sich mal überlegen: Meine Mutter hat für die Gleichberechtigung der arbeitenden Frau gestreikt! Sie war nicht nur aus der ihr traditionell zugeschriebenen Rolle der Hausfrau und Mutter geschlüpft und arbeiten gegangen, sondern machte jetzt auch noch ihren Mund für die Gleichberechtigung der Frau auf – und das laut. Auf der Straße. In der Öffentlichkeit. Das nenne ich mal Emanzipation! Meine Mutter hat sich damit das ihr in diesem demokratischen Land zustehende Recht genommen, ihre Meinung frei zu äußern, ihre Lebensumstände mitzugestalten und nicht nur alles als gegeben hinzunehmen. Ich liebe meine Mutter dafür!
Deutschland, sagt meine Mutter nach inzwischen fünfzig Jahren im Land, sei ihr eine neue Heimat geworden. Ihre Liebe zu ihrem Geburtsort ist ungebrochen. Meinen Vater hat meine Mutter dort beerdigt. Ihre letzte Ruhestätte wünscht sie sich auch in der alten Heimat. Aber nicht an der Seite ihres Mannes, das wolle sie nicht, sagt sie. Dafür habe ihr die Familie meines Vaters zu viel Leid angetan.
Identität wächst mit Verstehen. Verständnis fußt auf Kommunikation. Reden gelingt mit Sprache. Um miteinander zu reden und einander zu verstehen, braucht es eine gemeinsame Sprache. Auch wenn meine Eltern das Konzept intellektuell nicht erfassten, fühlten sie doch, dass es für uns Kinder mit unseren türkischen Wurzeln in unserer deutschen Heimat von enormer Bedeutung sein wird, sowohl Deutsch als auch Türkisch zu sprechen. Und so begrüßten sie unsere Deutschausbildung im Kindergarten der Bispings und sprachen daheim mit uns in ihrer Muttersprache. Damit wir diese auch richtig lesen und schreiben lernten und auch mit der türkischen Geschichte noch besser vertraut wurden, sendeten unsere Eltern uns zweimal die Woche in den Türkischunterricht, der an unserer Grundschule nachmittags stattfand. So lernte ich, beide Sprachen wie meine Muttersprache zu benutzen. Dafür bin ich allen Beteiligten zutiefst dankbar. Und ich rate es jedem, der die Gelegenheit hat, seine Kinder zweisprachig großwerden zu lassen. Denn heute, wo ich auch in dem Geburtsland meiner Eltern öffentlich auftrete, um über meine Arbeit zu reden, bin ich in der Lage, das in einwandfreiem Türkisch zu tun. Das Lob meiner türkischen Kollegen in der Medizin ebenso wie das türkischer Medienvertreter und Politiker, dafür, dass ich genau das kann, obwohl ich in Deutschland geboren bin, hier aufwuchs, hier studierte, hier arbeite und forsche, macht mich unheimlich stolz. Mit meinem Bruder Fikri spreche ich mal Deutsch, mal Türkisch. Welche Sprache wir wählen, hängt davon ab, wie es uns geht und worum sich unser Gespräch dreht. Nicht selten wechseln wir mitten im Satz von einer Sprache in die andere.
Dass Deutschland, insbesondere Neuss, auch mir zur echten Heimat wurde, verdanke ich demnach maßgeblich meiner Mutters Einstellung. Auch meinen Stolz und mein Selbstbewusstsein habe ich wohl von ihr geerbt. Und damit schritt ich von Anfang an durchs Leben. Ich habe mich immer am richtigen Platz gefühlt, immer erwünscht. Ich wollte immer dort sein, wo ich war, immer die sein, die ich bin.
Ich habe mich selbst nie als eine Migrantin gesehen, nie als Deutsche mit türkischer Abstammung. Ich war einfach nur Dilek Gürsoy aus Neuss. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ich kann mich auch beim besten Willen nicht daran erinnern, dass ich mich wegen meiner türkischen Wurzeln anders oder gar schlechter behandelt fühlte als andere Kinder. Mich hat auch keiner jemals wegen meines Aussehens, meiner dunklen Haare, dunklen Augen oder kräftigen, dunklen Augenbrauen angemacht, die ja mehr als deutlich auf meine nicht deutsche Herkunft hinweisen. Heute weiß ich, dass viele andere Gastarbeiterkinder diese Zeit ganz anders erlebten als ich.
Was nicht heißen soll, dass ich mich nie mit anderen Kindern gestritten habe, weil ich mitspielen, mitmachen oder mitgehen wollte und das nicht durfte: Doch dabei ging es aus meiner Sicht niemals darum, dass ich türkische Eltern hatte. Dass ich als Kind wegen meiner Herkunft weder Diskriminierung noch Ausgrenzung spürte, sondern mich im Gegenteil bis heute durch und durch als Neusserin fühle, also als Eingeborene, die ich dank meiner Geburt hier in der Stadt ja bin, das schreibe ich auch der in meinen Augen ganz besonderen Art der Menschen in Neuss zu. Traditionelle christliche Werte wie Ehrlichkeit, Rechtschaffenheit, Nächstenliebe haben mich hier von klein auf geprägt und passten zu den Werten, die meine Eltern aus der religiös geprägten Kultur ihres Heimatlandes kannten und mir zu Hause mitgaben.
– • –
Ihre Religion, den Islam, haben meine Eltern mit nach Deutschland gebracht. Wir sind eine gläubige Familie: Wir glauben daran, dass es Gott gibt. Das arabische Wort für »Gott« ist »Allah«. Wir glauben an ihn als eine höhere Macht, die wir insbesondere in schweren Zeiten anrufen, um sie um ihren Beistand zu bitten. Mein Vater, des Lesens und Schreibens mächtig, er war ja ein Beamter im öffentlichen Dienst in der Türkei, hatte als Kind die Koranschule besucht und kannte den Koran, das heilige Buch des Islam, auswendig. In unserem Haushalt gab es mehrere Exemplare des Korans, genauso, wie in deutschen Haushalten die ein oder andere Bibel im Bücherregal steht oder in der Nachttischschublade liegt. Doch weder mein Vater noch meine Mutter beteten fünfmal am Tag, wie es die Religion einem gläubigen Moslem vorschreibt. Dazu hielten sie uns Kinder auch nicht an. Es gab auch keine Tischgebete im Hause Gürsoy. Lediglich zum Abschied wünschte uns meine Mutter regelmäßig Gottes Beistand. Wenn wir uns allmorgendlich zur Schule aufmachten und wenn wir uns auf Reisen begaben, die uns für längere Zeit trennten. Das macht sie bis heute. Selbst wenn ich die Worte nicht höre, weiß ich, dass sie sie mir in Gedanken mitgibt.
Als mein Vater gestorben war, erlebte meine Mutter plötzlich einen Druck aus der Verwandtschaft. Sie, die seit ihrer Ankunft in Deutschland kein Kopftuch als äußeres Zeichen ihrer Religionszugehörigkeit mehr trug, sich auch sonst an die deutsche Mode der damaligen Zeit angepasst hatte, kürzere Röcke anzog und Bein zeigte, sollte wieder ein Kopftuch tragen. Schließlich sei sie jetzt Witwe, sagten ihr andere, und sie gab klein bei. Auf Arbeit trug sie das Kopftuch aber nie. Erst in den ersten Jahren des neuen Jahrtausends hat sie das Kopftuch endgültig abgelegt. Das hatte sicher auch mit mir zu tun: Ich habe damals zu meiner Mutter gesagt, dass sie es nicht brauche. Sie trüge ihre Religion doch im Herzen. Außerdem war und bin ich der Meinung, dass es nicht zu meiner Mutter passte, denn sie war und ist längst über das Tuch hinausgewachsen. Meine Unterstützung damals war ihr wichtig, so sagt sie heute. Und sie gesteht, dass sie froh ist, ihr Kopftuch nicht mehr zu tragen. Sie hat jetzt eine moderne Kurzhaarfrisur, mit der sie sich rundum wohlfühlt.
Für mich stand es nie zur Debatte, dass ich ein Kopftuch tragen würde. Die Diskussion kam bei uns zu Hause nie auf. Wir sind zwar gläubig, aber das ist unsere Privatsache, wir tragen unseren Glauben nicht sichtbar nach außen mit uns herum. Das ist sicher in vielen türkischen Familien anders.
Unter dem schon erwähnten Druck der Verwandtschaft schickte meine Mutter uns Kinder nach dem Tod meines Vaters auch in die Koranschule in der örtlichen Moschee. Ich hielt den Unterricht dort ein Jahr durch, Fikri nicht mal das. Ich lernte in dieser Zeit, die eine oder andere Koransure, so nennt man die Kapitel des Buches, auswendig zu rezitieren. Damit hatte ich das wichtigste Vokabular, um meine Gebete auf Arabisch zu sprechen, wobei ein Moslem in jeder Sprache beten darf. Bis heute bete ich jeden Abend, meist im Bett kurz vor dem Einschlafen. Das ist mir wichtig: Ich schließe damit meinen Tag ab.
Das Gebet gilt als eine der fünf Säulen des islamischen Glaubens. Ebenso wie das Fasten im Monat Ramadan. So heißt der neunte Monat des islamischen Kalenders, der ein reiner Mondkalender ist, sodass die Monate durch die Jahreszeiten wandern. Der Ramadan beginnt demzufolge jedes Jahr etwa zehn Tage früher als im Vorjahr. Meine Mutter hat während des alljährlichen Fastenmonats immer gefastet. Damit hörte sie aus gesundheitlichen Gründen erst vor Kurzem auf. Ich habe bisher nie den ganzen Monat über gefastet, das konnte ich auch oft nicht mit der anstrengenden und verantwortungsvollen Arbeit am OP-Tisch vereinbaren.
Doch ich spende viel. Das Spenden ist eine weitere Säule des Islam und liegt mir sehr am Herzen. Ich habe mir eine Position in der Kunstherzchirurgie erarbeitet, die gut bezahlt wird. Mir geht es finanziell sehr gut, und ich finde es ganz selbstverständlich, einen Teil dessen abzugeben, wovon ich genug habe. Deshalb finanziere ich im Ramadan zum Beispiel auch regelmäßig das Essen zum traditionellen Fastenbrechen. Dazu muss man wissen, dass die fastenden Muslime in diesem Monat täglich zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang nicht essen und nicht trinken dürfen. Nichts außer dem eigenen Speichel soll in der Fastenzeit geschluckt werden. Das tägliche Fasten wird abends mit einer gemeinsamen Mahlzeit gebrochen. Nach dem Ende des Fastenmonats gibt es ein mehrtägiges Fest mit Festessen. Ich spende für solche Essen in der Moschee, wo vor allem die eher bedürftigen Gläubigen bewirtet werden, und ich schicke auch Geldspenden in die Türkei.
Doch ich beschränke mich mit meinen Spenden nicht auf meine Religion und meine Glaubensbrüder und -schwestern. Ich helfe einfach gern, am liebsten da, wo meine Hilfe gebraucht wird und wo ich etwas Sinnstiftendes bewirken kann. Als Neusserin fühle ich mich meiner Heimatstadt ganz besonders verbunden. Und so habe ich mir hier in der Stadt nach und nach verschiedene Einrichtungen gesucht, die ich unterstütze, zum Beispiel ein Hospiz.
In meinem Glauben bin ich mir ganz sicher. Und so kann ich auch großzügig gegenüber anderen Religionen sein. Das kannte ich auch so von meinen Eltern: Ihnen machte es zum Beispiel nichts aus, dass in der Kindertagesstätte der Bispings christliche Symbole, ich erinnere mich an verschiedene Kreuze, aufgehängt waren.
Ich selbst liebe die traditionelle Vorweihnachtszeit sehr, wie sie im christlichen Deutschland begangen wird. Der ganz besonderen Stimmung, die hier im Advent herrscht, mit ihrem Funkeln, Glitzern und dem flackernden Kerzenschein kann ich mich nicht entziehen. Das deutsche Brauchtum rund um Weihnachten gefiel mir schon als kleines Mädchen. Und deshalb hole ich mir heute ein Stück davon auch gern nach Hause. Seit ich bei meiner Mutter auszog und allein wohne, gibt es bei mir in der Wohnung immer Adventskränze mit Kerzen, und auf keinen Fall darf ein Adventskalender fehlen! Der ist mir sogar ganz besonders wichtig! Zu Weihnachten stelle ich mir gern ein Weihnachtsbäumchen auf. Und auch zu Ostern schmücke ich meine Wohnung mit typisch deutschem Osterschmuck.
– • –
In der Grundschule liebte ich die Fächer Deutsch, weil ich unbedingt lesen und schreiben lernen wollte, und Sport, weil ich mich gern bewegte. Im Sprinten über 100 Meter war ich trotz meiner eher kräftigen Statur in meiner Klasse unschlagbar. Ich musste immer mit den Jungs rennen, um sie anzuspornen und bis zum Ziel mitzuziehen. Vielleicht ist an mir eine Sprinterin verloren gegangen. Auch im Kugelstoßen war ich gut: Ich hatte Kraft und stieß die Kugel sogar noch weiter, als für die Note Eins plus erforderlich war. Als ich dank Herrn Bisping dann doch aufs Gymnasium kam, war mir klar, dass dies meine Chance ist und ich sie unbedingt nutzen wollte. Ich setzte von Anfang an alles daran, mein Ziel, Ärztin zu werden, zu erreichen. Latein und Biologie wurden meine Lieblingsfächer, in denen ich mich über die Maße engagierte. Ich machte sie zu meinen Leistungsfächern. In Latein war ich sogar richtig gut. In anderen Fächern zählte ich nie zu den besten Schülern in der Klasse, denn die empfand ich eher als lästig. Ich musste darin so viele Sachen lernen, die gar nichts mit Medizin zu tun hatten! Und ich wollte doch eigentlich nur Ärztin werden. Da ich aber verstanden hatte, dass es keinen anderen Weg zum Abitur gab, machte ich mich auf den Weg zur Schule – jeden Morgen aufs Neue – und lernte.
Bis heute ist mir eine Szene aus der Schulzeit unvergessen im Gedächtnis geblieben: Wir waren mit der Klasse Eis essen. Mein Geschichtslehrer war, dem Aussehen nach, der typische Intellektuelle – mit seinen grau melierten Haaren und seinem silberweißen Seehundschnauzer. Ich sehe ihn noch heute so deutlich vor mir, als wäre es gestern. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir damals überhaupt aufs Thema kamen, nur, dass ich ihm sagte: »Ich möchte Medizin studieren.« Der Mann hat mich daraufhin nur merkwürdig angeschaut. Er hat nichts gesagt. Aber sein Blick sprach Bände. Ich bin nicht der Typ, der ihm das übel nahm oder sich dachte … na, dem werd ich’s zeigen! Ich machte einfach weiter, mein Ziel hatte ich längst fest ins Auge gefasst.
Die Schule war ein Muss, sie war der Weg zum Abi, das mir die Türen zum Studium der Medizin eröffnete. Nachmittags traf ich mich ab und an mit zwei Freundinnen, mal bei mir, mal bei ihnen zu Hause. Wenn wir uns trafen, haben wir die Themen durchgekaut, die Mädchen in dem Alter so haben: Schule, Mode, Eltern, Jungs. Mich interessierten diese Themen nicht wirklich. Ich hatte mich festgelegt, ich wollte die Schule einfach nur abschließen. Und mich bei diesem Vorhaben nicht ablenken lassen. Also ging ich nach der Schule meistens nach Hause, machte meine Hausaufgaben und verlebte meinen Alltag ziemlich unspektakulär.
Ein Höhepunkt in dieser Zeit und ein Schlüsselerlebnis auf meinem Weg in die Medizin war ein zweiwöchiges Praktikum in der Mittelstufe, das ich im Johanna-Etienne-Krankenhaus in Neuss absolvierte. Dort durfte ich auf der gynäkologischen Station bei den Krankenschwestern aushelfen. Ein schon älterer, sehr netter Oberarzt hatte mir damals geraten, mir meinen Berufswunsch doch noch einmal gut zu überlegen. »Erst das elendig lange Studium, dann der Job, der auf Dauer nicht wirklich Spaß macht.« Das waren seine Worte damals. Mich konnte er damit nicht umstimmen, ich verbuchte seine Meinung als die eines verbitterten, ausgebrannten Arztes, der vielleicht nie die Leidenschaft für seinen Beruf gespürt oder sie, aus welchen Gründen auch immer, unterwegs verloren hatte. Im Gegenteil, mich bestärkten seine Worte damals in meiner Berufswahl, und ich sagte ihm, dass wir uns in zehn Jahren sicher wiedersehen würden – und sicher würde mir mein Beruf dann Spaß machen.
Meine pubertären Jahre habe ich als völlig undramatisch in Erinnerung. Gut, der Busen wuchs, aber damals nahm ich einfach einen BH meiner Mutter aus dem Schrank, zog ihn an und fertig. Aufgeklärt wurde ich im Unterricht, das war kein Thema zwischen mir und meiner Mutter. Natürlich hatte ich auch den einen oder anderen Jungen in der Schule, den ich toll fand und für den ich insgeheim schwärmte. In der siebten Klasse liebte ich jemanden aus tiefstem Herzen – aus der Ferne. Und wie wohl jedes Mädchen in diesem Alter ihrem Schwarm herzklopfend auflauert, habe auch ich das eine oder andere Mal an der Bushaltestelle, der Schultür oder auf den Stufen im Schulhaus gestanden, nach ihm Ausschau gehalten und gewartet, bis er ganz nah an mir vorbeikam. Herzklopfen – nicht mehr und nicht weniger passierte damals. Und es gab da auch jemanden, der für mich schwärmte.
Das Abitur ging relativ entspannt vorüber. Ich musste zwar ein, zwei Klausuren nachschreiben, doch beim zweiten Versuch hatte ich auch die geschafft und war meinem Ziel, Ärztin zu werden, damit einen gehörigen Schritt näher gekommen. Wenn ich heute in unserem Abibuch blättere, muss ich lächeln. In einer Umfrage nannten meine Mitschüler mich zuerst bei den Fragen danach, wer aus unserem Jahrgang als Erstes heiraten und wer die meisten Kinder bekommen würde. Die kannten mich offensichtlich nicht wirklich und trauten mir auch nicht besonders viel zu. Das lag sicher daran, dass ich meinen Traum, Ärztin zu werden, eher für mich gelebt habe.
Den Abiball besuchte ich nicht, das war mir eher lästig. Außerdem hatten wir zu der Zeit viele familiäre Dinge um die Ohren: Mein Bruder Ünal plante in der Türkei seine Hochzeit. Und meine Mutter fühlte sich dafür verantwortlich, dass alles gut über die Bühne ging. Das war ihr wichtig, nahm sie aber auch sehr in Anspruch. Ich erinnere mich gut daran, dass sie damals großen Stress erlebte, der ihr auch auf Körper und Seele schlug. Und so entschied ich mich bewusst für no more drama, um meiner Mutter nicht noch mehr Stress zu bereiten.