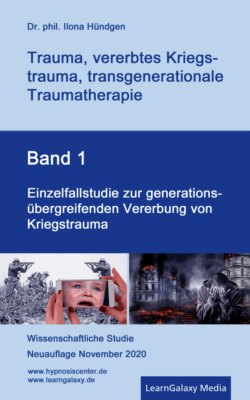Читать книгу Einzelfallstudie zur generationsübergreifenden Vererbung von Kriegstrauma - Dr. phil. Ilona Hündgen - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2. Ziele, Leitfragen, Definitionen
2.1 Ziele, Leitfragen, Themeneingrenzung
In dieser Arbeit soll im Rahmen einer Einzelfallanalyse untersucht werden, ob und mit welchen Folgen die schwer kriegstraumatisierten Eltern meiner Probandin Frau A. ihre traumatischen Belastungen indirekt-transgenerational an meine Probandin weitergegeben haben könnten. Insgesamt möchte ich mit der vorliegenden Arbeit auf der Grundlage von Forschungsliteratur und eines eigenen Praxis- bzw. Fallbeispiels (s. Kap. 4) allgemein für typische Aspekte transgenerationaler Kriegstraumatisierung sensibilisieren. Hierbei geht es nicht um Vollständigkeit des Dargestellten. Nachrangig sind zudem die beiden folgenden Fragestellungen leitend: Anhand welcher typischer Merkmale lässt sich möglicherweise transgenerationale Kriegstraumatisierung bei meiner Probandin erkennen? Welche Implikationen für Traumatherapie ergeben sich daraus? Formen sekundärer Traumatisierung, die nicht transgenerational sind, z.B. Traumatisierung von Hilfspersonal wie Therapeuten und Entwicklungshelfer (Daniels, Rixe 2017, Rießinger, Wolf 2018, Sänger 2013. S. 145 f., Rössel-Čunovič), sind in dieser Arbeit nicht berücksichtigt. Da die vorliegende Arbeit maximal 25 Seiten lang sein darf, kann ich den aktuellen Forschungsstand nicht ausführlich darstellen, sondern nenne maßgebliche Autoren im Text.
2.2 Methodik, Forschungsdesign, Durchführung
Die vorliegende Facharbeit ist eine qualitative literaturanalytische Arbeit mit empirisch-investigativer deduktiver Komponente.
Die typischen Aspekte transgenerationaler Kriegstraumatisierung werden exemplarisch auf der Grundlage von Forschungsliteratur erarbeitet. Dann wird geprüft, ob sich Symptome und auffällige Verhaltensmerkmale meiner Probandin, die möglicherweise durch Kriegstraumatisierung (mit)verursacht sein könnten, diesen typischen Aspekten zuordnen lassen (Deduktion).
Die empirischen Daten beziehe ich aus einem ausführlichen initialen Interview mit meiner Probandin, aus weiteren Gesprächen, aus Beobachtungen im Rahmen meines 178,5-stündigen beruflichen Coachings mit der Probandin sowie aus einer Befragung der Eltern von Frau A. Auf dieser Grundlage stelle ich Hypothesen darüber auf, ob und in welcher Hinsicht bei meiner Probandin transgenerationale Kriegstraumatisierung vorliegen könnte.
Für die vorliegende Arbeit wurde vom Ausbildungsinstitut lediglich eine einzige Befragung der Probandin, z.B. anhand eines Leitinterviews, empfohlen. Alle weiteren Leistungen, auch das 178,5-stündige Berufscoaching, wurden von mir unabhängig von dieser Abschlussarbeit erbracht. Für diese Studie wird aufgrund der geringen Anzahl der Probanden keine wissenschaftliche Relevanz beansprucht. Dennoch verstehe ich die vorliegende Einzelfallanalyse als einen grundlegenden Beitrag zur Beforschung von transgenerationaler Kriegstraumatisierung.
Sowohl meine Probandin als auch eines ihrer Geschwister (Kontrollproband, s. Kap. 2.3) füllten zunächst meinen 48-seitigen Anamnese-Fragebogen aus. Anschließend befragte ich beide mündlich mittels meines Leitinterviews zur transgenerationalen Kriegstraumatisierung (s. Kap. 8.1). Zu einem späteren Zeitpunkt befragte ich beide Eltern der Probandin mündlich anhand des Elternfragebogens (s. Kap. 8.2).
Coachingbegleitend führte ich auf Wunsch von Frau A. mehrere Hypnosesitzungen mit dem Schwerpunkt „Ressourcenaktivierung“ durch. Diese Hypnosen sollten dazu dienen, die zeitnah anstehenden Prüfungen sicherer und entspannter zu bestehen. In diesen Hypnosen wurden aufgrund der laufenden Prüfungsvorbereitungen mit nahen Deadlines keinerlei kriegsbezogene Themen bearbeitet.
Zur Absicherung meiner Hypothesen zu einer möglichen transgenerationalen Kriegstraumatisierung meiner Probandin führte ich im Einvernehmen mit der Probandin mit professionellen Kollegen systemische Aufstellungen durch (Supervision). Diese Aufstellungen bestärkten mich in der Annahme, dass bei meiner Probandin direkte Kriegstraumatisierung und indirekt-transgenerationale Kriegstraumatisierung eine Rolle spielten und dass beides die Probandin erheblich schwächte: als Folge von direkter Kriegstraumatisierung zeigten sich in den Aufstellungen verstärkt psychosomatische Symptome, während der Klientin bei räumlicher Annäherung an ihre kriegstraumatisierten Eltern „der Boden unter den Füßen weggezogen“ wurde.
Zudem stellte meine Probandin eine Skulptur auf. Hier erhielt sie die Gelegenheit, an der Beziehung zu ihren Eltern zu arbeiten und Belastungen zurückzugeben.
2.3 Probandenauswahl
Frau A. wuchs im Krieg in einer schwer kriegstraumatisierten Familie auf und flüchtete im Kindesalter unter lebensgefährlichen Bedingungen mit ihrer Mutter und mit Geschwistern nach Deutschland.
Dass meine Probandin während der ersten Lebensjahre tagtäglich direkt den Krieg miterlebte, stellt in der vorliegenden Arbeit einen Störfaktor dar, da nur indirekt-transgenerationale Kriegstraumatisierung untersucht werden soll. Idealer Proband für meine Studie wäre eine Person gewesen, die selbst gar keine direkte Kriegstraumatisierung miterlebt hat, sondern nur durch ihre kriegstraumatisierten Eltern möglicherweise indirekt-transgenerational traumatisiert wurde.
Eines der Geschwister von Frau A. ist in dieser Studie KontrolIproband. Dieses Geschwister erlebte den Krieg im Heimatland einige Jahre länger mit. Es weist nach Angaben meiner Probandin in zahlreichen Punkten vergleichbare, aber deutlich stärkere Symptome als meine Probandin auf. Da ich jedoch einen Probanden suchte, der möglichst wenig direkt kriegstraumatisiert war und zuverlässig an der Studie teilnahm, war Frau A. als Probandin für meine Studie besser geeignet als mein Kontrollproband.
Alle Mitglieder der Familie meiner Probandin, die ich persönlich kennenlernen durfte und die in etwa gleich alt oder älter als meine Probandin sind, gaben an, direkt vom Krieg traumatisiert zu sein und viele Tote gesehen zu haben.
2.4 Definitionen
„Direkte Kriegstraumatisierung“ ist das Auftreten von Psychotraumata durch direktes Erleben von kriegsbezogenen Ereignissen bei einer Person, die als direkt Betroffener oder als anwesender, direkter Zeuge (z.B. Augenzeuge) eigene sinnliche Wahrnehmungen vom ursprünglich traumatisierenden Geschehen hat und die, falls Erinnerung an das Geschehen besteht, diese Wahrnehmung als selbst (mit)erlebtes Geschehen bekunden kann (vgl. juraschema.de 2020; educalingo.com 2020; Siegismund 2009, S. 4; Wikipedia: Zeuge; Baer 2000).
„Transgenerationale Kriegstraumatisierung“ ist demgegenüber, als eine Unterform der transgenerationalen Traumatisierung, immer indirekt (vgl. Wolf 2018-2, Feuervogel). Bei der transgenerationalen Kriegstraumatisierung sind die traumatisierten Nachkommen weder direkt betroffen noch direkte Zeugen. Sie haben keine eigenen Wahrnehmungen vom ursprünglichen traumatisierenden Ereignis - das ja nicht ihnen, sondern ihren Vorfahren widerfahren war – und können die Vorfälle deshalb weder erinnern noch als selbst (mit)erlebtes Geschehen bekunden.
Transgenerationale Kriegstraumatisierung kann, wie jede Form der transgenerationalen Traumatisierung (Richter 1963, Richter 1972), im Rahmen von Erziehung und Sozialisation in konkreter Interaktion und epigenetisch von den Vorfahren erworben werden. Hierbei können die Vorfahren direkt und/oder indirekt traumatisiert sein.
Aufgrund des limitierten Umfangs dieser Arbeit kann ich, bis auf das nachfolgende kurze Beispiel, auf den Themenbereich „Epigenetik“ nicht näher eingehen. Epigenetische Forschungsarbeiten (Bauer 2013, Lingrön 2015, Lipton 2016, Huber 2017, Döll, 2017, Spork 2017, Henn 2017, Kegel 2018, Lehnert 2018, Schickedanz 2012, S. 71-76, Wikipedia: Epigenetik) zeigen, dass traumatische Verletzungen auch über die Gene an Folgegenerationen weitergegeben werden können. Hierbei bleibt das Genom als solches unverändert. Die epigenetischen Kontrollmechanismen bestimmen nicht die DNA-Sequenzen und somit nicht die grundlegende Programmierung durch die Gene, sondern die Lesbarkeit der vorhandenen Gene. Die Vererbung erfolgt auf molekularer Ebene in Form von DNA-Methylierung, einer Modifikation von Histonen und/oder im beschleunigten Abbau von Telomeren. Epigenetische Veränderungen beeinflussen nur den Phänotypen, nicht den Genotypen eines Menschen (ebenda).
Kriegsbedingte Stress- und Hungererlebnisse der Vorfahren können sich – eigentlich zum Schutz der Nachfahren – epigenetisch z.B. so in den Genen der Nachfahren niederschlagen, dass die Nachfahren kleiner und somit bei Nahrungsmangel überlebensfähiger sind, eine bessere Fett- und Zuckerverwertung haben und durch einen dauerhaft höheren Cortisolspiegel zumindest mittelfristig stressresistenter und aufmerksamer für Gefahren sind (s. Lauff 2017). In Friedenszeiten kann dies jedoch für die Nachfahren von Nachteil sein: bei den Nachfahren können bereits bei normaler Ernährung durch die bessere Fett- und Zuckerverwertung Übergewichtsprobleme entstehen, und ein ererbter höherer Cortisolspiegel kann durch chronische vegetative Übererregung zahlreiche psychosomatische Krankheitsfolgen haben.