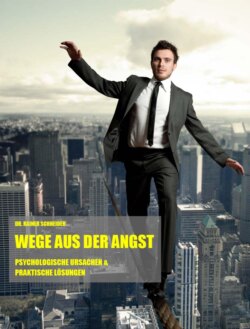Читать книгу Wege aus der Angst. Psychologische Ursachen und praktische Lösungen - Dr. Rainer Schneider - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Messer, Gabel, Scher‘ und Licht…
ОглавлениеLassen Sie uns damit anfangen, in welcher Hinsicht Angst mindestens genauso wichtig ist wie z.B. Freude. Viele Psychologen sind der Meinung, dass negative Affekte, und damit auch Angst, größeren Informationswert haben als positive. Wohlgemerkt: Es geht hierbei nicht um die Quantität der Emotionen an sich und auch nicht darum, welche Emotionen im Sinne einer Gesamtbilanz in eines Menschen Leben überwiegen sollten, damit dieser erfüllt, glücklich und zufrieden ist.
Es geht um das Potenzial dessen, was Emotionen uns über unsere Umwelt lehren. Also: Warum sollen negative Affekte größeren Informationswert haben? Die Antwort ist im einleitenden Kapitel bereits angeklungen. Die durch den negativen Affekt angezeigte Gefahr lehrt uns, einer bestimmten, möglicherweise schädlichen Situation aus dem Weg zu gehen. Angst kann somit Überlebenswert haben. Belohnungen hingegen haben selten Überlebenswert. Sie zeigen höchstens an, dass man sich einem Reiz vertrauensvoll nähern kann, weil er Lust spendet. Etwas überspitzt formuliert könnte man sagen, die Angst vor der Peitsche ist lehrreicher als die Lust auf das Zuckerbrot.
In der Fachsprache drückt man das so aus: Negativer Affekt hat eine höhere Anregungsschwelle als positiver (1). Damit ist gemeint, dass man zwar schneller auf Belohnung anspricht als auf Bestrafung. Aber man ist länger und nachhaltiger motiviert, einer Bestrafung zu entgehen. Das schlägt sich auch in unseren Alltagserfahrungen nieder. Ein Ereignis oder ein Reiz, der ängstigt, bleibt länger in Erinnerung. In der Regel kann man sich deshalb lebhafter an ganz bestimmte negative Ereignisse erinnern als an positive. Probieren Sie es mal bei sich selbst aus. Nennen Sie so schnell wie möglich drei äußerst negative, angstbesetze Ereignisse aus Ihrem Leben und dann drei positive, belohnende. Welche fallen ihnen schneller ein? Oder noch besser: Welche haben sie klarer vor Ihrem geistigen Auge?
Die Vehemenz angstbezogener Ereignisse deutet der Titel dieses Kapitels: Viele Ängste werden erlernt, so z.B. die Angst vor den Grundelementen oder vor bestimmten Gegenständen. Sobald man sich einmal die Finger verbrannt oder in dieselben geschnitten hat, wird einen die Angst vor Versehrtheit schützen, sich noch einmal in eine ähnliche Gefahr zu begeben. Man wird vorsichtiger. Solche Ängste übertragen sich auf verschiedene Situationen. Wir generalisieren Angst und lernen dabei gleichzeitig, ihr auszuweichen, zumindest wenn wir das können. Die Generalisierung kann Fluch oder Segen sein, wie wir später noch sehen werden. Zunächst einmal kann man aber feststellen, dass Ängste an sich Gefahr oder Verlust signalisieren, psychisch wie physisch.
Nun gibt es elementare bzw. rudimentäre Ängste, z.B. vor Feuer und sozial erlernte. Die erlernten sind jedoch keineswegs immer logisch oder rational. Manche sind sogar ausgesprochen irrational. Nehmen Sie z.B. das Autofahren. Kennen Sie jemanden, der Angst vor dem Autofahren hat? Ich persönlich habe erst einen Menschen kennengelernt, der sich kaum in ein Auto traute. Dabei wäre diese Angst durchaus rational. Wir haben erstaunlich viel Vertrauen in eine vermeintliche Sicherheit, die sich nur allzu oft als Scheinsicherheit herausstellt. Mit 180 Sachen über dicht befahrene Straßen zu rasen, ist eigentlich gruselig.
Wie gefährlich Autofahren bzw. der Straßenverkehr ist, zeigen Statistiken (15). Im Jahr 2011 starben z.B. alleine im deutschen Straßenverkehr durchschnittlich 11 Menschen pro Tag (darin eingeschlossen sind allerdings auch Rad- und Kraftradfahrer). Gemessen an der Zahl der Verkehrsteilnehmer insgesamt klingt das nicht nach so viel. Aber leichte und schwere Verkehrsunfälle sind ja um ein Vielfaches höher, was nur zeigt, wie unsicher das Autofahren eigentlich ist. Nun ist die Wahrscheinlichkeit, im Straßenverkehr zu Tode zu kommen, um ein Vielfaches höher als im Flugzeug zu reisen. Flugangst ist aber wiederum ein ziemlich verbreitetes Phänomen. Hier wieder ein Zahlenbeispiel: Weltweit (!) ließen im gleichen Jahr pro Tag etwa zehn Mal weniger Menschen ihr Leben als beim Autofahren.
Laut Schätzungen leiden etwa zehn Prozent der Flugängste unter Flugangst (Aviophobie). Die tatsächliche Rate ist wohl höher, denn viele Menschen meiden das Flugzeug ganz und steigen wenn möglich auf ein anderes Verkehrsmittel um. Man könnte argumentieren, dass fliegen den Menschen wesentlich unnatürlicher ist als fahren. Das mag so sein und es gäbe sicherlich noch weitere Gründe, warum sich diese beiden Ängste so unterschiedlich ausbilden; wir brauchen das an dieser Stelle nicht zu vertiefen. Worauf ich hinaus will, ist folgendes: Gemessen an der Wahrscheinlichkeit einer Gefahr, bewegen wir uns relativ angstfrei auf deutschen Straßen; eine Autophobie entwickeln wir nicht.
Es geht in diesem E-Book nicht um Flugangst. Ich will auf etwas anderes hinaus: Angst ist eine Emotion, die zwar rational begründet oder erklärt, oft jedoch unbewusst (genauer: implizit) gelernt oder erzeugt wird. Diese Erfahrung machen viele Menschen, wenn sie versuchen, sich (irrationale) Ängste auszureden. Das funktioniert nämlich nur bedingt. Dafür gibt es neurobiologische Gründe. Angst wird als Emotion erst erkannt, wenn die angstbezogenen körperlichen Symptome bereits weitreichend eingetreten sind (16). Die vielfältigen körperlichen Prozesse kommen in Gang, ohne dass man dabei großartig etwas ändern könnte. Das Bewusstsein kommt sozusagen zu spät und das Denken setzt erst ein, wenn die angstspezifischen Symptome durch die neurologische/körperliche Schleife bereits aktiviert wurden.
Deswegen kann man sich Angst nur bedingt ausreden. Zumindest, wenn die rationalen Prozesse nicht an die emotionalen und psychovegetativen angeschlossen sind (ich werde das in einem späteren Kapitel vertiefen). Es kann hilfreich sein, dass genauer zu verstehen. Hirnbiologisch entstehen Ängste in einer Region, der Amygdala (siehe Abbildung 1), die älter ist als jene, mit der wir auf unsere Umwelt willentlich einwirken (präfrontaler Kortex). Wenn Sie so wollen, ist Angst ein unbewusstes Alarmsystem, eine Art Wahrnehmungsreflex. Sie lässt uns handeln, ohne dass wir lange nachdenken, ob, warum und wie wir handeln. Im Grunde ist das eine ziemlich kluge und geschickte Einrichtung: Stellen Sie sich einmal vor, Sie müssten in jeder gefährlichen Situation sorgfältig Für und Wider abwägen, welche Handlungsalternative denn nun die beste sei. In einer bedrohlichen Lebensumwelt konnten sich unsere Vorfahren diesen Luxus nicht leisten. Wir wären längst ausgestorben.
Abbildung 1: Neuroanatomische Darstellung der Amygdala
Aus diesem Sachverhalt ergibt sich, dass Angst unmittelbar und automatisch erlernt wird. Manchmal reicht eine einzige negative Erfahrung aus, um eine Angstreaktion auszubilden. Das geht über einfache Lernmechanismen wie dem klassischen oder operanten Konditionieren. Nehmen wir als Beispiel die Zahnarztangst (Dentophobie), die relativ weit verbreitet ist. Hier genügt manchmal schon eine einzige negative Lernerfahrung, etwa eine unangenehme Wurzelbehandlung, um eine hartnäckige Vermeidungsreaktion auszubilden. An sich neutrale Reize, wie z.B. der Geruch der Zahnarztpraxis oder das Geräusch eines Bohrers, werden mit dem aversiven Reiz, dem Schmerz, verknüpft, und lösen so die Angstreaktion aus (klassische Konditionierung). Dabei spielt es keine Rolle, ob vor der Konditionierung durchweg positive Erfahrungen gemacht wurden. Evolutionsbiologisch kann sich das keine Spezies leisten. Eine Gefahr ist eine Gefahr.
Eine andere Form des Angstlernens vollzieht sich über operantes Konditionieren, also über das Lernen anhand von Konsequenzen. Wer z.B. beim Streicheln eines Hundes gebissen wird, wird diese negative Erfahrung so schnell nicht los und macht möglicherweise um eine bestimmte Hunderasse (oder gar alle Hunde) fortan einen großen Bogen. Er entwickelt also eine Hundephobie (Canophobie).
Wie auch immer eine Angstreaktion entsteht, sie ist in den meisten Fällen relativ löschungsresistent. Es braucht seine Zeit, bis sie wieder verlernt wird. Das Verlernen geht über alternative Reiz-Reaktions-Verknüpfungen, beim klassischen Konditionieren also dadurch, dass z.B. Schmerzen beim Zahnarzt ausbleiben (was in Abhängigkeit des Zahnstatus bzw. der Ernährungsgewohnheiten auch länger dauern kann) und beim operanten Konditionieren dadurch, dass man nur Hunden begegnet, die definitiv nicht beißen (was u.U. leichter zu bewerkstelligen ist). Man muss also erst wieder gegenteilige Erfahrungen machen, die dem Reiz seinen bedrohlichen Charakter nehmen. Angstphänomene sind jedoch durchaus komplex, so dass einfaches Löschen u.U. alleine nicht ausreicht, sich der Angst wieder zu entledigen. Ich werde bei der Besprechung der verschiedenen Formen von Angst darauf näher eingehen.
Ängste werden nicht nur gelernt, sie werden auch vermittelt. Beim sogenannten stellvertretenden Lernen genügt allein die Beobachtung einer negativen Erfahrung einer anderen Person, um selbst eine Angstreaktion auszubilden. In der Psychologie nennt man diesen Mechanismus Beobachtung- oder Modelllernen. Im Falle der Angst könnte man ihn auch Angstinduktion durch Antizipation nennen. Entscheidend ist natürlich, dass man bestimmte logische Bedingungen bzw. Gesetzmäßigkeiten für sich selbst auch an- bzw. übernimmt. Es ist z.B. gar nicht so selten, dass Kinder Ängste ihrer Eltern übernehmen, denn diese sind ja Rollenvorbild und Schutzperson in einem. So überträgt sich Angst, auch wenn das nicht beabsichtigt wird. Diese Übertragung (Induktion) ist auch kulturell Normen unterworfen.
Ängste werden auch tradiert. Viele US-Amerikaner haben z.B. eine geradezu manische Angst vor Ansteckung durch Keime, Viren und Bakterien (17). Sie setzen sie nach jedem Kontakt mit Gegenständen oder Menschen ein. Überall wird ein böser Keim, eine hinterhältige Bakterie oder ein fieses Virus vermutet. Das Böse ist quasi immer und überall. Dass diese Angst sehr suggestibel für allerlei sinnlose Schutzmaßnahmen macht, können Sie sich leicht denken. Und das ist gleichzeitig auch ein Hauptgrund dafür, warum unser stammesgeschichtliches Erbe der Steinzeitangst uns als Neuzeitmenschen oft ein Bein stellen kann: Mehr und mehr Ängste sind nicht mehr konkret greifbar, sondern werden zunehmend abstrakt: Arbeitsplatzverlust statt Säbelzahntiger, Ehekrise statt Waldbrand.
Es handelt sich hierbei um eine weit verbreitete Form von Angst: Die Angst durch rationale Vermittlung über (Miss)Information. Was meine ich damit?
Im heutigen Informationszeitalter werden wir von Geschehnissen aus zweiter Hand geradezu überflutet. Wie wir die Welt sehen, was wir von ihr erwarten und wie wir uns auf sie einstellen sollen, überlassen wir Medien, der Politik und Meinungsmachern. Da sich verständlicherweise die meisten Menschen um ihre Gesundheit, ihre Nachkommen, Frieden und Wohlstand usw. sorgen, wird ihre Gefühlswelt maßgeblich davon beeinflusst, welche Informationsquellen auf sie einströmen. Dass Information Angst macht, hat jeder schon selbst erfahren. Allerdings ist es schwer, genau zu entscheiden, ob für diese Angst immer auch ein echter Anlass besteht. Zum Beispiel stehen nicht hinter jeder politischen Kampagne Schutz oder Bedürfnis des Bürgers. Vielmehr schüren Entscheidungsträger Ängste, die bestimmten kommerziellen Zielen dienen, die nicht mit den propagierten angstauslösenden Ursachen in Zusammenhang stehen.
Es wird sie vielleicht verwundern, warum ich an dieser Stelle in diese scheinbar unpassende und populistisch anmutende Diskussion eintrete.
Lassen Sie es mich erklären. Ich halte Angst durch rationale Vermittlung für sehr wichtig, denn gerade das soziokulturelle Umfeld trägt dazu bei, welche Ängste in einer Gesellschaft aufrechterhalten werden. Außerdem nimmt sie eher zu als ab und viele Menschen wissen erstens nicht, dass es sie gibt und zweitens, wie sie sie abstellen sollen.
Ich möchte das an einem kleinen Beispiel erläutern. Laut WHO erkranken jährlich weltweit etwa 1 Milliarde Menschen an Influenza. Davon verlaufen 500.000 tödlich; im Schnitt stirbt also jede Minute ca. 1 Mensch (18). Man nennt das Influenza-„Grundrauschen“, das normale Maß an erregerbedingten Erkrankungen.
Im Jahre 2009 meldeten Ende April über 50 DPA-Meldungen vierzig bestätigte Fälle einer anscheinend äußerst aggressiven Schweinegrippe, die sich laut Vorhersagen unkontrolliert ausbreiten würde. Doch schon einen Tag später gab die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC (Center for Disease Control) Entwarnung. Obwohl die Weltgesundheitsorganisation WHO von einer Pandemie sprach und die Stufe von 4 auf 5 erhöhte, meldete sie zeitgleich einen Rückgang der Fälle. Das verwundert insofern, als sich jede Seuche zunächst ja einmal ausbreiten muss, um überhaupt als Pandemie zu gelten. In den USA waren zu diesem Zeitpunkt lediglich 149 bestätigte Schweinegrippe-Fälle registriert, davon einer tödlich.
Postwendend wurden 1,5 Millionen Dollar für die Produktion des inzwischen berühmt berüchtigten Impfstoffes Tamiflu® bereit gestellt, dessen Produktionsmonopol beim Patentinhaber Roche lag. Bemerkenswert war, dass die Sterberate mit Einführung des ungeprüften (!) Testsystems mit Zunahme der Länder, die es einsetzten, umgekehrt proportional sank. Obwohl also immer mehr Tests eingesetzt wurden, sanken die Raten der Erkrankungen immer weiter. Dessen ungeachtet erhöhte die WHO die Pandemiestufe im Juni 2009 sogar auf 6, verkündete aber gleichwohl, dass die Todesfolgen als sehr gering einzustufen wären (19).
Worauf ich hinaus will: Obwohl also bei einem Influenza-Grundrauschen alleine pro Tag 2,7 Millionen Neuerkrankungen zu erwarten sind, belief sich die Zahl der Erkrankungen an der Schweinegrippe auf gerade einmal 500 pro Tag. Die „Pandemie“ hingegen hielt nur ganze zwei Monate an, ohne dass dabei die Zahl der Erkrankungen durch die Behandlung mit dem Impfstoff sank, die Gensequenz des Virus sauber isoliert oder dessen Ansteckung eindeutig nachgewiesen worden wäre.
Vor einiger Zeit hatte ich zu diesem Thema eine amüsante Foto-Persiflage im Internet gefunden, die das Thema sehr treffend auf den Punkt brachte. Auf dem Boden lag, etwas melodramatisch dargestellt, der dahin geschiedene Frosch aus der Sesamstraße Kermit. Darunter folgender Titel: „Internationaler Schauspieler stirbt an Schweinegrippe, und wir wissen ALLE, wer ihn angesteckt hat“.
Aber das Thema ist natürlich ernst, zumindest hinsichtlich seiner eigentlichen Implikationen. Die durch Gesundheitsbehörden, Politik und Medien induzierte Angst sorgte bei den Menschen erwartungsgemäß für Angst und für einen entsprechenden Vorbeugungsreflex, den sich die Pharmaindustrie zusätzlich über Steuergelder und Krankenkassenbeiträge fürstlich entlohnen ließ. Die erfundene Pandemie hat sich inzwischen als Skandal entpuppt und die Verantwortlichen stehen in beträchtlicher Erklärungsnot (20). Inwieweit die Bürger allerdings nicht schon wieder das nächste Killer-Virus als nächste Panikmache vorgegaukelt wird, ist wohl nur eine Frage der Zeit. Wie viele sich dann wieder Angst machen lassen, ist eine weitere spannende Frage.
Das ist kein Einzelbeispiel und nicht nur auf das Gesundheitswesen beschränkt. Aber gerade Kritiker des Gesundheitswesens beklagen eine zunehmend profitorientierte Medizin, die in Koalition mit der Pharmaindustrie Angst als Werbe- und Druckmittel einsetzt (21, 22). Das machen sich auch andere Wirtschaftszweige zunutze, so z.B. die Versicherungsbranche. Sie ängstigt mit Altersarmut, drohenden Sach- und Personenschäden, möglichem Verlust oder möglicher Haftung. Und sie verspricht, diese Angst zu nehmen, und zwar durch den Abschluss entsprechender Policen.
Fast überall wird mit Ängsten gutes Geld verdient. Je größer die Endzeitstimmung, desto besser. Am Beispiel Klimawandel lässt sich besonders schön zeigen, wie sehr Politik, Publizistik, Industrie und Kartelle zusammenarbeiten, um Ängste zu schüren und die Konsumhaltung in der Bevölkerung in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen. Andererseits werden klimawirksame Manipulationen, die echtes Angstpotential haben und in der Bevölkerung bei Kenntnis heftige Reaktionen auslösen würden, kleingeredet oder geleugnet. Wenige unabhängige Fachleute, die echte Aufklärung betreiben, werden entweder belächelt, verunglimpft oder bekämpft (23-25).
Das bei vielen ThemaMachen Sie selbst einmal den Test. Ein Blick in die Tageszeitung genügt.
Sie verstehen jetzt, warum ich (rational) vermittelte Angst für so problematisch halte. Unsere Gefühle werden über den gesunden Menschenverstand angesprochen und die einzig gangbare Lösung der Angst wird automatisch mitgeliefert. Ich behaupte nicht, dass die Menschen es nicht besser wüssten. Bekanntlich ist man hinterher ja immer schlauer. Aber das Paradoxe an der vermittelten Angst ist, dass uns die Entscheidung, die wir treffen, zwar rational vorkommt. Tatsächlich wird sie aber emotional kurzgeschlossen.
Wirtschaft- und Finanzkrisen, Klimakrisen, Existenzkrisen – Wer würde da keine Angst bekommen? Eine Welt, die immer bedrohlicher und ungewisser erscheint, lässt kaum noch angstfreie Fluchtorte. Wir leben in einer Zeit, in der Unsicherheit das konstituierende Element des Lebens geworden ist. Es verwundert nicht, wenn vor diesem Hintergrund Angststörungen zunehmen. Unsicherheit ist einer der größten Stressoren, den es gibt. Sie ist verbunden mit der Unmöglichkeit, gezielt zu planen und zu handeln. Klassischerweise fasst man unter Angststörungen nicht notwendigerweise Angst vor Krieg, Inflation, Krankheit etc. zusammen, zumindest dann nicht, wenn für sie eine scheinbar objektive Grundlage zu bestehen scheint (Stichwort Schweinegrippe). Aber diese Ängste können ein Fundament bilden, auf dem typische Angststörungen aufbauen.
Und vielleicht sind die Deutschen besonders anfällig für Angst. Wir machen uns z.B. mehr Sorgen bei Familien- oder Zukunftsplanung als andere Völker (26). Im anglo-sächsischen Sprachraum hat man den Begriff Angst inzwischen als eigenständigen Begriff aufgenommen und bezeichnet damit eigentlich das, was man im Deutschen als Panik oder Agonie (Todesangst) bezeichnet.
Damit Sie mich nicht falsch verstehen: Ich will Ängste nicht trivialisieren oder lächerlich machen. Auch sage ich nicht, dass es keine lebensbedrohliche Krisen und Krankheiten gibt oder diese nur eine Verschwörung bestimmter Eliten sind.
Aber Angst vor Krisen und Krankheiten löst in uns ganz elementare Schutzmechanismen aus, die dazu dienen, Leib und Leben zu retten. Angst, die darauf beruht, macht verständlicherweise manipulierbar und so verwundert nicht, dass es Kräfte gibt, die daraus Profit schlagen, sei es finanziell, politisch, religiös oder ideell. Das inzwischen fast schon beflügelte Wort des Geschäfts mit der Angst ist eines der einträglichsten überhaupt. Die Umsätze im Gesundheits(un)wesen sind schwindelerregend, vor allem auch deshalb, weil sich beim Bekämpfen von „Problemen“ riesige Interessenlobbies etabliert haben, die unzählige Billionen an Umsätzen und Gewinnen erzielen.
Allerdings ist diese Angst gewissermaßen ein Artefakt, also ein Kunstprodukt. Wie soll man sie bewältigen, wenn ihre Auslöser eigentlich nicht existent sind oder zumindest bei weitem nicht von der behaupteten Tragweite? Aus meiner Sicht helfen nur zwei Dinge, sich gegen solche Ängste zu immunisieren: Erstens Aufklärung, zweitens Gelassenheit. Letzteres kommt mit ersterem. Gelassenheit kommt mit Wissen. Es lohnt sich z.B., selbst einmal zu recherchieren, wie es um bestimmte Gefahren wirklich steht, die einem vorgegaukelt werden. Alternative, unabhängige und nicht profitorientierte Informationsquellen können wahre Wunder wirken, bestimmte Ängste zu zerstreuen. Hier bietet das Internet (noch) die Möglichkeit, unmanipulierte Informationsquellen zu finden. Eine (Auf)Klärung durch die Massenmedien ist leider nicht zu erwarten, weil sie weder wirklich unabhängig sind, noch investigativ arbeiten (27).
Der vernünftige Umgang mit der Angstquelle ist somit ein erster Schritt, der helfen kann, Ängste in den richtigen Zusammenhang zu stellen. Das geht alleine dadurch, dass man die betreffenden Sachverhalte relativiert. Hat man sich erst einmal klargemacht, wie groß eine bestimmte Wahrscheinlichkeit ist, dass diese oder jene Gefahr wirklich besteht, verliert die Angst schnell einen Großteil ihres Potentials. Bekanntlich macht ja gerade Alternativlosigkeit besonders Angst (und diese Vokabel wird auch gerne in der Politik genutzt). Alternativlosigkeit heißt, etwas nicht vermeiden zu können. Damit wird der eine propagierte Lösungsweg zum Königsweg; alle anderen müssen zwangsläufig ins Verderben führen. Das ist der psychologische Trick hinter dieser Form der Angstinduktion, gleichzeitig aber auch die Lösung. Alternativen geben Handlungsfreiheit und diese reduziert Angst!
Es lohnt sich, einmal genauer hinzuschauen, warum solche „diffusen“ Ängste in Stärke und Ausmaß immer mehr zunehmen. Eine Umwelt voller Gefahren muss irgendwann dazu führen, dass die Welt nur noch durch die Angstbrille wahrgenommen wird. Hier ist die Schweinegrippe wieder ein gutes Beispiel. Ein tödliches, sich schnell und vermeintlich unkontrollierbar ausbreitendes Virus eignet sich sehr gut, vor allem tendenziell ängstliche Menschen auf Angst zu primen. Sogenannte Primes sind vorgeschaltete Reize, die die Wahrnehmung verändern. Und Primes sind sehr wirkmächtig. In Experimenten macht man das so: Man bietet Personen z.B. einen negativen Prime-Reiz dar, bevor eine sonst neutrale Information verarbeitet werden soll. So ein negatives Prime-Wort kann z.B. das Wort traurig sein. Die meisten Personen beurteilen dann diese an sich neutrale Information prompt eher negativ. Dieser Mechanismus kann sich innerhalb weniger Millisekunden abspielen, sogar unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Ohne es zu merken, ändern Primes die Bedeutung des Wahrgenommenen (28).
Sie werden sich vielleicht immer noch fragen, warum ich so relativ ausführlich auf induzierte Ängste eingehe. Gehören Sie überhaupt in einen Angstratgeber? Möglicherweise plagen Sie ganz persönlich völlig andere, gleichsam „echte“ Ängste.
Man kann natürlich unterschiedliche Angstformen unterscheiden. Angst vor öffentlichen Orten fühlt sich anders an als Angst beim Schauen von Gruselfilmen. Ich habe jedoch bereits darauf verwiesen, dass verschiedene Ängste zumindest neurobiologisch gesehen identisch sind: Sie entstehen in den gleichen Hirnarealen, involvieren die gleichen Neurotransmitter, die gleichen Synapsen und haben die gleichen Erregungsmuster. Weil das so ist, kann man z.B. Angstreaktionen künstlich verlängern, wenn man Personen experimentell bestimme Substanzen gibt, die die Ausschüttung von Neurotransmittern blockieren (Opiat-Antagonisten), die normalerweise Angst reduzieren (29).
Es geht in diesem Buch nicht um Angst vor Viren, Krieg, Not und dergleichen, jedenfalls nicht unmittelbar. Ich möchte zeigen, dass ein Perspektivenwechsel bei allen Ängsten helfen kann, diese in ihrer Wirkung zu relativieren. Selbst bei Panikattacken kann die sinnhafte Neudeutung einen gewissen Beitrag leisten, Angst zu reduzieren. Genau das machen manche psychotherapeutischen Schulen. Im Kern geht es eigentlich um Sinnstiftung, also darum, Emotionen und Erlebnisse so zu deuten, dass sie stimmig werden und nicht isoliert ihr angstauslösendes Potential entfalten. Im einleitenden Kapitel hatte ich das als Integration bezeichnet. Wie schon angedeutet, geht das nicht unbedingt über eine kognitive Umstrukturierung sensu Selbstüberzeugung. Emotionen kann man sich ja nicht einreden, man muss sie erleben und fühlen. Dazu später mehr. Klären wir zunächst einmal, warum Angst nicht unbedingt immer etwas mit Realität zu tun hat.