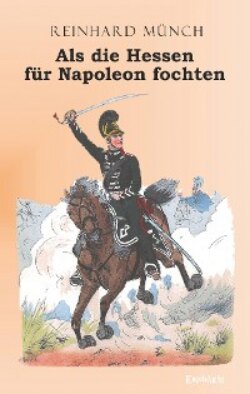Читать книгу Als die Hessen FÜR Napoleon fochten - Dr. Reinhard Münch - Страница 6
Ausflug in die Geschichte
ОглавлениеDie französische Revolution 1789, die darauf folgenden Revolutionskriege und die Napoleonischen Kriege hielten Europa in einem über zwanzig Jahre dauernden Kriegszustand. Hessen war mittendrin. Nach der territorialen Neugliederung der damaligen Landgrafschaft Hessen-Darmstadt durch den Reichsdeputationshauptschluss wurde 1806 das Großherzogtum Hessen mit etwa 600.000 Einwohnern gebildet. Hessen-Kassel wurde dem Königreich Westfalen einverleibt. Der Landgraf von Hessen-Darmstadt gehörte zu den ersten Unterzeichnern der Rheinbundakte vom 12. Juli 1806, die in Paris von seinem Gesandten Baron von Pappenheim beurkundet wurde. Mit diesem Beitritt in den Rheinbund vergrößerte sich das Gebiet von Hessen-Darmstadt.
Im Jahre 1803 war mit der Einführung einer Kriegsdienstpflicht die Voraussetzung zum Aufbau eines ständigen Militäraufgebots geschaffen worden. Das war der entscheidende Beitrag zur politischen Existenzsicherung im Bündnis mit Frankreich. Hessen war jetzt für Frankreich als Truppenlieferant interessant geworden. Das Großherzogtum stellte Napoleon 4.000 Mann, die sich auf je drei Infanterieregimenter, Artilleriekompanien und Füsilierbataillone sowie ein Chevaulegerregiment aufteilten. Folgerichtig waren die Hessen auf fast allen Kriegsschauplätzen der Napoleonischen Kriege zu finden: 1806/1807 gegen Preußen, 1809 gegen Österreich und 1808 bis 1812 in Spanien, 1812 im Russlandfeldzug und nochmals 1813 in Deutschland. Während all dieser Jahre zeichneten sich die hessisch-darmstädtischen Soldaten durch Treue und Tapferkeit aus. Den Artilleristen gelang es sogar, sämtliche Geschütze aus dem Russlandfeldzug wieder mit nach Darmstadt zu bringen. Nachdem sich die Verluste an hessischen Truppen während der Feldzüge 1806/1807 gegen Preußen und 1809 gegen Österreich noch in Grenzen gehalten hatten, war es in Spanien anders. Mit der Kapitulation der französisch besetzten Festung Badajoz in Spanien 1812, bei der sich ein hessisches Regiment vollständig in englische Gefangenschaft begeben musste, wurde damit sogar eine hessendarmstädtischer Truppe vollständig aufgerieben. Alle anderen Soldaten, die inzwischen unter Führung des jungen Prinzen Emil mit dem Kaiser nach Russland gezogen waren, ereilte im Winter 1812 ein ähnliches Schicksal.
Nach der Völkerschlacht trat Hessen aus dem Rheinbund aus und schloss sich den Verbündeten an. Diese forderten umgehend die Stellung von 8.000 Mann, je 4.000 Linientruppen und Landwehr.
Hessische Infanterie 1803-1807, Knötel
Diese rekrutierten sich aus Neuaushebungen, aus Depoteinheiten sowie Rückkehrern aus der kurzen Gefangenschaft nach der Leipziger Niederlage. Schon im Februar 1814 standen mit dem Leibgarde-Regiment und dem Garde-Füsilier-Regiment die ersten neu aufgefüllten Feldtruppen zur Verfügung. Außerdem wurden mit dem Regiment Prinz Emil, dem freiwilligen Jägerkorps und mit der Landwehr zusätzliche neue Einheiten errichtet. Neben einer kurzen Teilnahme an der Belagerung von Mainz und am Vormarsch nach Lyon im Jahre 1814 kam es aber nur zu einem Einsatz in einem Gefecht bei Straßburg am 28. Juni 1815.
Emil, Prinz von Hessen und bei Rhein, wurde der bekannteste Heerführer der Hessen. Geboren am 3. September 1790 war er der jüngste und vierte Sohn des Landgrafen Ludewig I. von Hessen. Er trat in die großherzogliche Armee ein, zunächst ohne Gelegenheit, sich im Felde zu bethätigen, aber für seine fernere militärische Ausbildung fleißig besorgt. 1809 focht Emil mit seinen Truppen gegen Österreich, dem Prinzen war es dadurch beschieden, im Hauptquartier Napoleon’s und unter dessen Augen in das Kriegshandwerk eingeführt zu werden. Er machte die Schlachten dieses Feldzuges mit und erwarb sich durch seinen Muth und seine Tapferkeit, sowie durch seinen richtigen Blick in hohem Grade die Aufmerksamkeit jenes großen Kenners militärischen Talents. Der Feldzug gegen Russland sah den Prinzen als Divisionskommandeur der hessischen Truppen.
Die hessischen Truppen gerieten in das ganze Elend des furchtbaren Rückzugs; unter den Überlebenden haben sich manche ergreifende Erzählungen von der Sorge des Prinzen für die Seinen in dieser Noth, wie von der Aufopferung dieser für ihren Führer erhalten; diese Zeit begründete die innige Anhänglichkeit zwischen ihm und den hessischen Soldaten und den hohen Einfluß, den er bis zu seinem Tode auf den Geist dieser Truppe geübt hat. 1813 erwarb sich Emil hohe Anerkennung besonders bei Großgörschen/Lützen und bei Leipzig. Unwahr aber, wie er selbst mit Unwillen erklärte, ist das Märchen, als hätte Napoleon ihm in einer dieser Schlachten durch einen Zuruf den preußischen Thron verheißen. Bleibtreu verarbeitete diese Legende wie folgt und fügte sie dem Augenblick an, als Napoleon am 16. Oktober den Sieg in der Völkerschlacht verkündete und den Befehl gab, dies öffentlich kund zu tun: „‚Die Welt dreht sich noch mal!’ Napoleon nahm leicht schmunzelnd eine Prise und beobachtete wohlgefällig, wie diese Eisenmasse über Wachau hinaus sich gegen Güldengossa wälzte. ‚Reiten Sie zum König von Sachsen’, fertigte er einen Flügeladjutanten ab, ‚man soll in Leipzig die Glocken läuten. Halt noch eins: Courier nach Paris schicken mit der Siegesbotschaft! Vorwärts, König von Preußen!’ gratulierte er neckisch seinem Günstling Emil von Hessen.“
Nach der Entscheidung der Leipziger Schlacht wurde er gefangen und als Kriegsgefangener nach Berlin geführt. Hier sei ebenfalls eine Erinnerung eingefügt: „Noch vor der Erstürmung des Hallischen Tores sammelte sich bei dem Zuchthause im Brühl ein beträchtliches Depot hessischer Truppen, stellte sich in Reih und Glied, und marschierte den Brühl hinauf bis an die Hallische Gasse; und schon erwarteten wir Kampf auf den Straßen, als etwa fünfzig preußische Jäger die Ritterstraße herunter nach dem Brühle zustürzten, und jene willig und mit sichtbarer Freude (so freudig werden sie nicht gewesen sein – Anmerkung R.M.) das Gewehr wegwarfen und sich ergaben. Alle in der Stadt befindlichen deutschen Truppen taten ein gleiches. Die Eindringlinge schwärmten durch alle Straßen und trieben überall ansehnliche Trupps von Gefangenen zusammen. Unter andern suchten die preußischen Jäger den Prinz Emil von Hessen-Darmstadt sehr eifrig, der, wie sie wussten, noch in der Stadt sein müsse. Sie suchten ihn in mehreren Gebäuden des Brühls, und brachten ihn auch nach einer halben Stunde zu Pferde den Brühl herunter die Ritterstraße herauf. Er hatte sich in einem Hause am Hallischen Pförtchen (heute überbaut von den Höfen am Brühl, in Höhe des Durchgangs zur Richard-Wagner-Straße) verborgen, war aber entdeckt und gefangen worden. Ein preußischer Jäger, der neben andern hinterher ging, trug des Prinzen Degen, hielt ihn in die Höhe und rief jubelnd: da ist der Prinz!“
Inzwischen hatte auch das Großherzogthum Hessen sich vom Rheinbund losgesagt, und in den Kriegen 1814 und 1815 führte der Prinz das hessische Corps mit den Verbündeten nach Frankreich und zeichnete sich auch hier aus, besonders bei der Berennung Straßburgs, die er als Commandeur der durch eine Brigade österreichischer Grenadiere verstärkten hessischen Division erfolgreich ausführte. So wie sich der Prinz in der Zeit der Kriege als Soldat bewährt, so erwarb er sich in der nun folgenden friedlichen Epoche die Anerkennung als Staatsmann, zunächst auf dem Aachener Congreß, bei dem er die hohe Achtung bei Fürsten und Staatsmännern begründete, die ihm bis zu seinem Tode verblieb. Die herrschenden liberalen Neigungen der Zeit fanden an ihm freilich in der Regel einen entschlossenen Gegner und zeigte er sich meist als entschiedener Anhänger des monarchisch-militärischen Systems. Es konnten daher die Ereignisse des J. 1848 und der Geist jener Jahre diesen seinen Anschauungen nicht zusagen. Prinz Emil starb am 30. April 1856 und blieb in Erinnerung als einer, dessen Engagement in Napoleons Diensten weit über das seinerzeit Übliche hinaus ging – und ihn damit noch heute ehrt.
Ehe es losgeht, sei zum Selbstverständnis erklärt, dass der Titel „Als die Hessen für Napoleon fochten“ sich auf diejenigen Hessen bezieht, die seinerzeit dem Großherzogtum angehörten. Würde man die Hessen der heutigen Gliederung nach Bundesländern betrachten, käme man auf eine Menge mehr an Geschichten, die hier zu verarbeiten gewesen wären. Die auf heute hessischem Gebiet ansässigen Länder, zumindest in Teilen ihrer Gebiete, waren seinerzeit selbstständige Mitglieder des Rheinbundes. Das waren die Nassauer, die hohen Blutzoll mit ihren Truppen in Spanien zu zahlen hatten, und die ehemaligen Hessen-Kasseler aus dem Napoleonischen Musterstaat Königreich Westphalen. Das Fürstentum Isenburg war fast unbekannt, deren Soldaten ertrugen das gleiche Schicksal wie die Nassauer. Schließlich sind nicht zu vergessen die Soldaten des Großherzogtums Frankfurt und die des Fürstentums Waldeck-Pyrmont. Die einen waren ab und an mit den Hessen des Großherzogtums gemeinsam im Feld, während die Waldecker eher mit den Soldaten der sächsischen Herzöge kämpften. Zu letzteren hat der Autor das Buch „Napoleons Völkerschlachtsoldaten aus Thüringen“ verfasst. Vorgenommen hat er sich als nächstes eine zum vorliegenden Band analoge Schrift über die Soldaten des Großherzogtums Frankfurt.