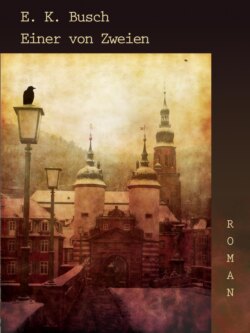Читать книгу Einer von Zweien - E. K. Busch - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеI
Meine früheste Erinnerung reicht zurück in mein viertes Lebensjahr; davor ist nichts als Schwärze. Es scheint mir wunderlich, dass da ganze Jahre in einem einzigen trüben Sumpf versunken sind, während mir meine späteren Erlebnisse mit einer strafenden Genauigkeit in den Sinn kommen wollen.
Die Wintersonne schien durch das Schaufenster und Mutter malte mit ihrem Putzlappen weiße Streifen auf die Scheibe. Schaumig und schmierig waren diese Streifen. In der Sonne verschwanden sie bereits nach wenigen Sekunden. Fred und ich beobachteten Mutters gleichmäßige Bewegungen, dieses Auf und Ab durch die Scheibe hindurch. Um ihren Kopf gebunden trug die hagere Frau ein Tuch von einem verwaschenen Grün. Ein blasses Blumenmuster fand sich auf dem Stoff. Mutter trug dieses Tuch nur beim Saubermachen, ob beim Kehren, Wischen, Wedeln. Es ließ sie wie eine dieser Hexen in den Bilderbüchern aussehen. Die etwas krumme Nase und die wirren Haarsträhnen, die sich wie dunkle Tentakel unter dem Stoff hervorwagten, vervollständigten das Bild. Ihre Haut jedoch glich Porzellan, weiß und makellos und von einer milchigen Härte.
Vater befand sich hinten im Laden und stellte die Suppendosen ins Regal. Die bunten Bilder hatten Reihe in Glied zum Gang zu blicken. Blechsoldaten. Mutter hatte genaue Anweisung gegeben. Der Mann sang leise vor sich hin und klopfte mit seinen ausgetretenen Lederschlappen den Takt. Hatte er gute Laune, so war er am Singen. Uns Kindern ein Naturgesetz. Und da Vater mit beinahe unbezwingbarer Lebensfreude gesegnet war, hing fast immer ein leises Brummen in dem kleinen Raum mit den überfüllten Regalen. Dann wusste man nicht, in welchem Winkel er sich verbarg. Und wenn gleich ich später feststellen sollte, dass Vaters Gesang einem einzigen Brummen gleichkam, so liebten Frederik und ich es damals, seiner Stimme zu lauschen. Denn sie war ebenso Teil dieses Mannes wie sein in diesen Jahren noch ganz und gar dunkler Vollbart, sein breites Kreuz und sein mächtiger Bauch.
Frederik und ich waren damals vier Jahre alt. Wir waren Zwillinge und blieben es trotz all meiner Mühen. Und so saßen wir also beide auf dem Fußboden, die kurzen Beine von den kurzen Armen an den Körper gezogen. Dunkelbraunes Haar, blaue Augen, die krumme Nase der Mama und insgesamt sehr klein und schmächtig. Einer genau wie der andere. Selbst ich vermag es nicht, uns auf den alten Fotografien zu unterscheiden. Denn eines bleibt auf diesen Bildern verborgen: Freds stetiges Gezappel. Denn während ich Mutter gelassen zu beobachten wusste, wippte er unermüdlich hin und her. Er langweilte sich. Dabei hätte es des Gezappels überhaupt nicht bedurft. Ich wusste immer, was Fred spürte. Keine Gestik, keine Mimik war von Nöten.
„Lass uns doch Mama beim Wischen helfen,“ schlug ich daher vor. Denn ich war ein wahres Muster an Tugendhaftigkeit, dass es mich heute selbst zu grauen vermag.
Frederik jedoch rümpfte die kleine Nase und erklärte nach kurzem Überlegen: „Ich hole die Glaskugeln!“
Und schon hastete er, noch ohne meine Antwort abgewartet zu haben, hinauf in den ersten Stock. Er wollte die Schneekugeln aus unserem Kinderzimmer holen, unsere Weihnachtsgeschenke.
Im Grunde stimmte ich Frederiks Vorschlägen immer zu. Lediglich wenn er etwas Gefährliches, Dummes oder Verbotenes vorhatte, erhob ich Einwände. Meistens gelang es mir sogar, ihm unartige Pläne auszureden. Ihm war jeder meiner Gedanken vertraut. Lediglich geriet mein Bruder dann und wann in einen Zustand von blinder Begeisterung, der mir völlig fremd war. Meine große Überzeugungskraft lief dann ins Leere und mir blieb nichts anderes übrig, als ihn selbstlos zu decken, wenn Mutter fragte, wer die Scheibe zerbrochen, die Wand bemalt oder sich in der Süßigkeiten-Abteilung allzu freimütig bedient hatte. Sie wusste dann sehr wohl, wer der wahre Übeltäter war. In ihrer nüchternen Art jedoch verkündete sie: „Wie du willst“, und schwang das Richtschwert.
Sehr selten allerdings da erlag auch ich Freds wilden Plänen, da sagte ich mir: „Jetzt verderb‘ ihm nicht die Freude!“
Ich jedoch verspürte vor dem unsanften Aufprall unseres Schlittens, dem folgenden Überschlag und der schmerzhaften Kollision mit dem Apfelbaum, kein Kribbeln im Bauch. Auch war mir jenes Gefühl der „vollkommenen Freiheit“ fremd, von der Fred nach diesem Erlebnis mit großen Augen zu schwärmen wusste.
Und als wir mit unseren Sonntagshosen und besten Hemden in die Schlammgrube stiegen, um uns dort mit Karl und dessen älterem Bruder eine Schlacht zu liefern, da empfand ich keinerlei Genugtuung. Dabei wusste ich wohl, wie Frederik fühlte und was er dachte, als wir nach dem sonntäglichen Gottesdienst mit den andren Jungen am Ufer der Schlammgrube standen. Fred war beleidigt und überaus zornig.
„Euer Vater ist ein Idiot“, hatte Karl ohne ersichtlichen Grund bemerkt, so als hätte er etwas über das Wetter gesagt.
Ich konnte darauf die Wut in Freds Brust schwelen spüren und ich wusste auch, dass jeglicher Beschwichtigungsversuch sinnlos wäre. Trotzdem sah ich zu ihm hinüber und meinte kopfschüttelnd: „Der hat doch keine Ahnung, Fred!“
Aber mein Bruder hörte mir überhaupt nicht zu. Als er schließlich tobend ins Wasser stieg, die braune Brühe reichte ihm bis zum Bachnabel, da blieb mir nichts anderes übrig, als es ihm gleichzutun. Immerhin waren wir Brüder. Also tauchte auch ich meine Arme in das trübe Wasser und griff nach dem stinkenden Schlamm am Grund. Körnig und doch schleimig fühlte er sich zwischen den Fingern an. Doch ich konnte mich nicht meiner Wut hingeben, wie es Fred vermochte, hörte mein Gewissen zetern bei jedem Wurf.
Als Karl endlich außer Gefecht gesetzt war, schimpfte ich mich einen Schwachkopf und Schweinehund. Fred dagegen vermochte ich keinerlei Vorwurf zu machen. Es fiel ihm nun einmal schwer, sich zusammenzunehmen. Er war ein ungestümes Kind. Wie Mutter so schön zu sagen pflegte: „Der eine ganz Herz, der andere Kopf.“
Frederiks polternde Schritte waren auf der alten Holztreppe zu vernehmen und dann schob er sich bereits an dem geblümten Vorhang vorbei, der die Treppe und damit auch das obere Stockwerk vom Laden trennte.
Dieser Vorhang war im Übrigen das aller schäbigste Ding im ganzen Haus und es sei hier noch am Rande bemerkt: Auch das sonstige Inventar zeugte nicht gerade von einem erlesenen Geschmack. Eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Duschvorhang war jedenfalls unverkennbar. Bei jenem verblichenen Muster handelte es sich vermutlich um ein Blumendekor. In meinem ganzen Leben jedoch habe ich keine Blume von solch scheußlicher Farbe gesehen. Zu solcher Hässlichkeit bedarf es vermutlich der Phantasie eines Menschen.
Mutter wusch den Vorhang monatlich. Dann klaffte ein ungemütliches Loch in der Wand und es zog unangenehm. Aber auch ihr pedantisches Waschen war vergeblich, so wie all ihr Scheuern, Schrubben, Bürsten. Unzufriedenheit ließ sich nun mal nicht auskehren.
Fred blieb wie üblich mit einem Fuß im Vorhang hängen und stolperte auf mich zu, der ich da noch immer auf dem kalten Fliesenboden saß. In jeder Hand hielt Fred eine der orangengroßen Glaskugeln und einen Moment fürchtete ich, er würde stürzen.
Fred war mit Sicherheit einer der ungeschicktesten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Sein ganzes Leben lang wäre er nicht davor gefeit, über die eignen Füße zu stolpern. Zu meinem Erstaunen aber brachten ihm dieser wie auch seine weiteren augenfälligen Makel nur das Wohlwollen seiner Mitmenschen ein.
Das Christkind hatte die beiden Schneekugeln gebracht. Genauer gesagt hatte das Christkind für Fred die Kugel mit dem blauen Sockel und für mich die mit dem grünen vorgesehen. Blau war Frederiks Lieblingsfarbe, während Grün die meine war. Der Wahrheit zuliebe möchte ich hier allerdings anführen: Frederiks Lieblingsfarbe war Blau. Und nur deshalb war meine Grün. Denn wie hätten uns die Kunden unterscheiden können, wenn ich nicht immer die grünen und er nicht immer die blauen Strümpfe getragen hätte? Dabei konnte auch dieser kleine Trick mit den Strümpfen uns keine eigenen Identitäten bescheren, denn nicht einmal wollten die Leute sich merken, wer denn nun welche Strümpfe trug. Für die meisten daher waren sowohl er als auch ich Der kleine Wenk, denn dann bräuchte man sich gar nicht zwischen den Namen zu entscheiden. Oder aber man nuschelte etwas wie: Freder-Konrad daher. Diese Respektlosigkeit gegenüber meiner Person, Fred schien es übrigens völlig gleichgültig zu sein, wie man ihn nannte, war zwar frustrierend aber auch ernüchternd. Den Menschen interessierte nur, was ihn selbst betraf.
Dennoch schmerzte es mich damals, wenn wir Brüder in einen Topf geworfen wurden. Ob Kunden, Nachbarn, Lehrer oder unsere wenigen Verwandten: Niemand schien es für nötig zu halten, einen Unterschied zu machen zwischen diesem Jungen und mir. Da war es dann gleichgültig, dass ich es gewesen war, der die Schranktüre repariert oder die Garage aufgeräumt hatte: Tante Elsa reichte uns beiden eine Tafel Schokolade zum Dank. Dabei störte es mich nicht im Geringsten, wenn man uns einmal verwechselte. Das konnte in Anbetracht der Umstände passieren. Sogar ich selbst verwechselte mich hin und wieder, wenn Fred und ich gemeinsam an einem Fenster vorübergingen und uns in der Scheibe spiegelten. Ein kurzer Blick hinüber und dann der Gedanke: „Wieso trage ich Freds Pullover?“
Aber ich fand es einfach grauenhaft, wenn man zu ängstlich oder zu bequem war, eine Entscheidung zu wagen. Und überhaupt: War es denn nicht offensichtlich, wer samstags die Straße fegte? Wer mit Mutter in die Apotheke ging oder die Briefe zur Post brachte?
Noch sollten jedoch Jahre vergehen, bis uns niemand mehr verwechseln würde. Bis dahin würde ich hart kämpfen, um mich von Freds jämmerlicher Mittelmäßigkeit zu befreien.
Dabei hätten Fred und ich selbstverständlich Namensschilder tragen oder uns die Anfangsbuchstaben unserer Vornamen in großen Lettern auf das Hemd sticken lassen können. Er ein blaues F, ich ein grünes K. Mutter hätte eine solche Arbeit rasch erledigt. Sie war gut im Handarbeiten, nähte und bügelte auch für die Nachbarschaft. Dann saß sie da, die Brille auf der krummen Nase, biss sich auf die Unterlippe, während sie den Faden durch die Nadelöse fädelte. Das ist mir wohl die liebste Erinnerung an sie. Ganz und gar in ihre Arbeit vertieft, sah sie zufrieden aus. Trotzdem wollte ich keinen Buchstaben auf meinem Pullover. Mein verkappter Stolz. Die Leute müssten mich doch irgendwann sehen. Mich. Nicht ihn und erst Recht nicht uns. Nein, ich würde mich nicht etikettieren lassen. War ich denn eine der Dosen in den Regalen? Und noch einmal zu meiner Lieblingsfarbe: Ich hatte keine Lieblingsfarbe. Nie.
Frederik drückte mir meine Kugel in die Hand und wir begannen kräftig zu schütteln. Die Flocken wirbelten auf und die Figur, ein kitschiger Engel in goldnem Gewand, verschwand im Schneegestöber. Wir schüttelten noch einige Male und nahmen es uns zum Ziel, möglichst viel Schnee auf dem Kopf des Engels aufzutürmen. Das war Frederiks Idee gewesen. Ich selbst hätte nie etwas dergleichen vorgeschlagen, hätte wahrscheinlich einen Hauch Blasphemie in einem solchen Vorhaben entdeckt. Beinahe an jedem Tun ließ sich nämlich etwas Verwerfliches ausmachen, wenn man nur recht genau darüber nachdachte. Damals jedoch schüttelte ich, rhythmisch aus dem Handgelenk, dass die Flocken wirbelten. Es war ja schließlich Freds Idee gewesen.
Frederik, der bereits von einem weiteren Zappelschub erfasst worden war, schüttelte nun so kräftig, er nur konnte. Hin und her wie völlig wahnsinnig. Die Kugel rutschte ihm aus der Hand. Wir beide beobachteten ihren Weg dem Boden entgegen. Als die Kugel auf die grünen Kacheln traf, zerbarst sie in kleine Splitter. Das Wasser spritze an unseren Beinen hoch. Weiße Flocken schwammen in der erbärmlichen Pfütze zu unseren Füßen. Frederik betrachtete entsetzt den Scherbenhaufen und als er sich hinuntergebeugt und entdeckt hatte, dass die Engelsflügel abgebrochen waren, begann er dann endlich zu weinen. Es war ohnehin nur eine Frage der Zeit gewesen, bis seine Gefühle ihn übermannt hätten. Mutter, die sein Missgeschick durch die Scheibe hindurch beobachtet hatte, betrat nun den Laden. Die Türglocke klingelte und schien den weinenden Jungen zu verhöhnen.
„Frederik... Lass bloß die Hände von den Scherben! Du zerschneidest dir nur die Finger!“, rief sie und stemmte ihre Arme in die schmale Taille. Wie mager sie doch war!
„Weshalb musst du denn auch immer so übertreiben?“, und sie verzog den Mund, schüttelte dann langsam den Kopf, dass die Locken sich wanden, wie die Schlangen auf Medusas Haupt. Ihr Blick war streng und vorwurfsvoll. Als Freds Wimmern und seine feuchten Augen sie erweichten, trat sie zu ihm heran, so dass er sich an ihren knochigen, steifen Körper klammern konnte.
Mutter machte, wurde sie umarmt, einen eigenartig morschen Eindruck. Sie rührte sich dann nicht, stand steif da, als könne ihr auf Grund einer falschen Bewegung der Arm abbrechen.
Vater kam mit einem Besen und einem Lappen herbei.
„Sei nicht traurig, Frederik. Es ist doch nur eine Glaskugel.“
Schon machte er sich daran, den kläglichen Rest des Weihnachtsgeschenks aufzufegen.
„Vielleicht seid ihr noch zu albern für solches Spielzeug“, erklärte Mutter und warf Vater einen tadelnden Blick zu, der diesem entging.
Frederik weinte noch immer. Mit nasaler Stimme erklärte er: „Die Kugel war so schön...“, und vergrub sein verheultes Gesicht in Mutters Schürze.
Ich stand neben meiner regungslosen Mutter und meinem Bruder, der sich fest an ihre Beine klammerte, und neben Vater, der noch die letzten Tropfen aufwischte. Meine Hände hatte ich tief in den Hosentaschen vergraben und hielt meinen Blick gesenkt. Wie so oft in meinem Leben kam ich mir nutzlos und dumm vor. Dann kam mir ein Gedanke und ich schlug vor: „Weißt du was, Frederik, du kannst meine Kugel haben!“
Vater sah mich freudig an.
„Das ist aber lieb von dir, Kon...“
Als ihm Mutter bereits ins Wort fuhr.
„Es ist Freds eigne Schuld, dass seine Kugel zerbrochen ist. Was ist er auch immer so unvorsichtig?“
Einen Moment herrschte Schweigen, dann brachte ich leise hervor: „Wenn Fred dann nicht mehr so traurig ist, gebe ich sie ihm aber gerne!“
Die Augen meines Bruders weiteten sich vor Dankbarkeit und Vater lächelte. Mutter dagegen erklärte trocken: „Wie du willst, Konrad.“
War ich denn nicht ein herzerweichend selbstloser Junge? Ein wahres Muster an Nächstenliebe?
Wenn ich ehrlich bin, dann war ich schon damals von Grund auf verdorben. Denn ich wollte nichts lieber, als ein guter, ein besserer Junge sein. Um über meinen Bruder zu triumphieren - ich wäre bereit gewesen, jedweden Preis zu zahlen.
*
Ein Erlebnis kommt mir in den Sinn, da waren wir vielleicht neun Jahre. Es war ein heißer Tag, einer der wohl heißesten des Jahres. Ich schätze, im August.
Frederik und ich folgten gemeinsam dem Feldweg, der sich an Wiesen und Äckern entlang zum Wald schlängelte. Der Weg war staubig und in der Ferne zitterte die Luft.
Wir machten gerne zusammen diese Streifzüge, folgten dem Weg erst und liefen dann querfeldein, verloren uns schließlich in den großen Wäldern. Die meisten anderen Kinder waren ohnehin in die Ferien gefahren. Manchmal entdeckten wir auf unseren Wanderungen etwas Besonderes: Einen Schmetterlingsflügel zum Beispiel oder eine tote Maus. Aber meistens konnten wir nur Grashüpfer fangen oder schöne Steine, Blätter oder Kiefernzapfen sammeln. Und wir vertrieben uns die Zeit mit dem Fragespiel.
Ich stellte Frederik dann eine Frage: „Was ist das für ein Baum dort?“, oder: „Erkennst du den Vogel?“, und er antwortete. Meistens wusste Fred die richtige Antwort nicht, selbst wenn ich ihm die Frage schon einige Tage zuvor gestellt hatte.
Ich meinte dann freundlich: „Aber Frederik, guck dir doch noch mal genau die Blätter an!“
Er starrte hinauf ins dichte Laub, das da grün funkelte im warmen Wind. So als könnte sein angestrengter Blick den Baum bezwingen. Doch bald schon sah Fred ein, dass dieser Riese sein Geheimnis eisern hütete. Ohnehin war mein Bruder nicht gerade mit Geduld gesegnet.
Sein Blick richtete sich nun hilfesuchend auf mich.
„Das ist eine Eiche, Fred. Sieh doch, wie wellig die Blätter sind!“, erklärte ich und fügte hinzu: „Die Eicheln kann man übrigens essen. Und am Mittelmeer gibt es auch Korkeichen. Die haben eine Borke aus Kork. Du weißt schon: Kork. Daraus macht man die Flaschenkorken. Es gibt hier bei uns Stiel- und Traubeneichen und…“
Frederik hörte immer sehr geduldig, scheinbar interessiert zu, merkte sich aber herzlich wenig. Er genoss es wohl lediglich, meiner Stimme zu lauschen, gab sich während meinen Ausführungen seinen eignen Träumereien hin. Ich dagegen erzählte auf diesen Spaziergängen nur allzu gern, wo sich doch sonst niemand für meine Abhandlungen interessierte.
Tatsächlich hatte ich wohl von jeher eine Vorliebe zu elendigen Monologen.
„Lass uns zum Fluss gehen“, rief Frederik und unterbrach damit jäh meinen Bericht über die verschiedenen Entwicklungsstadien des Schwalbenschwanzes. Seine Augen strahlten, schon rannten wir gemeinsam in Richtung Fluss. Frederik wühlte sich durch ein Weizenfeld, ich nahm einen Weg zwischen diesem und dem nächsten Acker. Denn hatte uns beim letzten Mal nicht der junge Winkler, der Sohn vom alten Bauern, gehörig zurechtgewiesen? Besser gesagt: Er hatte mich zur Rede gestellt, denn Frederik war sogleich davongelaufen, als er den brüllenden Traktor vernommen hatte.
Fred hatte bereits seine staubigen Sandalen abgestreift und ließ sich an eine Wurzel geklammert zum Wasser hinab, als ich die Böschung erreichte.
Ich rief ihm zu: „Frederik... Sei lieber vorsichtig. Wir können noch nicht gut genug schwimmen, um allein...“
„Ich will doch gar nicht schwimmen, nur ein wenig durchs Wasser laufen. Am Rand, wo’s nicht so tief ist. Meine Füße sind ganz heiß und schmutzig.“
Er schlitterte weiter den Abhang hinunter, dass die trockene Erde aufwirbelte. Ich zog nun ebenfalls meine Schuhe aus, stellte sie ordentlich nebeneinander ins Gras und folgte ihm.
„Aber sei vorsichtig!“, rief ich ihm zu, als er bereits seine Zehen ins Wasser tauchte. Er verzog das Gesicht.
„Ganz schön kalt!“
„Warte auf mich, ja?“
Er murmelte nur: „Mmmh“, war aber bereits ein Stück ins Wasser gelaufen. Es umspülte seine wie eh und je verkratzten Knie. Nun war auch ich unten angekommen und stellte mich mit verschränkten Armen ans Ufer.
„Du solltest nicht so weit hineingehen. Die Strömung ist ziemlich stark, auch wenn der Fluss viel weniger Wasser führt als sonst. Das liegt an der Hitze und Trockenheit der letzten Tage.“
Irrigerweise war ich damals überzeugt, jedes Wissen müsse auf der Stelle verkündet werden. Erst später würde ich begreifen, dass es sich gerade andersherum verhielt.
Fred watete durch das Wasser und ich folgte ihm trockenen Fußes auf seinem Weg flussaufwärts. Er musste sich ganz schön anstrengen, um gegen die Strömung anzukommen. Meine Arme waren weiterhin verschränkt. Mit zusammengekniffenen Augen beobachtete ich ihn, während ich über die teilweise recht spitzen Kiesel stolperte.
„Du wolltest doch im flacheren Wasser bleiben“, rief ich ihm in Erinnerung.
„Ach was, Konrad! Die Strömung ist gar nicht stark. Ich könnte sogar noch weiter in die Mitte gehen, wenn ich...“
Er war wohl auf einem Stein ausgerutscht, denn er geriet auf einmal ins Wanken, fuchtelte wild mit den Armen. Da er sich jedoch nirgends festhalten konnte, fiel er schließlich lachend ins Wasser. Ich sah ihn kopfschüttelnd an. Mutter würde mit uns schimpfen, wenn er mit nassen Kleidern nach Hause käme.
„Jetzt komm da raus, Fred“, meinte ich auffordernd. Er versuchte sich auch tatsächlich wieder aufzurichten, doch gelang es ihm nicht, auf den glitschigen Steinen Halt zu finden. Ein ziemlich blöder Ausdruck machte sich in seinem Gesicht breit.
„Komm schon, Fred“, bemerkte ich beinahe genervt: „Du treibst nur immer weiter ab.“ Und tatsächlich trieb er nicht nur flussabwärts, sondern geriet auch immer weiter in die Mitte des Flusses.
„Konrad!“, rief er nun ziemlich panisch und versuchte gegen die Strömung anzuschwimmen.
„Was machst du denn?“, schrie ich ihn an. Wie ein Verrückter fuchtelte er jetzt mit seinen Armen und schluckte bei seinem irren Gestrampel einiges Wasser. Ich rannte am Ufer neben ihm her.
„Schwimm doch nicht gegen den Strom!“, unterwies ich ihn. Er jedoch hörte mir nicht zu. „Kon...“, schrie er lediglich und sein Kopf tauchte für einen Moment unter, ehe er wieder an der Wasseroberfläche erschien und Fred nach Luft japste. Auf den holprigen Steinen kam ich nicht gut voran, und so blieb ich schließlich stehen, während Fred immer weiter flussabwärts trieb.
„Du musst schwimmen“, rief ich ihm aus der Ferne zu.
„Schwimm mit, nicht gegen die Strömung.“ Aber er scherte sich nicht darum, was ich sagte, schlug wild mit den Armen um sich, wie eine Gans, die man zu fangen versuchte .
„Schwimm einfach zum Ufer!!!“, befahl ich ihm. Doch Fred schrie nur immer wieder: „Konrad!!!“ So als könne das fortwährende Rufen meines Namens irgendetwas an seiner misslichen Lage ändern. Er war bestimmt schon zwanzig Meter entfernt von mir.
„Frederik, du musst schwimmen, schwimmen!!!“
Doch er versuchte noch immer, gegen die Strömung anzukämpfen. Und mit seinen Füßen konnte er einfach keinen Halt auf den glitschigen Kieseln finden. Inzwischen war er völlig außer sich, obwohl ihm das Wasser höchstens bis zur Schulter reichen mochte.
„Konrad...“
Seine Stimme wurde leiser, wie er da in die Ferne trieb. Ich sah ihm reglos hinterher, diesem kleinen Jungen, der da immer wieder meinen Namen rief. Und da machte sich dieses Gefühl in meiner Brust breit. Keine Freude. Gleichgültigkeit. Dann sollte es das also gewesen sein. Na schön. Eine Umstellung wäre es wohl, aber ich könnte mich damit arrangieren. Eine Woche vielleicht. Aber Mutter würde vermutlich ziemlich wütend sein. Schließlich war er doch mein Bruder und ein Bruder hatte nun einmal auf den andren acht zu geben. Kain und Abel: Soll ich denn der Hüter meines Bruders sein? Und überhaupt: Er war mein Bruder. Mein Bruder, den ich liebte wie nichts auf der Welt.
Ich rannte so schnell ich konnte. Rannte. Rannte, wie ich noch nie zuvor gerannt war. Ignorierte den Schmerz, die angestoßenen Zehen, die zerschnittenen Sohlen. Ich rannte. Als ich ihn eingeholt, überholt hatte, warf ich mich ein Stück vor ihm ins Wasser, dass es zu allen Seiten spritzte.
„Frederik! Ich bin da!“
Ich schwamm nun ein Stück vor ihm, bemüht, einigermaßen in Ufernähe zu bleiben. In der Mitte war die Strömung stärker und so würde er schon bald an mir vorübertreiben. Das hatte ich nicht bedacht. Fred sah mich mit aufgerissenen Augen an und machte einige stümperhafte Bewegungen auf mich zu.
„Komm zu mir! Los! Schwimm!“
Er schlug mit seinen Armen um sich. „Schwimm!!! Wie Papa es und gezeigt hat! Wie ein Frosch!!!“
Immerhin versuchte er nicht länger, gegen die Strömung anzukämpfen, sondern kam strampelnd und fuchtelnd auf mich zu. Als er sich schließlich an mich klammerte, fiel es mir schwer, meinen Kopf über Wasser zu halten, obwohl es mir gerade einmal bis zum Bauchnabel reichte. Ich stieß mich immer wieder vom Boden ab, schnappte nach Sauerstoff, versuchte Freds allzu festen Griff um meinen Hals zu lösen. Nur sehr langsam näherten wir uns dem Ufer.
Als wir in der Wiese saßen und uns von der Sonne trocknen ließen und Frederik sein Zittern und Wimmern einigermaßen überwunden hatte, betrachtete er aus nächster Nähe meine geschundenen Füße.
„Du hast doch gesagt, die Steine werden rund geschliffen vom Wasser“, bemerkte er und schluchzte noch einmal auf. Doch es war bereits ein lästiges Schluchzen, das man nicht mehr los wurde wie einen Schluckauf, und kein echtes Schluchzen mehr. Ich konnte ihn gerade noch davon abhalten, die lange Schnittwunde mit seiner Fingerspitze zu berühren. Die rote Farbe des Blutes schien eine unwiderstehliche Wirkung auf ihn auszuüben.
„Wieso waren die Steine also nicht rund, Konrad?“, fuhr er fort und sah mich aus klebrig roten Augen an. Ich erwiderte, den Blick starr gegen Westen, wo die Sonne gerade hinter den Bergen verschwand: „Ich weiß es nicht, Fred. Manchmal ist etwas anders, als es sein sollte.“
*
Ich konnte mich in den nächsten Tagen tatsächlich davon überzeugen, dass dieses Gefühl der Gleichgültigkeit meinem Zwillingsbruder gegenüber durch den Schock verursacht worden war. Daran glaubte ich fest. Es war der gleiche hartnäckige Glaube, zu dem ich mich auch bezüglich Gottes Existenz zwang. Doch tief in mir nagte der hässliche Zweifel. Ich war beherrscht wie eh und je gewesen. Sogar ganz besonders beherrscht. Kein Schock weit und breit. Und obwohl ich wusste, dass ich mich dafür hätte hassen müssen, dass ich ihn nicht liebte, hasste ich ihn dafür. Wahrlich hätte ich mir das niemals eingestanden.
Meine schmerzenden Füße, ich konnte kaum gehen, auch wenn Mutter sie sorgfältig verbunden hatte, erfüllten mich nicht mit Stolz, aber ich nahm sie beinahe dankbar hin als Beweis meiner Bruderliebe und insgeheim auch als gerechte Strafe Gottes.
Der Sommer zog sich nun, da ich fürs Erste nicht richtig gehen konnte, zäh hin. Wenn man jung ist, vergehen die Tage ohnehin sehr langsam. Ich las viel, manchmal las ich auch Fred vor, der aber schon nach wenigen Seiten mit seinem üblichen Gezappel begann.
Ich liebte unser Naturkundebuch, eines der wenigen Bücher, die wir besaßen, abgesehen von diesen etwa zwanzig kitschigen Romanen aus dünnem Papier, in die sich meine Mutter jede Nacht fallen ließ. Später würde ich einen Widerspruch in ihrer trockenen Art und dieser Lektüre sehen, dann würde ich aber schließlich begreifen: Im tiefen Inneren sehnte sich Mutter nach Prinzen, Ärzten und Helden jeglicher Art, nach großen Emotionen und auch nach Reichtum und Glanz. Doch all das lag in unerreichbarer Ferne für diese Tochter einer einfachen Krämerfamilie, die sich schließlich, als sie schon zu altern begonnen hatte, mit dem gutmütigen aber einfältigen Sohn eines Bauern abgegeben hatte, dem dritt-geborenem wohlgemerkt.
Wenn ich nicht las, beziehungsweise die bereits abgegriffenen Seiten betrachtete, denn ihr Anblick allein ließ bereits alle Sätze in mir aufsteigen, so saß ich im Laden auf der Theke und ließ meine bandagierten Füße baumeln.
„Frau Schultz, diese Schokolade schmeckt ganz hervorragend. Der kleine Matthias wird sie sicherlich lieben. Mein Bruder ist auch ganz verrückt nach ihr.“, „Herr Klee, Ihre Zigaretten haben wir gerade nicht da. Neue kriegen wir erst nächste Woche. Aber ich werde Ihnen in Zukunft welche zurücklegen, ja?“, „Frau Gruber, ich würde die günstigere Seife nehmen. Sie ist besser.“
„Aber Konrad, du bist viel zu ehrlich. So wirst du nie ein erfolgreicher Geschäftsmann werden!“
„Ich möchte auch gar kein Geschäftsmann sein. Lieber werde ich einmal Arzt“, erwiderte ich lächelnd.
„Du bist wirklich ein guter Junge! Ich wünschte, mein Karl wäre auch nur halb so fleißig, wie du es bist. Er treibt sich nur mit deinem Bruder im Wald herum und kommt mit zerrissenen Hosen zurück!“
Doch Frau Grubers Gesicht quoll über vor Wärme und Stolz. Dann fügte sie noch hinzu: „Er ist eben ein kleiner Rabauke und deinen Bruder steckt er jetzt, wo du hier im Haus sitzen musst, auch noch mit seinen verrückten Ideen an.“
„Sie bauen da draußen ein Baumhaus“, erklärte ich: „Es wird wunderbar werden, hat Fred gesagt. Ein richtiges Baumhaus!“ Frau Gruber lächelte und zeigte dabei ihre schiefen Zähne. „Na, dann nehme ich die gute Seife. Ich werde sie brauchen.“ Sie drückte mir eine zusätzliche Münze in die Hand und flüsterte: „Wenn du fleißig sparst, kannst du dir ein Modellflugzeug kaufen oder eines dieser kleinen Autos.“ Ich erwiderte lächelnd: „Vielen Dank, Frau Gruber. Ich kaufe mir aber lieber ein neues Buch. Wir haben so wenige Bücher.“
„Na, dann geh doch Mal in die Bibliothek und leihe dir welche aus. Das ist praktischer und günstiger noch dazu.“
Ich sah sie fragend an. Die Biblio-Was?
„Du weißt schon, Konrad: Das Haus gegenüber von der Kirche. Im Erdgeschoss!“ Sie winkte mir zu, als sie aus dem Laden trat und die Glocke ertönen ließ.
Ich quälte mich also, zwei Krücken zur Seite – Vater hatte sie mir gemacht -, zum Haus gegenüber der Kirche. Vater schnitzte sehr gerne und jeden Abend saß er im Hinterhof und verwandelte ein unförmiges Stück Holz in ein Figürchen – ob Mensch oder Tier - , in ein Türschild, das jemand bestellt hatte, oder eben in Krücken für seinen Sohn. Wahrscheinlich hätte ich Vater lediglich fragen brauchen: „Kannst du mich bitte auf deinem Gepäckträger zur Bibliothek bringen?“, und er hätte in seinem Lied innegehalten und geantwortet: „Steig einfach auf und halte dich gut fest!“
Dann wäre er mit mir auf seinem rostigen Fahrrad summend durchs Dorf gefahren. Die blaue Farbe wäre bei jedem Treten abgeblättert und wir hätten wohl eine Spur aus kleinen Lackschuppen hinterlassen. Aber ich hatte Vater beim Aussortieren der alten Zeitungen nicht stören wollen und mich also allein auf den Weg zur Bibliothek gemacht. Und so stieg ich nun mühsam die drei Stufen hinauf, die zur Haustür des ziemlich kargen Gebäudes führten. Ich hatte nicht gewusst, dass sich hinter dieser dunklen Holztür die Bibliothek befand, obwohl wir jeden Sonntag an dem Haus vorbeikamen. Aber nicht einmal ein Schild wies auf den Schatz im Bauch des Gebäudes hin. Die Tür war schwer und ich konnte sie kaum öffnen, musste mich mit voller Kraft gegen sie lehnen. Dann betrat ich ein kahles Treppenhaus, in dem nur ein Pappschild stand.
Erdgeschoss: Öffentliche Gemeindebibliothek
Obergeschoss: Kanzlei Dr. Eichinger
Dachgeschoss: Privat
Ich ging auf die Tür gegenüber der Treppe zu und versuchte sie zu öffnen. Verschlossen. Enttäuscht und erschöpft ließ ich mich gegen sie fallen. Alle Mühe also vergebens! Dann bemerkte ich einen Zettel an der Wand. In unleserlicher Schrift, die erst entschlüsselt werden wollte, stand dort geschrieben:
Wer ein Buch ausleihen möchte, der wende sich bitte an Dr. Eichinger (1. OG)
Mo – Mi: 9:00 bis 12:00 Uhr
Ich machte mich also auf den Weg zu Dr. Eichinger, klammerte mich an das abgegriffene Holzgeländer und hangelte mich mühsam aufwärts. Ich klingelte an der Tür und der kleine Mann mit dem lockigen grauen Haar und dem faltigen Gesicht, der mir noch so oft die Tür öffnen sollte, sah mich misstrauisch durch seine Brille an.
„Du bist aber nicht Herr Tulpe, oder?“, dann blickte er auf seine goldene Armbanduhr und murmelte: „Ohnehin haben wir erst einen Termin in einer halben Stunde ausgemacht.“
Ich sah den Mann etwas ängstlich an und erklärte: „Guten Morgen, Herr Eichinger“, so wie meine Mutter es mir beigebracht hatte. „Konrad, und dass du die Leute auch immer bei ihrem Namen ansprichst!“
„Doktor Eichinger“, wandte der Mann ermahnend ein. Ich sah ihn fragend an.
„Die Titel, mein lieber Junge, darfst du nicht vergessen.“
„Die Titel?“
„Nun, den Doktortitel zum Beispiel.“
„Sind Sie denn Arzt?“
„Nein, ein Anwalt bin ich. Der einzige in diesem Provinznest.“
Es folgte ein kurzer Vortrag über die Art seines Berufes und das Studium an der Universität im Allgemeinen und schließlich noch über die Promotion im Besonderen. Ich hörte aufmerksam zu und kam mir sehr dumm dabei vor. Von alledem hatte ich noch nie etwas gehört. Hätte dieser seltsame Mann etwas über den Bussard erzählt oder über die Eidechse, dann hätte ich etwas Kluges erwidern können, aber so konnte ich nur seiner etwas schrillen Stimme lauschen.
„Ich bin hier, weil unten ein Zettel hängt...“, erklärte ich, als er mich endlich zu Wort kommen ließ.
„Ach, die Bibliothek. Weshalb hast du das denn nicht gleich gesagt?“
Nun machte sich ein gelassenerer Ausdruck in seinem Gesicht breit.
„Ich hole den Schlüssel.“ Damit verschwand er, wie ich später lernen würde, in seiner Anwaltskanzlei. Er half mir, nachdem er meine Krücken bemerkt hatte, die Treppe hinunter und führte mich dann in die seiner Meinung nach überaus bescheidene Gemeindebibliothek ein.
„Dort hinten findest du Prosa und unsere drei Lyrikbänder. Hier vorne stehen die Sachbücher. Es sind bestimmt zwanzig. Wir sind besonders was die heimische Flora betrifft reich bestückt.“
Er lachte gackernd. Er schien mir etwas verrückt zu sein, dieser Doktor Eichinger. Doch ich war so fasziniert von den vielen Büchern, dass ich auf den alten Mann nicht weiter achtete, der da etwas gelangweilt neben mir stand. Ich fragte vorsichtig: „Und die darf ich alle lesen?“
„Du darfst sie sogar mit nach Hause nehmen, mein Junge. Du musst nur gut auf sie acht geben und sie nach einem Monat wieder heil zurückbringen. Für den Fall, dass noch ein zweiter Mensch in diesem Provinznest auf die Idee kommen sollte, ein Buch zu lesen.“
Ganze zwei Bücher brachte ich heim. Mehr konnte ich in Anbetracht der Krücken nicht transportieren. Es gelang mir gerade, eines auf jeder Seite unter den Arm zu klemmen. Als ich zu Hause ankam, begann ich sogleich mit der Lektüre. Das eine Buch hieß Das Geheimnis der Zahlen und war ein Mathematikbuch, das seine besten Tage bereits hinter sich gebracht hatte. Die Seiten rochen nach altem Käse und ich hielt es daher immer in einiger Entfernung, wollte es schon gar nicht auf mein Kopfkissen legen, wo ich doch gerne auf dem Bauch liegend las. Das andere Buch war ein Märchenbuch mit unheimlichen Zeichnungen. Eigentlich hatte ich ja ein Buch über Gartenkräuter ausleihen wollen, hatte es schon aus dem Regal gezogen. Doch als ich dann das Märchenbuch entdeckt hatte, hatte ich nicht länger an dem Bildungsvorsatz festhalten können. Außerdem: Auch über Märchen hätte ein gebildeter junger Mann Bescheid zu wissen!
Früher hatte uns Vater oft Märchen vorgelesen, manchmal bis tief in die Nacht. Auch wenn sein Lesen nie besonders flüssig gewesen war, hatte es mir doch immer sehr gefallen. Vater hatte stets mit ganzer Seele gelesen. War eine Geschichte traurig gewesen, und viele Märchen waren im Grunde sehr traurig, hatte er oftmals zu weinen begonnen.
„Das ist so furchtbar. Das arme Mädchen. Erst verliert es die Mutter und jetzt...“
Fred und ich hatten dann unsere dünnen Arme um seinen wuchtigen Bauch geschlossen, bis er seine Fassung wiedergefunden hatte und weiterlesen konnte. Eines Tages hatte Mutter jedoch verkündet: „Ihr beide seid jetzt zu alt fürs Vorlesen“, dann hatte sie Frederik streng angesehen und hinzugefügt: „Ihr müsst euch jetzt im eigenen Lesen üben.“
Nicht, dass Fred daraufhin noch ein Buch ergriffen hätte!
In den folgenden Monaten, Jahren, würde ich Doktor Eichinger jede Woche besuchen. Wir einigten uns, als die Schule wieder begonnen hatte, auf Mittwochabend. Doch schon bald hatte ich alle Bücher, die es in der Bibliothek gab, gelesen. Als ich also erneut das stinkende Mathematikbuch ausleihen wollte, fragte mich Doktor Eichinger: „Hast du dieses Buch nicht schon einmal ausgeliehen?“
Der Doktor hatte nämlich ein ganz ausgezeichnetes Gedächtnis; so viele Schwächen er anderweitig auch gehabt haben mochte. Vielleicht war er sogar trotz einiger unübersehbarer Makel, ein recht akzeptabler Mentor.
Ich sah den alten Mann verlegen an. „Ich habe alle Bücher schon einmal ausgeliehen. Also fange ich wieder von vorne an. Schließlich habe ich vieles schon wieder vergessen oder beim ersten Mal nicht verstanden.“
Von diesem Abend an ließ mich Doktor Eichinger Bücher aus seiner privaten Sammlung ausleihen, die besser bestückt und etwas sortierter war. Es schien, als hätte ich mir den Zutritt zu seinem Bücherreich erst verdienen müssen.
Da gab es einige Klassiker der Weltliteratur in seinem Regal, die mich in fremde Zeiten und Welten entführten. Er schätzte die Dramen der alten Griechen.
„Alles andere nur müder Abklatsch!“
Shakespeare fand er zu englisch, Goethe zu belehrend, Schiller zu gehaltlos.
„Aber man muss die alten Schinken zumindest einmal gelesen haben“, pflegte er zu sagen.
Ein paar Geschichtsbücher besaß er auch. Wieder waren ihm die Griechen und Römer die liebsten, auch vermochte er noch großen Gefallen am Mittelalter zu finden. Man merkte ihm doch eine gewisse Liebe zur „germanischen“ Geschichte an. Friedrich I, Barbarossa also, war ihm besonders lieb. Die neuere Geschichte vermochte ihn dagegen überhaupt nicht zu interessieren. Vermutlich waren die Zeichen der Zeit nicht spurlos an ihm vorüber gegangen. Auch besaß der Mann einige philosophische und naturwissenschaftliche Bücher. Aber vor allem gab es da juristische Fachbücher in seinem verstaubten Bücherregal, deren Titel ich nicht einmal verstand.
Doktor Eichinger und ich trafen uns wie gehabt mittwochabends, aber nun unterhielten wir uns über das, was ich gelesen hatte, und er versuchte zu erklären, was ich nicht verstand. Nur über die juristischen Bücher wollte er nicht sprechen, nicht einmal lesen durfte ich diese Bücher.
„Zum einen, mein Junge: Es sind Nachschlagewerke. Sie eignen sich nicht zur Lektüre. Zum anderen: Die Juristerei verfolgt mich bereits den lieben langen Tag. Wenigstens abends will ich verschont bleiben von ihr!“
Ich akzeptierte diese Regelung bereitwillig, schienen mir die dicken Wälzer doch ohnehin sehr trocken und langweilig. Nicht, dass alle andren Bücher gerade packend gewesen wären!
Wie ich nun wusste, wohnte Doktor Eichinger von Donnerstag bis Sonntag in der Stadt und langweilte sich also von Montag bis Mittwoch in unserem Provinznest ganz schrecklich, so dass er sich immer sehr über meine Besuche freute. Zumindest er empfand also Freude.
Doktor Eichinger half mir beim Verstehen der großen Literatur, brachte mir auch das Mühle- und das Schachspiel bei und weihte mich ein in die Kunst des Sarkasmus und der Ironie. Ich sträubte mich lange diese Wortdrehereien, die mir insgeheim etwas verlogen und hinterhältig vorkamen, zu gebrauchen, obwohl sie mir bald zu jeder Zeit auf der Zunge lagen. Es gelang dem Doktor, mich davon zu überzeugen, dass Diskussionen lehrreich waren und man nicht unbedingt zu einer Einigung gelangen musste, ja dass ein Mensch seine Ansichten manchmal sogar stur gegen allen Widerstand verteidigen musste.
„Und merke dir, Konrad: Nur wer kritisch denkt, vermag zu erkennen!“
„Was zu erkennen?“, fragte ich und betrachtete mit schrägem Kopf eine Kopie Dürers Hasen an der ausgeblichenen Wand.
„Alles, mein Junge. Alles.“
Nach einigen Jahren jedoch, da war ich wohl fünfzehn, war Doktor Eichingers Freude an meiner Gesellschaft so gut wie dahin. Meine Wissbegierde wurde ihm allmählich lästig und zugleich, doch das wollte er sich nicht eingestehen, gab es auch nicht mehr viel, was er mich hätte lehren können. Viele Bücher, die da in seinem hohen Regal standen, hatte er selbst nie gelesen. Dass er sie dennoch ausstellte wie Trophäen, war möglicherweise heuchlerisch aber mit Sicherheit peinlich. Dies jedoch war nicht der eigentliche Todesstoß unserer Beziehung: Doktor Eichinger konnte meine Frömmigkeit nicht länger ertragen und wir führten einen fortwährenden und unerbitterlichen Glaubenskrieg in dem ich Gott sicherlich ebenso inbrünstig verteidigte wie es der Erzengel Gabriel an meiner statt getan hätte.
„Du bist ein verdammter Narr!“, rief Doktor Eichinger dann, hatte das Gespräch seinen Höhepunkt erreicht. Der alte Mann tauchte seinen langen Zinken ins Rotweinglas, nahm einen kräftigen Schluck zur Kühlung der überhitzten Gemüter und hustete darauf erbost.
„Siehst du denn nicht, dass es keinen Gott gibt? Hast du das denn noch immer nicht verstanden?“
Sein stechender Blick hätte mich sicherlich eingeschüchtert, wäre ich ihn nicht ebenso gewohnt gewesen wie seinen schrillen Tonfall, der oftmals zu ersticken schien vor spröder Trockenheit.
Ich blieb ruhig. „Doktor Eichinger, ich verstehe durchaus, dass der Mensch auf Gott seine Sehnsüchte projiziert“, bei diesem Wort musste ich immer acht geben, mich nicht zu versprechen: „Ich sehe auch ein, dass viele Menschen den Glauben für ihre Zwecke missbrauchen und dass viel Schlechtes geschieht auf dieser Welt – trotz Gott. Kurz um: Die Theodizee. Aber warum sollte es deshalb keinen Gott geben? Der Mensch ist nun einmal fehlerhaft und erst mit dem Sündenfall ist all das Übel auf die Welt gekommen.“
„Konrad!!!“
Der Doktor war nun wirklich zornig.
„Was sind das für alberne Kindermärchen? Wie kannst du nur so verbissen an einem solchen Humbug festhalten!“
„Doktor Eichinger, wie können Sie so verbissen an Ihren Zweifeln festhalten?“
Nun leuchtete die rote Farbe auf seinen pergamenternen Wangen, die er sich im Laufe des Abends so fleißig angetrunken hatte. Er fuhr aufgebracht fort: „Das musst du doch einsehen, Konrad! Bevor etwas als tatsächlich angenommen werden kann, muss es erst einmal bewiesen werden!“
„Vom naturwissenschaftlichen Standpunkt aus mögen Sie Recht haben. Aber die Frage nach Gott ist keine naturwissenschaftliche Frage; sie spielt sich in einer ganz anderen Dimension ab. Der Glaube braucht keinen Beweis, eben weil er Glaube ist.“
„Aber Konrad, die Menschen glauben nur, weil sie einen Sinn wollen und einen Gott. Aus Angst nämlich. Aus Angst vor dem Tod.“
„Man kann nicht glauben, weil man es will. So wenig wir man hofft oder liebt, weil man es will. Der Glaube wird dem Mensch von Gott geschenkt in seiner Gnade und der heilige Geist ist der Bote dazu.“
Doktor Eichingers Gesicht verwandelte sich in eine schmerzerfüllte Grimasse, dann begoss er seinen Verdruss mit weiterem Wein.
„Sie sind mir nun doch nicht böse?“, fragte ich ihn vorsichtig: „Immerhin haben Sie mich doch zu widersprechen gelehrt!“, und ich grinste ihn bösartig an. Mit einem bösartigen Grinsen und einer bissigen Bemerkung hatte ich ihn meistens versöhnen können.
Einen Moment herrschte ernstes Schweigen. Ich starrte auf den hässlichen Hasen an der Wand gegenüber. Nicht, dass Dürers Eichhörnchen mir besser gefallen hätte, davon konnte ich mich bei jedem meiner Besuche überzeugen. Dieses Kunstwerk nämlich hing im Flur.
„Du bist ein guter Junge, Konrad“, erwiderte der alte Mann schließlich und schüttelte müde den Kopf. Dann nahm er wieder einen Schluck Wein.
Zögerlich fügte er hinzu: „Ein zu guter Junge vielleicht. Aber du wirst die Wahrheit irgendwann erkennen und dann wirst du endlich befreit sein von diesen albernen Vorstellungen, die sie dir da drüben“, er zeigte mit seinem zittrigen knochigen Finger zum Fenster hinaus auf die Kirche, die in der Dunkelheit des Winterabends nur als Schatten zu erahnen war: „die dir dieser lausige Pfarrer da drüben einimpft.“
Ich verkniff mir eine Erwiderung, weil ich den Alten nicht weiter reizen wollte. Mit den Jahren waren seine Reden immer aggressiver und herrischer ausgefallen, seine Argumentation war immer absoluter und doch schwächer geworden. Es hatte keinen Zweck, sich mit ihm anzulegen.
Ob Doktor Eichinger nun bezüglich Gottes Existenz richtig lag oder nicht, zumindest mit einer seiner Aussagen lag er falsch. Ich glaubte nicht, weil der Pfarrer, dieser dickliche, pickelige Mann, der höchstens noch an einen Schweinehirten gemahnte, irgendeinen unlauteren Einfluss auf mich hatte - oder gar meine Eltern, die doch eigenständig noch keinen einzigen Vers der heiligen Schrift gelesen hatten. Ich glaubte, weil ich mir den Glauben selbst mit all meiner Kraft „einimpfte“, wie es der Doktor genannt hatte. Selbst-kasteiend rammte ich mir die Spritze tagtäglich ins Fleisch und verabreichte mir das heilige Serum. Zwar war ich kein Ministrant, wie Fred es war, denn meine knapp bemessene Zeit ließ dies kaum zu und zudem taten die Ministranten mehr Unsinn als Dienst an Gott, aber ich besuchte die Kirche, so oft ich nur konnte. Nicht nur jeden Sonntag, nein oft auch unter der Woche fand man mich im Gotteshaus. Dort kniete ich still vor der heiligen Jungfrau in blauem Gewand, die da ein wissendes Lächeln aufgelegt hatte, und betete ehrfürchtig. Ich war sozusagen ihr größter Fan. Stets zündete ich eine Kerze an und dankte jedem für alles und betete nie für mich selbst. Alle Heiligen in den bunten Fenstern waren sich sicher: Wenn einer einen Platz im Himmel verdient hatte dann der sittsame Junge dort unten zu Füßen der Maria. Petrus hätte mich mit offenen Armen empfangen. Dann hätte er, während er mit dem großen Schlüssel hantierte, beiläufig bemerkt: „Wir warten alle schon so lange auf dich. Er spricht in den höchsten Tönen von dir.“
Ich hätte selbstverständlich äußerst bescheiden zu Boden geblickt. Dann wären die großen Torflügel aufgeschwungen und unter wunderbaren Sphärenklängen hätte Petrus lächelnd erklärt: „Dann Mal ‘rein in die gute Stube!“
Vielleicht scheint es hier irrtümlicherweise so, als hätte ich Doktor Eichinger gern gehabt, den alten Mann gut leiden können. Tatsächlich jedoch plagten mich vor jedem Treffen Bauchschmerzen. Sie saßen etwa auf Höhe meines Bauchnabels und standen in Zusammenhang mit einem latenten mittwöchigen Durchfall.
Diese Stunden in Doktor Eichingers Wohnzimmer waren weit furchterregender als jede Klassenarbeit. Der Alte nämlich stellte mich nicht nur auf die Probe, sondern quälte mich mit Abscheu und mitunter Geschrei, wann immer ihm eine meiner Meinungen nicht passte. Auch fluchte er manchmal, dass ich es kaum ertragen konnte. Zudem war ich durch die bevorstehenden Treffen gezwungen, die bisweilen unerträglich trockenen und unverständlichen Bücher zu lesen, die im besten Fall noch einige Abbildungen enthielten. Von einer Zeichnung quälte man sich dann dankbar über jedes entfallene Wort zur nächsten, wie ein Schiffbrüchiger von einer Sandbank zur anderen ohne doch jemals wirklich trockenen Fußes zu sein.
Es stellt sich natürlich die Frage, wieso ich mich dennoch auf diese grauslichen Treffen einließ und zudem noch an meinen eignen Meinungen festzuhalten versuchte. Für diesen Entschluss waren wieder einmal zwei Dinge verantwortlich: Zum einen eine übergroße Selbstbeherrschung und zum anderen eine überstarke Vernunft. Denn ich wusste, dass Doktor Eichinger mir Dinge beizubringen vermochte, die mich sonst niemand hätte lehren können. Und wie Mutter zu sagen pflegte: „Lerne so viel du nur kannst, Konrad. Wissen ist niemals von Schaden.“
Doktor Eichingers größter Verdienst war es dabei, dass er mir sozusagen die Zunge gerade bog. Er trieb mir den Dialekt aus und lehrte mich in Rhetorik. Zum einen lernte ich dabei durch das bloße Zuhören, denn der Doktor war ein ziemlich respektabler Sprecher, zum andren korrigierte mich der Mann zumindest zu Beginn unserer Bekanntschaft fortwährend, ließ kaum einen meiner Sätze bestehen. Zudem wurde ich durch Doktor Eichingers Unterricht in eine Disziplin eingeführt, die ich in einigen Jahren in Perfektion beherrschen würde. Noch war ich zwar ein wenig unbeholfen, doch später würde es mir gelingen, nahezu mühelos von einer Rolle in die andre zu schlüpfen. Unter des Hasens wachsamen Blick übte ich mich zum ersten Mal im Spiel, auch wenn ich mich noch nicht ganz und gar von mir lösen konnte. Denn war ich dem alten Mann gegenüber auch skeptisch, bisweilen herausfordernd und stets um Wortgewandtheit bemüht, so gelang es mir doch nicht, meine schlichte Bodenständigkeit loszuwerden. Und gab ich mich Zuhause und in der Schule brav, friedliebend und zurückhaltend, so fiel es mir doch schwer, meinen kritischen Geist einfach auszuschalten und das Erlernte bis zum nächsten Mittwoch zu vergraben. - Wie mich Mutter angesehen hatte, als ich eines Mittags am Tisch erklärt hatte, Frau Meier wäre der jovialste Mensch, den es wohl auf diesem Planeten gäbe. Ihre Züge waren hart geworden und sie hatte bemerkt: „Du sollst nicht so über andre Menschen sprechen, Konrad.“
Ich hatte sie irritiert angesehen, dann beschämt in meiner Kartoffelsuppe gelöffelt. Widerspruch war von Mutter noch nie toleriert worden.
Nach einer ziemlich langen Pause hatte Fred schließlich bemerkt: „Konrad sagt doch nur, was ohnehin alle denken. Die Alte ist komplett irre. Karl hat sie neulich mit seinem Vater verwechselt. Mit hundertundfünfzig ist man vermutlich nicht mehr ganz klar im Kopf.“
Er hatte sich mit dem Zeigefinger gegen die Schläfe getippt, ihn dann mitsamt seinem Kopf kreisen lassen. Das breite Grinsen entblößte Petersilie zwischen seinen Zähnen. Die saß bei ihm immer am gleichen Eckzahn.
Mutter sah nun auch ihn tadelnd an. Nach einigen Minuten der Stille kam dann noch ein zweites Thema auf den Tisch. Vater solle endlich den Schuppen aufräumen - Ihren stechenden Blick nahm Vater jedoch überhaupt nicht war, fragte stattdessen: „Was bedeutet jovial?“
„Das wird dir Konrad erklären können!“
Den Löffel hielt sie fest in der Hand.
„Jovial bedeutet fröhlich. Weil Frau Meier… Sie freut sich über alles und jeden und…“
„Ist ja auch völlig nebensächlich“, unterbrach Mutter mich jäh. „Ich möchte, dass du nachher den Schuppen aufräumst, Josef. Man kann sich da drinnen ja kaum noch um sich selber drehen.“
Und wo ich mich gerade alter Tage besinne, sind wohl auch einige Sätze über die Schule angebracht. Irriger Weise könnte man meinen, für einen strebsamen, wissensdurstigen Jungen, oder einen, der sich die größte Mühe gab, solch ein Junge zu sein, könnte es keinen schöneren Ort auf der Welt geben als eine öffentliche Lehranstalt. Tatsächlich jedoch empfand ich den Unterricht in diesem heruntergekommenen Bau, den auch die künstlerischen Meisterwerke der nicht einmal mittelmäßig begabten Dorfjugend nicht aufzuwerten vermochten, als fortwährende Qual.
Es ist wohl bereits zu erahnen, dass ich nicht viel Neues lernte im sogenannten Unterricht. Trotzdem immer aufmerksam zu sein, war eine bisweilen zu große Herausforderung selbst für meine Selbstbeherrschung. Ich tuschelte nicht mit meinem Nachbarn. - Ohnehin hatte ich bald eine Bank für mich allein oder teilte sie mir mit dem größten Trottel. Diesen freilich hatte mir dann die Lehrerin zur Seite verpflanzt, damit ich ihm ein bisschen behilflich wäre – oder ihr. Ich schrieb auch keine Zettelchen oder kritzelte auf meinen Tisch und las erst recht nicht in Comicheften. Nicht einmal meine Stifte wagte ich zu sortieren, um ehrlich zu sein. - Stattdessen träumte ich, oder besser gesagt: Ich dachte nach, denn ich gab nie viel auf Luftschlösser.
Über die Gespräche mit Doktor Eichinger ließ sich Stunden grübeln oder über die Texte, die ich kürzlich gelesen hatte. Blickte man aus dem Fenster konnte man zudem das große Haus auf dem Hügel sehen. Wahrscheinlich hätte man diesem Haus einen schwülstigen Namen geben müssen: Geistervilla zum Beispiel. Aber für uns Kinder war es schon immer das große Haus auf dem Hügel gewesen.
Solange ich denken konnte, hatte das Gebäude leer gestanden. Dabei war es wohl einst das herrschaftlichste Bauwerk im Ort gewesen. Mittlerweile aber war es ziemlich heruntergekommen. Einige Dachziegel hatten sich gelöst und entblößten ein morsches hölzernes Gerippe, die Fensterscheiben waren größtenteils zerbrochen und in den Dachrinnen spross das Unkraut. Da oben auf dem Hügel, etwas abseits vom Dorf, verfaulte das Gebäude langsam aber doch irgendwie ehrerbietend. Eine etwa fünfzig Meter lange Zufahrt rückte es in die gebührende Entfernung zu den schäbigen Häusern, die das Dorfbild prägten.
Das große Haus auf dem Hügel, das wohl Mitte des 19. Jahrhunderts errichtet worden war - angeblich von einem reichen Fabrikanten aus der Stadt, der sich eine Art Landgut in mitten der Wälder hatte errichten wollen -, verlieh dem ganzen Dorf einen morbiden Anstrich. Düster und herrisch thronte es über den kleinen und schiefen Fachwerkhäusern. Uns Kindern freilich diente es hervorragend zum Versteckspiel; das rostige Schloss am Dienstboteneingang war längst einem Stein erlegen.
Wenn ich nun im Klassenzimmer meine Zeit absaß und das große Haus auf dem Hügel betrachtete, dann träumte ich nicht davon, später einmal in ihm zu leben – wie es Fred manchmal tat - und ich stellte mir auch nicht vor, wie die Bewohner dort einst ihre Tage zugebracht hatten.
In der ersten Klasse, da zählte ich: Türen, Fenster, Dachziegel, Holzlatten, Gitterstäbe. Bis ich selbst die Anzahl der Zaunpfosten auswendig kannte: 43. Dann - in der zweiten Klasse – multiplizierte ich die Zahlen miteinander, teilte sie durcheinander. Mutter hatte mir dies beigebracht, damit ich sie im Laden recht gut vertreten konnte, war sie gerade am Bügel oder Nähen im oberen Stock. - Vater war nicht gut im Rechnen, weshalb sie ihn nur ungern an die Kasse ließ.
Ich war nicht gut im Kopfrechnen, hätte gerne Stift und Papier genutzt. Aber ich wollte keine der albernen Klassenregeln verletzen, die auf dem großem gelben Plakat aufgelistet waren. Drohend und mahnend starrte es mir entgegen. Mit vielen Klebestreifen hatte Frau Tann das Papier an der Wand befestigt und trotzdem löste sich dessen obere linke Ecke fortwährend vom Putz. Sehr zur Erheiterung der Schüler wohlgemerkt. Ich rang mir zumindest ein Lächeln ab, vergrub das Plakat Gunni zum wiederholten Male unter sich. Der Rest der Klasse johlte.
In der vierten Klasse machte ich mich daran, die Geometrie zu erkunden. Ich kannte die platonischen Körper und wusste, welches der vier Elemente dem Ikosaeder und welches dem Hexaeder zugeordnet war und dass der Dodekaeder für den Äther stand. Auch wenn mir die Logik der alten Griechen nicht recht einleuchten wollte und ich nicht wusste, wie die chemischen Elemente aus dem Periodensystem ins Bild passen wollten.
Jedenfalls kannte ich schon lange den Unterschied zwischen Raute, Parallelogramm und Trapez. Wenn Frau Tann von Vierecken sprach und damit Quadrate meinte, dann deprimierte mich das. Ich wartete auf etwas, das einfach nicht eintreffen wollte: Dass Frau Tann oder ein anderer Lehrer mich beiseite nahm und erklärte: „Für dich ist es jetzt genug hier – du bist zu gut für die anderen.“
Wie gesagt blieb eine solche Bemerkung jedoch aus und so saß ich, wenn ich meine Aufgaben erledigt hatte, weiterhin still auf meinem Stuhl und dachte nach. Auch wenn ich die Mathematik am liebsten hatte, so ließen sich bei Betrachtung des großen Hauses auf dem Hügel noch gänzlich andere Überlegungen anstellen. Es gab zum Beispiel drei Fenster im dritten Stock. Drei. Drei griechische Götterbrüder: Zeus, Poseidon, Hades, die sich die Welt hatten teilen müssen. Auch wenn Hades den kürzeren gezogen hatte und Poseidon, obwohl er als erster hatte wählen dürfen, doch nicht Göttervater war. Drei nordische Nornen gab es dann, die das Schicksal regierten: Urd, Verdandi, Skuld. Die eine für das Gewordene, die andre für das Werdende und die dritte schließlich für das Werdensollende. Und natürlich die drei Formen meines Gottes: Die Dreifaltigkeit. Der Vater, der Sohn, der heilige Geist. Auch wenn ich nie recht verstehen konnte, was es damit eigentlich auf sich hatte.
Ich hatte schon recht bald verstanden, dass in der Schule eigenes Denken unerwünscht war. Es handelte sich um einen Ort der Wiedergabe. Ob es sich dabei nun um das Wissen handelte, was im Schulbuch zu finden war, oder das Wissen, das der Lehrer verkündete: Mein Verstand war nicht beteiligt. Die Erkenntnis, dass eigenes Denken fehl am Platze war, kam mir bereits in der ersten Klasse. Da zeigte sich Frau Tann als völlig uneinsichtig. Als ich ihr klarzumachen versuchte, dass der 17. Buchstabe des Alphabets, das Q, doch auch anders geschrieben werden könnte, da diese Schreibweise einfacher, ebenso lesbar und überhaupt praktischer wäre, nahm sie meinen Kommentar nicht einmal ernst und lächelte lediglich müde. So setzte es sich in einem fort. Man beharrte stur auf Regeln, so sinnlos und unergiebig sie auch sein mochten. Mathematikaufgaben durften nur auf dem vorgeschriebenen Weg gelöst, Ereignisse nur bewertet und Texte nur interpretiert werden, wie der Lehrer es verlangte und zu begreifen vermochte.
Es stand für mich bald eindeutig fest: Hier waren eigene Ideen nicht erwünscht und der begrenzte Horizont der Lehrer müsste fürs nächste auch der meine werden. Meine Aufgabe als guter Schüler bestand demnach darin, die Gedanken und Ideen der Männer und Frauen dort vorne zu erahnen. Und bald schon erwies ich mich als wahrer Meister in dieser Disziplin.
*
Fred hatte die Gymnasialempfehlung trotz seiner offensichtlichen Mittelmäßigkeit wohl erhalten, da man annahm, er wäre als mein Zwillingsbruder zu ebensolchen intellektuellen Leistungen fähig wie meine werte Wenigkeit. Das war er aber nicht! Nicht, dass er dümmer gewesen wäre! Ehrlich gesagt hatte ich sogar häufig den Eindruck, er war um einiges klüger. Aber er war faul. Und eine Erkenntnis fußte nun mal auf der anderen. Wissen um Fakten und Zusammenhänge musste man sich hart erarbeiten, da halfen auch alle Geistesblitze und originellen Einfälle nichts.
Aber konnte man dem Jungen verübeln, dass er lieber mit seinen Freunden hatte Fußball spielen oder schwimmen gehen wollen, er lieber Baustein-Städte errichtet oder in seinem Baumhaus gesessen und gefaulenzt hatte?
Tatsache war auf jeden Fall: Ich hatte nach wenigen Jahren schon so viel Vorsprung im Denken, dass Fred mich nie mehr hätte aufholen können, selbst wenn er sich tüchtig ins Zeug gelegt hätte. Doch selbst damals schon dachte ich hin und wieder, dass ihm seine Faulheit nur zugute kam. Denn Fred, der jeden Morgen Mühe mit dem Aufstehen hatte, stets verkündete, er bliebe lieber Zuhause und die Schule sei blöde, fühlte sich dort tatsächlich weit wohler, als ich es jemals tat. Er war unter den Klassenkameraden sehr beliebt und sogar die Lehrer hatten ihn gern. Ich dagegen hatte stets das Gefühl, dass mich weder Lehrer noch Schüler leiden konnten. Natürlich schätzte man meine Freundlichkeit, Höflichkeit und Hilfsbereitschaft, meine Kameradschaftlichkeit, denn eine Petze war ich nie. Aber niemand konnte mein fortwährend beispielhaftes Verhalten ertragen. So war ich meist allein.
Doch um ehrlich zu sein: Ich hätte ohnehin keine Zeit gehabt, mich mit Freunden zu treffen. Schließlich wollte ich meine Hausaufgaben gründlich und ordentlich erledigen, hatte ich mich vorzubereiten auf meine Gespräche - Auseinandersetzungen - mit Doktor Eichinger und im Laden zu helfen. Denn Vater konnte, wenn ich im Laden die Stellung hielt, im Hof sitzen und schnitzen, Mutter hatte dann Zeit zur Haus- und Handarbeit. Seit ein Supermarkt im Nachbarort eröffnet worden war, warf der Laden nicht mehr sonderlich viel ab. Ich versuchte meinen Teil beizutragen, in dem ich meinen Eltern zur Hand ging, wo ich nur konnte. Meist erledigte ich meine Hausaufgaben hinter der Ladentheke. Und Samstagmorgen war ich es, der pünktlich um 7:00 Uhr öffnete, damit der Rest der Familie ausschlafen konnte. Noch vor der Schule verkaufte ich die ersten Zeitungen.
Ich pflegte innige Beziehungen zu vielen Rentnern im Dorf, denen ich auch die Einkaufstaschen nach Hause trug. Hier und da gab es ein kleines Taschengeld für meine Mühe und Frau Reger unterrichtete mich zur Gegenleistung im Klavierspiel. Jeden Dienstag.
Sich selbst tat Frau Reger dabei allerdings den größten Gefallen, denn sie war seit dem Tod ihres Mannes eine sehr einsame Frau. Fred war anfangs auch mitgekommen, hatte aber schon recht bald die Lust am Musizieren verloren. Ich übte fleißig trotz mangelnder Begabung. Fast jeden Nachmittag von meinem achten Lebensjahr an verbrachte ich eine Stunde bei Frau Reger, sie kochte dann währenddessen oder bügelte, und am Dienstag wie gesagt unterrichtete sie mich.
Zwar war ihr Haus auf das Penibelste geputzt und jedes Etwas schien einen eignen Platz zu besitzen, alles äußerst adrett und gepflegt, doch das Wohnzimmer befand sich dauerhaft im Ausnahmezustand. Um zum Klavier zu gelangen, musste man erst einmal über einige Kartons steigen, deren Deckel nur schräg auf den Kisten lagen, weil diese so voll mit Kram waren. Es folgten ein kaputter Plattenspieler, abgehängte Bilderrahmen mit alten Fotos hinter den staubigen Scheiben, einige vertrocknete Topfpflanzen, Aktenordner und schließlich ein Durcheinander an Papieren und Dokumenten, das sich über den Teppich ergoss. Nur wenn Frau Reger mich unterrichte, waren die Gardinen aufgezogen. Die Frau verbot mir, die schweren Vorhänge eigenmächtig zur Seite zu ziehen. So spielte ich Mittwoch bis Montag selbst bei helllichtem Tage im Licht einer staubigen Lampe. Auf der Fensterbank hatten zu Beginn meines Unterrichts genau drei tote Fliegen gelegen. Ich hatte damals Mühe gehabt, meinen Ekel zu verbergen. - Sauber war es bei uns daheim immer gewesen. Bei meinem letzten Besuch im Haus der alten Dame, mehr als zehn Jahre später muss das gewesen sein, hatte ich an die zwanzig Fliegen gezählt. Ich hatte mich bis zuletzt nicht an ihren Anblick gewöhnen können.
War Frau Reger einmal nicht daheim, versteckte sie einen Schlüssel für mich im Schuppen unter einer chinesisch anmutenden Porzellanvase. Unzählige Spinnen lauerten in diesem Bretterverschlag.
Nach einigen Jahren fleißigen Übens durfte ich jeden Sonntag die Kirchenorgel spielen. Das erste Mal wohl mit etwa dreizehn Jahren. Papa war sehr stolz, Mutter verbiss sich jegliche Worte des Lobes. Und tatsächlich war auch ich nie mit meinem niemals fehlerfreien Spiel zufrieden, das im großen Kirchenschiff besonders schauerlich erklang. Vor Frau Regers Kritik immerhin brauchte ich mich nicht zu fürchten, da sie zwar selbst einmal die Orgel gespielt hatte, sie jedoch nicht länger die Predigt besuchte. Mit dem Pfarrer hatte sie sich schon vor langer Zeit zerstritten. Gerüchten zufolge hatte er ihren Ehemann nicht auf dem Friedhof beerdigen wollen, nachdem sich dieser wohl eines schönen Tages im Schuppen erhängt hatte. Tatsache war zumindest, dass Herr Reger im Nachbarort beerdigt worden war und Frau Reger die Kirche mied wie Fred die Besenkammer.
An das Anrücken des Notarztes und der Polizei in jener Februarnacht vor fast zwanzig Jahren waren beinahe so viele Gerüchte im Umlauf, wie über jenen Tag, als Vater den toten Poko durchs gesamte Dorf geschleift hatte. Damals war er vielleicht sechs Jahre alt gewesen. Ein schmächtiger Junge.
Wie Poko den Tod gefunden hatte, der große schwarze Wachhund, der auf dem Hof ziemlich gefürchtet gewesen war, sollte für immer ein Rätsel bleiben. Fest stand lediglich, dass der kleine Jupp den toten Hund zum Friedhof gezogen hatte, ohne eine Miene zu verziehen. Den ganzen Hügel hinauf bei brütender Mittagshitze. Es wäre im Übrigen geschickt gewesen, Mutter hätte uns von Vaters großem Auftritt berichtet, bevor Tizian Effner uns als Söhne eines irren Bastards und Hundemörder bezeichnet hatte. Dass wir die dämlichen Söhne eines Idioten seien, waren wir zu hören gewöhnt, aber dass Vater nun auch noch verrückt und blutrünstig war, das war doch neu für uns. Und Schwachsinn ließ sich auch viel schlechter widerlegen als Dummheit.
Aber wollte ich nicht von Hannelore Reger erzählen? Meiner Klavierlehrerin?
Nun im Vergleich zu Doktor Eichinger war sie eine durchaus verträgliche Person. Sie war eine etwas dickliche, ziemlich große Frau – wobei ihre üppig gedrehten Locken sie noch größer erscheinen ließen - mit langen Fingernägeln, die jeden Ton, den sie auf dem Klavier spielte, mit einem Klicken untermalten. War es mal wieder soweit, so legte sie ihre qualmende Zigarette für einen Moment auf den Porzellanteller neben dem Notenständer und erklärte: „Konrad, höre jetzt Mal genau zu. Du musst hier staccato spielen und nicht alles legato. Wie klingt das denn sonst? Als ob einer besoffen wäre!“
Dann ließ sie ihre faltigen Hände über die Tasten fliegen und ich konnte ihrem Spiel nur staunend folgen. Trotzdem war dieses Klicken entsetzlich.
Ich verbrachte aber nicht all meine Freizeit im Laden, bei Doktor Eichinger, Frau Reger oder beim Beten. Manchmal nahm mich Fred auch mit in sein Baumhaus oder zum Fußball spielen. Allerdings, und das dürfte wohl keine große Überraschung sein, stand ich dort immer außen vor. Zum einen schloss ich mich selbst aus, denn weder mochte ich mich über andre lustig machen, noch beteiligte ich mich an jedweden Streichen, zum andren aber konnten mich Freds Freunde schlicht nicht leiden.
Zwar gab es einige wenige Beschäftigungen, denen ich mich nicht verwehren musste: Das Baumhaus umbauen oder ausbauen, draußen mit den Fahrrädern umherfahren, den Schiedsrichter geben für jegliche Spiele, aber mir war stets bewusst, dass ich nur meinem Bruder zuliebe geduldet wurde. Auf ihn wollte man nicht verzichten, auch wenn ich nie verstand, warum eigentlich. Fred hatte weder die ausgefallensten Einfälle, noch war er besonders sportlich oder tatkräftig. Trotzdem war er sehr beliebt. Nicht nur bei den Kindern im Dorf, auch die Erwachsenen schätzten ihn. Mein Bruder war sehr ungezwungen, spontan, offen, redselig. Selbst seine Ungeschicklichkeit schien niemanden zu stören, machte ihn nur liebenswerter. Stolperte er mal wieder über eine Türschwelle, lachte er so herzlich, dass man nicht anders konnte, als ihn anzulächeln. Auch fanden die Leute seine Bemerkungen erheiternd. Er war witzig. Ganz offensichtlich besaß er Geist, mein Bruder. Selbst die Lehrer konnten sich, hatte er mal wieder einen seiner klugen aber doch so geerdeten Bemerkungen gemacht, ein Lächeln nicht verkneifen. Er hatte einen ursprünglichen, naiven Charme, der so gar nicht aufdringlich war. Wie neidisch ich auf ihn war! Mein Hang zur Perfektion hatte mich jedweder Ungezwungenheit beraubt. Ich mochte Fred zwar in allem übertrumpfen, aber sobald er den Raum betrat, interessierte sich niemand mehr für meine Glanzleistungen. Dabei war er ebenso hässlich wie ich. Ich fühlte mich immer schrecklich unwohl in seiner Gegenwart. Ein latentes Minderwertigkeitsgefühl und doch verachtete ich ihn zutiefst, verachtete ich ihn für seine Faulheit, Bequemlichkeit, Unwissenheit. Und im Grunde auch dafür, dass er mich abgöttisch liebte. Es erstaunt daher wohl nicht, dass ich ihn nur ungern begleitete. Zumal seine Freunde mich wie gesagt nicht ausstehen konnten, besonders Thomas. Einmal bekam ich dessen Hass sogar am eigenen Leib zu spüren. Da war ich vierzehn. Es war das letzte Mal, dass ich Fred begleitete.
Thomas, Karl und Robbi saßen bereits im Baumhaus als Fred und ich eintrafen. Es war Dienstag und eigentlich hätte ich Klavierunterricht gehabt, doch Frau Reger war krank und so hatte ich mich schließlich von Fred überreden lassen, ihn zu begleiten. Ohnehin gehörte es sich für einen anständigen Jungen, auch etwas Zeit unter Gleichaltrigen zu verbringen! Und Fred? Aus irgendeinem Grund schätzte mein Bruder tatsächlich meine Gesellschaft.
Als ich hinter ihm die wild baumelnde Strickleiter hinaufkletterte, da wuchs in mir bereits der Unmut. Aber ich würde mich zusammennehmen! Wieso hätte ich meine Freunde denn nicht gerne treffen sollen? Doch tatsächlich waren dies nicht meine Freunde und die schmutzige Strickleiter allein war mir bereits zuwider. Und auch wenn ich mir meine Abneigung nicht eingestehen wollte, so wuchs mit jeder weiteren Sprosse der widerliche Klos in meinem Bauch. Ich griff mit schlammbeschmierten Fingern nach den Holzbrettern, aus denen der Boden zusammengeflickt war und zog mich nach oben. Es war augenscheinlich, dass ich nicht willkommen war. Ich blickte in ablehnende Gesichter. Doch Fred streckte mir seine Hand entgegen und zog mich grinsend nach oben. Er schien völlig blind für den Missmut seiner Freunde. Ich setzte mich auf den letzten verbliebenen Platz auf dem Boden: zwischen Fred und die Luke.
„Ihr seid zu spät“, erklärte Karl, der immerhin ein falsches Lächeln zustande brachte, und klopfte auf seine Armbanduhr. Diese Geste hatte er sich bei seinem Vater abgeschaut. Der stand auch immer vor dem Laden und klopfte auf die Anzeige, während seine Frau sich mit Vater unterhielt.
„Tut mir leid“, erwiderte Fred: „Aber wir mussten noch im Laden helfen.“
Eigentlich hatte Fred nur dagestanden, während ich die Regalfächer ausgewischt hatte. Begeistert hatte er mir erzählt, wie geschickt er bei der Englischarbeit seinen Spickzettel im Mäppchen versteckt hatte. Ich hatte mir einen ermahnenden Kommentar verkniffen.
Es herrschte ein verlegenes Schweigen im Baumhaus.
Thomas sah mich genervt an, meinte dann den Blick zu Fred wendend: „Und jetzt?“
„Also“, erklärte Fred und warf einen vielsagenden Blick durch die Runde, beugte sich dann ein Stück nach vorn: „Als ich gestern von Karl nach Hause gelaufen bin, dachte ich mir: Schau doch noch mal kurz beim Haus auf dem Hügel vorbei.“
Karl und Robbi schluckten den Köder und schauten Fred neugierig an, während Thomas die Arme verschränkte und sein Interesse noch immer meiner unerfreulichen Anwesenheit galt. Er wandte trocken ein: „Wir waren da schon hundertmal. Wird allmählich langweilig, sich in dem blöden Haus herumzutreiben.“
„Es ist nur so, dass ich mir ganz sicher bin: Da drin muss es noch irgendein Versteck geben; so reiche Leute haben immer irgendwo ein Versteck für ihre Wertsachen.“
Thomas schüttelte missmutig den Kopf.
„Wir haben da schon jeden Stein drei Mal umgedreht, Fred. Da ist nichts.“
„Wir haben aber bisher immer nur im Haus gesucht. Ich denke jetzt aber, das Versteck muss im Garten sein. Und zwar gibt es drei Gründe, die dafür sprechen. Erstens“, und Fred streckte den Daumen in die Höhe: „Es muss ein Versteck geben. Zweitens“, jetzt gesellte sich der Zeigefinger dazu: „Es ist offensichtlich nicht im Haus.“
Und mit seinem „Drittens“, war das Dreigespann aus Daumen, Zeige- und Mittelfinger vollständig: „Und drittens“, wiederholte er: „Im Garten gibt es diverse Verstecke. Und wir haben bisher noch gar keinen Gedanken daran verschwendet, dass das Versteck auch im Garten sein könnte.“
„Weil die Idee total bescheuert ist, Fred. Deshalb haben wir da bisher nicht gesucht!“
„Ja, aber vielleicht hat sich das der Erbauer von dem Haus auch gedacht, dass da bestimmt niemand sucht, Thomas. Ich finde, einen Versuch ist es zumindest wert!“
Karl, Freds treuester Freund, nickte zustimmend und meinte: „Kann auf jeden Fall nicht schaden.“
„Macht, was ihr wollt!“, und Thomas verschränkte die Arme und ließ sich zurückfallen gegen die Wand: „Aber ich habe keine Lust, mich da durch das Dornengestrüpp zu wühlen!“
Er war nur deshalb so feindselig gegenüber Freds Vorschlag, weil mich dieser mitgenommen hatte. Mit seinen Worten hatte Thomas meinen Bruder auf jeden Fall herausgefordert, und dieser ließ es sich nicht gefallen, wenn man seine Autorität als Leithammel untergrub.
„Und was schlägst du vor?“, fragte Fred deshalb in arrogantem Tonfall. Das lag ihm. Und er setzte noch drauf: „Sollen wir wieder zu euch daheim gehen zum Fußball spielen? Damit deine Mutter motzt, weil wir den Rasen ruinieren?“
„Nein. Aber wir könnten auch einfach das machen, was wir verabredet haben“, und Thomas‘ Augen funkelten triumphierend: „oder traust du dich nicht, jetzt wo dein blöder Bruder dabei ist?“
Ich bemerkte peinlich berührt: „Ich wollte euch nicht stören. Vielleicht ist es wirklich besser, wenn ich gehe. Ich muss ohnehin noch ein paar Kapitel lesen und...“
Ich machte mich schon an den Abstieg, als Fred mich am Arm berührte und mir so signalisierte noch einen Moment zu bleiben. Er erklärte nüchtern: „Also zu erst einmal Thomas: Wer ein Problem mit meinem Bruder hat, hat auch eines mit mir. Zum anderen: Die Idee mit dem Whiskey ist einfach doof. Und das hat überhaupt nichts mit Konrad zu tun.“
„Du traust dich doch nur nicht, vor den Augen dieses elenden Heiligen da etwas Verbotenes zu tun!“
„So ein Schwachsinn, Thomas. Du weißt genau, dass ich kein Feigling bin. Aber etwas Dummes zu tun, ist einfach nur dumm.“
Mein Bruder war ganz und gar nicht auf den Mund gefallen.
„Wisst ihr“, mischte ich mich nun ein: „ich bin ohnehin nur hier, weil Fred mich gebeten hat. Ich gehe einfach nach Hause und ihr könnt dann machen, was immer ihr wollt. Ist ja nicht schlimm.“
„Das ist eine verdammt gute Idee“, meinte Thomas und lehnte sich wieder lässig zurück. Mein Bruder sah mich kopfschüttelnd an.
„Du musst nicht gehen, Konrad. Du hast auch mitgeholfen, das Baumhaus zu bauen. Du darfst hier genauso sein wie wir.“
„Ist schon gut, Fred. Ehrlich. Lass einfach gut sein!“
Ich lächelte ihn beschwichtigend an.
„Na schön. Dann komme ich aber mit. Habe jetzt auch keine Lust mehr auf diesen Mist“, und er sah Thomas kopfschüttelnd an.
Als Fred und ich unten angekommen waren, rief uns Thomas durch die Luke zu: „Ich weiß gar nicht, wer von euch beiden der größere Idiot ist. Habt ihr bestimmt von eurem Vater!“
Fred wandte sich aufgebracht um und wollte etwas erwidern, aber ihm fehlten die Worte. Obwohl schließlich jeder Konflikt unter uns Jungen damit endete, dass einer etwas gegen unseren Vater sagte, hatte Fred sich noch immer nicht daran gewöhnt. Er reagierte immer auf die gleiche Weise: Unheimlich aufgebracht und doch sprachlos. Dabei hatte er sonst immer die flinkste Zunge von uns allen. Es war also an mir das Wort zu ergreifen.
„Es kann sich ja jeder sein eigenes Bild von unsrer Intelligenz machen.“
Immerhin war ich Klassenbester und Fred trotz seiner unsäglichen Faulheit noch immer ein deutlich besserer Schüler als Thomas es war.
Dann meinte ich mit gesenkter Stimme: „Komm jetzt, Fred. Lass uns einfach nach Hause gehen.“
Und damit machten wir uns auf den Weg durch das nasse Herbstlaub.
Ich wollte gerade den Reißverschluss meiner Jacke schließen, das Ding klemmte mal wieder, als hinter uns Geraschel zu hören war. Unerwartet wurde ich nach vorne zu Boden geworfen, fiel auf meinen eignen Arm, dass er schmerzvoll verdreht wurde. Völlig perplex lag ich ihm Laub. Der Geruch von nasser Erde war allgegenwärtig. Ich wurde auf den Rücken gedreht und erkannte Thomas zorniges Gesicht. Ich empfand eher Überraschung als Angst.
„Du eingebildetes Schwein!“, rief er und dabei landete ein Tropfen Spucke in meinem Gesicht. Ich zuckte angeekelt zusammen.
Als Thomas es sich auf meiner Brust bequem machte, fiel mir das Atmen schwer. Der Junge war groß und kräftig für sein Alter. Dass er zudem ein Rüpel war, brauche ich wohl nicht mehr zu erwähnen.
„Hältst dich wohl für einen ganz Schlauen!“
Er sah mich wütend an, wartete wohl darauf, dass ich mich wehrte, aber ich lag nur da, betrachtete seine bebenden Lippen. Meine Teilnahmslosigkeit irritierte ihn. Thomas schlug mir seine Faust ins Gesicht. Wohl eher um mir eine Reaktion abzugewinnen, als um mich zu verletzen. Nicht, dass der Schlag nicht teuflisch weh getan hätte!, doch der Zorn in seinem Gesicht war einem tiefen Unverständnis gewichen.
Ich spürte das Blut, das mir immer tiefer in den Schädel sickerte, so wie wenn man beim Tauchen Wasser in die Nase bekommt. Mein ganzer Kopf pochte und mir schwindelte.
„Bist sogar zu feige, dich zu wehren!“
Thomas erhob sich.
Ich flüsterte heiser, das Blut abschluckend: „Falls ich dich gekränkt habe, möchte ich mich dafür entschuldigen.“
„Du bist doch total irre!“
Er wandte seinen Blick angewidert von mir, ließ mich einfach im nassen Laub liegen und kehrte dann stapfend zum Baumhaus zurück. Dabei rempelte er noch meinen Bruder an, der starr dastand und die ganze Vorstellung wohl völlig regungslos beobachtet hatte.
Karl und Robbi hatten dem Geschehen vom Baumhaus aus zugesehen. Ich richtete mich auf und endlich half mir Fred. Noch immer war er völlig verdutzt.
Auf dem Weg nach Hause bemerkte er dann: „Er hat dich ganz schön erwischt. Was für ein Idiot! Ich hätte etwas tun müssen, dir helfen müssen! Und was mache ich? Stehe nur dumm herum wie ein vollkommener Trottel. - Tut mir leid.“
„Du brauchst dich nicht zu entschuldigen“, und ich schniefte und versuchte mir mit dem Handrücken das Blut aus dem Gesicht zu wischen, verteilte es jedoch nur großflächig.
„Es war meine eigne Schuld“, setzte ich hinzu: „Ich hätte ihn nicht reizen sollen.“
„Na, ich hätte ihn wenigstens für dich verhauen können!“
Ich sah Fred ermahnend an.
„Na, wenn du dir die Finger nicht schmutzig machen willst... Ich hab‘ damit kein Problem.“
Er lachte laut auf. Doch wir beide wussten, dass er sich nur ungern prügelte. Wir beide waren viel zu schmächtig für unser Alter.
Vermutlich hätte ich Thomas von diesem Tag an verabscheuen müssen. Ehrlich gesagt hegte ich aber immer große Bewunderung für diesen Kerl, der sich weder um Regeln noch Gebote scherte. Seine Ursprünglichkeit gefiel mir. Sie hatte etwas Reines.
Ein wenig erinnerte Thomas mich an die Halbgötter der Griechen, an den jungen Herakles ganz besonders. War dieser denn in seiner Jugend nicht ebenfalls stark, wild und ungezügelt gewesen? Und doch würde er triumphieren. Immer wieder. Über menschenfressende Tiere, blutrünstige Frauen, Riesen und sogar über den Kerberos, den dämonischen Hund, der die Unterwelt bewachte.
Mir hatte es viel Freude bereitet, die Heldentaten des größten unter den Heroen zu lesen. Unglücklicherweise hatte Doktor Eichinger nicht allzu viel Zeit für eine Besprechung aufgewandt.
Vielleicht inspiriert durch dieses doch folgenreiche Ereignis, immerhin ließ sich meine gebrochene Nase nicht mehr in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen und war von diesem Tag an nicht nur krumm sondern auch bucklig, nahm ich mir zum Ziel, groß und stark zu werden. Meinen Körper hatte ich bisher vernachlässigt, streng hatte ich mich auf die Ertüchtigung meines Geist konzentriert. Und da man das Groß-Werden nicht erzwingen konnte, nahm ich mir erst einmal das Stark-Werden zum Ziel. Natürlich wollte ich kein Ringer werden oder gar ein Boxer. Einer friedlicheren Disziplin würde ich mich zuwenden und so trat ich schließlich der Leichtathletik-Gruppe im Ort bei.
Selbst bei sengender Hitze konnte man nun diesem schmächtigen Jungen dabei zusehen, wie er sich schwitzend und taumelnd über den Platz quälte. - Ich war ein ganz passabler Läufer. Immerhin der zweitschnellste. Dabei war ich der kleinste im Verein, hatte die kürzesten Beine. Aber auch hier war ich fleißig, sehr fleißig. Schon bald überließ Herr Frank mir den Schlüssel.
„Du bist ein guter Junge, Konrad. Ich vertraue dir vollkommen!“
Aber ich war nie der schnellste. Zu kränklich, zu körperfremd.
„Konrad“, pflegte Herr Frank zu sagen: „Konrad, es zählt nur die Freude. Und du hast doch Freude am Laufen, oder?“
Er erwartete keine Antwort, sondern fuhr mir auf die Schulter klopfend fort: „Sieh dir den Heinz an. Der läuft wie ein Gott. Aber hat er Freude dabei? Und darum geht es doch. Um die Freude! Und du bist doch ein sehr kluger junger Mann, wirst einmal Arzt werden oder Anwalt. Da reicht es doch, wenn du fit und gesund bist und wenn du Freude hast. Ja, Freude am Sport!“
Ich hatte keine Freude am Sport. Hatte ich nie. Von Natur aus schon nicht geeignet für körperliche Betätigung. Meine Bewegungen unbeholfen oder, wie Herr Frank quer über den Platz zu schreien pflegte: „Wenk, Konrad Wenk! Du läufst schon wieder, als gehörten deine Beine deiner Großmutter! So steif können deine Gelenke doch noch gar nicht sein!“
Jeden Abend rannte ich meine Runden. Fieberhaft, bis zur völligen Erschöpfung. Kriechend kam ich in meinem Zimmer an, meist später als Fred, der die Abende zunehmend bei Freunden verbrachte.
„Mann, Konrad! Was soll’n das? Du übertreibst es völlig mit dem Sport.“
Er betrachtete mich kopfschüttelnd. Seine Haarfransen wackelten hin und her.
Er hatte kurz nach unserem fünfzehnten Geburtstag angefangen, sich eine ungepflegte Mähne wachsen zu lassen. Jetzt war sein Haar fast schulterlang. Grauenhaft sah er aus. Aber immerhin war dieser ungepflegte Kerl, der hin und wieder nach kaltem Rauch stank, nicht mit meiner sittsamen Erscheinung zu verwechseln.
*
Als mein Bruder Marion mit in den Laden brachte, da war er achtzehn, wusste ich augenblicklich, was er für sie empfand. Ich sah es in seinen Augen, konnte die Wärme spüren, die er in ihrer Nähe empfand. Er liebte dieses Mädchen. Nicht so, wie ich ein Mädchen geliebt hätte, wie ich in all den Büchern darüber gelesen hatte: leidenschaftlich und aus einem Gefühl der Wahrhaftigkeit heraus, sondern auf seine etwas unreife Art liebte er sie. Und war es zu Beginn noch eine harmlose Liebelei, so verwandelte sich seine naive Zuneigung schließlich in eine völlige Hingabe, ja sogar Selbstaufgabe. Noch jedoch verband die beiden nicht mehr als ein Kuss, der sich einige Tage zuvor ereignet hatte. Auf einer Faschingsparty und beide waren wohl ziemlich betrunken gewesen.
Wie dem auch sei: Selbstverständlich freute ich mich aus tiefstem Herzen für meinen Bruder.
Marion war nicht unbedingt eine klassische Schönheit, aber mit Sicherheit eines der hübschesten Mädchen, das ich bis dahin gesehen hatte. Groß und schlank, blaue Augen, langes rotes Haar. Meist zu einem dicken Pferdeschwanz gebunden, der mit jedem ihrer Schritte hin und her schwang. Sie hatte einige Sommersprossen auf der zierlichen Nase und die großen Augen, die etwas zu rund waren, leuchteten unter dichten Wimpern und wohlgeschwungenen Brauen. Manchmal schielte Marion ein wenig, besonders, wenn sie müde war, und auf der Stirn besaß sie eine kleine Pockennarbe. Sie hatte auch eine winzige Zahnlücke. - Ihr Lippenbändchen war wohl schuld daran. - Man sah den Spalt nur, wenn sie lachte, was in Freds Gegenwart jedoch häufig geschah. Dieses Lachen war dann laut und hatte etwas sonderbar Männliches an sich. Hin und wieder jedoch kicherte Marion auch wie ein kleines Mädchen.
Es war äußerst verwirrend.
Marion war nicht dumm, ganz und gar nicht dumm, und widersprach so gut wie immer, manchmal aus purem Trotz heraus. Dennoch war sie eine gute Schülerin und ganz die Freude ihres Vaters. - Sie unterschied sich mit alledem auf jeden Fall deutlich von Freds bisherigen Freundinnen. Auch war Marion nicht jünger als er, besuchte eine Parallelklasse auf unserem Gymnasium. Ich kannte sie nur vom Sehen, als Fred uns vorstellte. Ich hatte mit den Mitschülern nicht viel am Hut. Oder sie nicht mit mir.
Natürlich wusste Marion, dass Fred einen Zwillingsbruder hatte. Schließlich wussten alle im Umkreis von mehreren Kilometern Bescheid. Dennoch fand sie es erschreckend, wie ähnlich wir uns auch aus nächster Nähe noch sahen. Sie musterte mich sehr lange, wie ich da hinter der Theke stand, ließ ihre Augen über mein Gesicht rollen und schien jeden kleinen Unterschied entdecken zu wollen. Und sie fand sie: Alle. Die Augenfarbe, die bei mir ein wenig mehr ins Graue ging, und die fünf Sommersprossen, die ich mir durchs Laufen in der Sonne verdient hatte. Seine Narbe am Kinn. Er war mit zehn vom Fahrrad gefallen. Meine Nase, die nicht nur krumm sondern dank Thomas auch bucklig war. Sein Gesicht, das etwas runder war, weil er nur sporadisch Sport trieb, aber deutlich mehr Frittiertes aß. Und schließlich sein unsteter Blick, weil er sich nicht konzentrieren konnte oder wollte.
„Frederik sagt, du seist sein besseres Ich!“, bemerkte sie herausfordernd, beinahe schnippisch, und: „Stimmt das?“
„Ziemlich direkt“, dachte ich und erwiderte lächelnd: „Wir setzen die Prioritäten einfach anders.“
Sie legte ihren Kopf schräg wie Vögel es manchmal tun und meinte dann trocken: „Du willst dich nicht selber loben.“
Frederik grinste und erklärte: „Du brauchst es gar nicht zu versuchen, Marion. Er ist ein Muster an Tugendhaftigkeit. Du wirst ihm aus seinen Antworten keinen Strick drehen können.“
Fred sah mich warm an. Ich spürte all die Liebe, die er für mich empfand und sie schnürte mir die Kehle zu.
„Du sollst nicht so einen Blödsinn erzählen, Frederik! Da wird mir ja ganz schlecht“, entgegnete ich kopfschüttelnd und errötete vermutlich ein wenig.
Das Mädchen fragte beiläufig: „Wie kommt es, dass du fleißiger bist?“, und deutete, während sie mich lässig von allen Seiten begutachtete, auf den Geografie-Atlas, der vor mir auf der Theke lag. Bis zu ihrem Erscheinen hatte ich eine Karte von Nordamerika studiert.
„Offenbar liegt nicht alles in den Genen“, erwiderte ich freundlich, ärgerte mich über meine plumpe Antwort.
„Stellt sich nur die Frage“, erwiderte sie: „Wen es da jetzt besser getroffen hat“, und sie lächelte amüsiert. Ich stand perplex da und wusste nicht, was ich erwidern sollte. Dabei war ich es gewohnt, das letzte Wort zu haben, wenn ich es denn für angemessen hielt.
„Lass uns dann mal gehen, Marion! Jetzt hast du ihn ja kennengelernt... Wir kommen noch zu spät“, sagte Fred und ergriff ihre Hand.
Damit verließen die beiden den Laden, würden vermutlich irgendwelche Freunde besuchen.
In der Tür bemerkte sie noch: „War schön dich kennenzulernen, Konrad Wenk. Bis auf‘s nächste Mal!“
Und obwohl ihre Abschiedsworte nicht sonderlich originell gewesen waren, so hallten sie noch für einige Sekunden ungewohnt in mir nach. Vielleicht auf Grund des herausfordernden Untertons und des amüsierten Lächelns.
Marion kam zwar häufig zu Besuch, doch eine ganze Weile blieb sie eine ferne Bekannte. Immerhin verbrachten sie und Fred die meiste Zeit in seinem Zimmer bei geschlossenen Türen. Aber als es Frühling wurde, begegnete ich dem Mädchen einmal beim Joggen im Wald. Da war sie gerade mit einem Hund spazieren. Einem Schottischen Schäferhund, besser gesagt einer –hündin.
Ich erkannte Marion schon von weitem. Der fliederfarbene Trenchcoat war bezeichnend. Ein modisches Wagnis, das von einem ziemlich großen Selbstbewusstsein, einer gewissen Eitelkeit und einem übermäßigen Streben nach Aufmerksamkeit zeugte. Auch war das Kleidungsstück wenig geeignet für einen Waldspaziergang, wo es doch einige Stunden zuvor kräftig geregnet hatte und die Schuhe hin und wieder im matschigen Untergrund versanken.
Es regnete noch immer leicht. Dank meiner mangelhaften Ausstattung war ich bereits völlig durchnässt.
Als Marion mich kommen hörte, blickte sie sich um zu mir und nahm den Hund kürzer an die Leine. Zu erst schien sie mich nicht zu erkennen, machte dann jedoch ein erfreutes Gesicht ob unserer unverhofften Begegnung.
„Konrad“, rief sie und war inzwischen stehengeblieben: „Fred hat doch recht gehabt, du läufst ja wirklich bei jedem Wetter!“, und damit war ich nur noch wenige Meter von ihr entfernt. Der Hund zog nun in meine Richtung und sie packte ihn am Halsband.
Ich meinte scherzhaft: „Es nieselt doch kaum“, und war schon an ihr vorüber, als sie mir hinterher rief: „Du hast übrigens schön gespielt gestern!“
Ich drehte mich zu ihr um und trippelte einen Moment auf der Stelle.
„Das Orgelspiel in der Kirche“, erklärte sie auf meinen fragenden Blick und schenkte mir ein keckes Lächeln.
„Es hat mir gut gefallen.“
„Was?“, fragte ich und verzog ungläubig das Gesicht. Gestern war Freitag und nicht Sonntag gewesen.
„Na gestern Abend, Konrad. – Um neun oder zehn. Oder wer hat da sonst so tief in der Nacht noch in die Tasten gegriffen?“
Ich wäre sicherlich errötet, wenn meine Durchblutung durchs Laufen nicht ohnehin schon auf Hochtouren gelaufen wäre.
„Ich hätte nicht gedacht, dass man mich noch bis auf die Straße hinaus hören kann. Die Orgel ist natürlich sehr laut, aber das Klavier...“
Ich war inzwischen stehen geblieben, konnte jedoch nicht sagen, wie es dazu gekommen war. Sie dagegen setzte ihren Spaziergang fort und klopfte mir beim Vorübergehen auf die Schulter: „Mozart. Fantasie in d-moll, nicht wahr?“
Sie kicherte.
Der Hund wollte an mir hinaufspringen und sie zog ihn an der Leine zurück.
„Gretchen!“, rief sie aufgebracht: „Benimm dich!“
Dann lächelte sie mich entschuldigend an.
Ich stand etwas verdattert da.
„Ach so“, bemerkte Marion nun grinsend: „Ihr beide kennt euch ja noch gar nicht. Konrad, das ist Gretchen, Gretchen, das ist Konrad“, und sie machte einige theatralische Armbewegungen. Ich blickte etwas unsicher den Hund an.
Meine letzte intime Begegnung mit einem Tier lag schon eine ganze Weile zurück. Da hatten wir wohl mit Vater einen Spaziergang gemacht und waren auf dem Weg an einer Pferdekoppel vorbeigekommen. Das musste schon acht Jahre her sein. Wir hatten die Pferde mit Löwenzahn gefüttert und Vater hatte uns hochgehoben, damit wir sie auf der Schnauze, dort wo die Haut ganz weich war, hatten streicheln können. Dann hatte sich Fred an dem elektrischen Zaun einen Stromschlag zugezogen und wir waren nach Hause gegangen.
Und irgendwie: Ich interessierte mich zwar für Tiere, weil ich mich für die Natur interessierte, doch ich hatte nicht das Bedürfnis eine persönliche Beziehung zu ihnen einzugehen.
Marion zuliebe beugte ich mich immerhin ein Stück hinunter und streichelte den Hund etwas unbeholfen. Er zerrte weiter an der Leine und versuchte mir in die Hand zu beißen.
„Sie will nur ein bisschen knabbern“, erklärte Marion und tätschelte dem Hund den Kopf.
„Eigentlich ist sie `ne ganz Liebe, nur ein bisschen ungestüm.“
„Mmm“, bemerkte ich, fand jedoch, dass ich es mir nun erlauben dürfte, meine Hand zurückzuziehen. Zumal der Hund stank. Zudem war er völlig durchnässt und das Fell komplett zerzaust.
„Gretchen also“, bemerkte ich, weil mir keine andere Bemerkung einfiel: „Ist das nicht etwas unpassend für einen Hund?“
„Ich mag Goethe“, erklärte Marion und gab dem Hund ein Kopfzeichen, dass es weiterginge mit dem Spaziergang. Und mir ehrlich gesagt gab sie das gleiche Signal.
Einen Moment zögerte ich noch, denn eigentlich wollte ich doch laufen und nicht gehen, doch da fuhr Marion schon fort: „Welchen Namen hättest du ihr denn gegeben? Bella oder etwas ähnlich Originelles?“, und hatte mich damit in ein Gespräch verstrickt aus dem ich mich nicht so einfach zu befreien wusste.
„Ich weiß nicht...“, meinte ich schulterzuckend: „Ich habe noch nie über Hundenamen nachgedacht.“
„Na dann hast du jetzt die Chance, einen schnellen Kopf und einen guten Geschmack unter Beweis zu stellen!“, und sie grinste keck.
Ich überlegte kurz, dann meinte ich: „Für einen Rüden fände ich Sirius ganz gut. Wie der Hundestern. Und für eine Hündin...“, ich musste einen Moment nachdenken: „Vielleicht Lupina?“
„Lupina?“
Sie sah mich zweifelnd an.
„Wie diese Blume? Die heißt doch Lupinie, oder?“
„Eher wie Lupus“, erklärte ich zögerlich, um einen belehrenden Ton zu vermeiden.
„Ich bin eine Niete in Latein, das müsstest du mittlerweile doch wissen“, bemerkte sie leichthin.
Wir waren da in einem gemeinsamen Kurs.
„Aber das kommt doch auch bei diesem Spruch von Hobbes vor, oder?“, fragte sie nun.
Sie ließ sich zurückfallen und hob die Hundeleine über meinen Kopf, weil ich mich sonst in dem Ding verheddert hätte.
„Homo homini lupus“, meinte ich etwas trocken: „Der Mensch ist“, und sie stimmte strahlend mit ein: „Dem Menschen ein Wolf“, und tauchte damit wieder neben mir auf. Dieses Mal jedoch zu meiner Linken.
Und während mich die ganze Unterhaltung etwas verwirrte, fuhr sie leichthin fort: „Dabei brauche ich das Latinum fürs Germanistikstudium. – Du brauchst es doch auch fürs Studium, oder? Wobei ich dir sogar ein gewisses Interesse für dieses abartig langweilige Fach zutrauen könnte!“
Sie lachte und ich hob mehr oder weniger entschuldigend die Arme.
„Aber weißt du, Konrad, in gewisser Weise passt das alles schon ganz gut zusammen bei dir,“ und sie strich sich das nasse Haar aus dem Gesicht.
„Und auf welche Weise?“, fragte ich und befürchtete, dass sie mich gleich - unabsichtlich wohlgemerkt - beleidigen würde.
„Für dich müssen alle Dinge einen Sinn machen. – Deshalb auch die Hundenamen... Und Fred meint, du wärst in Mathematik noch besser als in Latein und du würdest auch in deinem Zimmer alles ordnen und...“
Ich strich mir das Wasser aus dem Gesicht und erwiderte etwas aufgebracht: „Ich weiß ja nicht, was Fred dir da so erzählt, aber...“
„Ist doch nicht schlimm!“, bemerkte sie achselzuckend: „Was stört es mich denn, wenn du seltsame Dinge in deinem Zimmer treibst? Oder wenn dir ein Schulfach Freude bereitet, das mir völlig verhasst ist? – Ich finde das eigentlich nur interessant.“
„Interessant?“, und ich hob fragend die Augenbraue und wiederholte nüchtern: „Interessant? In dem Sinne wie es die Menschen vor Hundert Jahren auf den Jahrmärkten interessant fanden, irgendwelche Missgeburten zu begaffen?“
Ich war stehengeblieben, ohne es zu bemerken.
„Nein“, erwiderte sie völlig gelassen und blieb ebenfalls stehen: „Interessant in dem Sinne, dass die Menschen so unterschiedliche Wesen besitzen wie man es sich nur vorstellen kann und ich neugierig bin.“
Ich schloss den Reißverschluss meiner Jacke und gab damit das Zeichen unseren Spaziergang fortzusetzen. Ich bemühte mich um einen freundlichen Tonfall als ich sagte: „Was hat Fred dir denn genau erzählt?“
„Er meinte lediglich“, und sie brach ab, weil sie den Hund an der Leine zu sich ziehen musste, da dieser stehengeblieben war um an einem Baumstumpf zu schnuppern. Als er endlich von dem Stumpf abgelassen hatte, brauchte sie einen Moment, setzte dann erneut an: „Er meinte lediglich, dass du sehr viel ordentlicher wärst als er. Und er scheint da übrigens zu dir aufzublicken.“
Wir mussten acht geben, einen halbwegs befestigten Weg zwischen den tiefen Pfützen zu finden. Hier hatten die Wildschweine den ganzen Weg durchpflügt.
Der Weg wurde schmal. Ich lief hinter ihr und sie rief mir zu: „Ich fand das nur in sofern seltsam“, und sie machte einen kleinen Sprung über eine Pfütze, dass der Matsch ihr bis zum Mantelsaum spritzte: „als er ja selbst gar nicht unordentlich ist. - Zumindest nicht besonders. - Und da habe ich ihn gefragt, in welcher Hinsicht du ordentlicher seist, weil ich dachte, dass er sich das ganze vielleicht nur einbilden würde.“
Als wir das Schlachtfeld der Wildschweine hinter uns gelassen hatten, konnte ich wieder an ihre Seite treten.
„Fred übertreibt immer, wenn es um mich geht“, erklärte ich und fügte hinzu: „Ich mag Unordnung vielleicht nicht sonderlich, aber so extrem ist es dann...“
„Wie dem auch sei“, unterbrach sie mich etwas dreist, doch auf eine irgendwie naive Weise: „Ich möchte einfach wissen warum“, unterbrach sie mich.
„Warum was?“, fragte ich und steckte meine Hände in die Jackentasche meiner Jogging-Jacke.
„Warum du die Unordnung nicht magst zum Beispiel.“
Nach einer kurzen Pause erwiderte ich: „Weil die Unordnung den Menschen beherrscht, und der Mensch die Ordnung“, und zuckte mit den Achseln. Sie kicherte und meinte süffisant: „Wie schön du das gesagt hast, Konrad. Aber meinst du wirklich, dass das der Grund ist?“
„Ich denke doch“, erwiderte ich nüchtern und spürte, dass mir diese Art des sprachlichen Duells gefehlt hatte seit jenem Tag, an dem Doktor Eichinger das Dorf verlassen und gänzlich in die Stadt zurückgekehrt war.
„Der Mensch schafft Ordnung um sich herum, weil er sich innerhalb dieser Ordnung sicher fühlt“, und ich lächelte leichthin, fügte dann hinzu: „Das Chaos nämlich besitzt eine durchaus beängstigende Komponente. Sie übersteigt den Menschen wie es die Unendlichkeit tut oder der Tod.“
Ich kickte einen Stein auf dem Weg beiseite. Der Hund blickte neugierig auf, verlor jedoch das Interesse, als er das Ding als Stein erkannte.
Ich setzte hinzu: „In der Unordnung auf jeden Fall werde ich mich nicht frei fühlen können und mich immer als Opfer empfinden müssen.“
Ich sah zu ihr hinüber. Sie hörte mir aufmerksam zu und als sie meinen Blick bemerkte, lächelte sie auffordernd.
Ich schloss: „Es erscheint mir daher nur logisch, dass ich die Welt um mich herum zu ordnen versuche. Nichts anderes ist Wissenschaft. Und im Grunde ist es dabei völlig unerheblich, ob diese Ordnung nun real oder nur imaginärer Natur ist.“
Sie setzte an, etwas zu entgegnen, hielt dann jedoch inne und lachte.
Sie meinte: „Du bist ganz schön klug, Konrad. Es ist gar nicht so leicht, etwas zu erwidern“, dann jedoch fügte sie ziemlich prompt hinzu: „Was ich dich fragen möchte: Ist es denn nicht einfach so, dass es dir Freude bereitet, die Dinge zu verstehen und zu ordnen?“
Wir verließen den Wald und traten auf die Felder hinaus. Der Himmel war düster und die Wolken hingen tief. Eine einsame Eiche stand zwischen den Feldern auf dem Rücken eines sanften Hügels. Es war ein schöner Baum, wie er da so verloren und doch stark stand. Als Kinder waren wir gerne hinaufgeklettert. Beim letzten Mal war Fred hinuntergefallen und hatte sich das Bein gebrochen. Mit Marion nun meinte ich den Baum zum ersten Mal seit Jahren wiederzusehen, als begegnete man einem alten Bekannten. Auf halber Strecke ins Dorf, dicht am Waldrand, lag das Haus auf dem Hügel. Es war nun gut zu unserer Linken zu sehen, wo die Bäume noch keine Blätter trugen und sich gerade die ersten Buschwindröschen und Leberblümchen vorwagten. Im Sommer lag es von dieser Seite aus hinter hohen Bäumen verborgen.
Wir folgten dem Trampelpfad auf dem Hügelrücken Richtung Eiche. Diesen Weg hatte ich seit Jahren nicht genommen. Er endete bei dem stattlichen Baum, war eine Sackgasse.
„Und?“, fragte Marion nach, da ich ihr noch immer keine Antwort gegeben hatte
Ich sah sie einen Moment etwas verwirrt an, dann erklärte ich: „Aber muss denn nicht auch das Empfinden von Lust und Unlust eine Ursache haben?“
„Für dich bestimmt!“, erwiderte sie und freute sich über die passende Bemerkung, setzte dann hinzu: „Und wenn man nur hartnäckig genug nach einem Grund sucht, findet man sicherlich auch einen.“
„Du glaubst also nicht an einen Grund?“, fragte ich sie erstaunt.
Sie hob gleichgültig die Arme.
„Vielleicht gibt es einen, vielleicht gibt es keinen. Auf jeden Fall aber gibt es das, was wir fühlen. Und mir persönlich reicht es völlig aus, mich daran zu halten.“
Wie liefen noch ein paar Meter Richtung Baum, dann meinte sie: „Ich frage mich manchmal, in wie weit diese ganze Erforschung den Menschen nicht nur unglücklich macht. Sie entwertet sein Empfinden.“
„Du bist also für das Schöngeistige. - Ich muss sagen“, bemerkte ich lächelnd: „Dass bei dir auch alles ziemlich gut zusammenpasst.“
„Danke schön“, erwiderte sie grinsend: „Ich nehme das als Kompliment.“
Wir erreichten den knorrigen Baum und blieben einen Moment stehen, blickten hinunter aufs Dorf. Aus einem Impuls heraus berührten wir beide den Baumstamm. Marion lächelte, als sie es bemerkte.
„Ein wenig fühlt man sich hier oben wie Capar David Friedrich. Oder zumindest wie dieser Kerl auf seinem Bild.“
Ich lachte auf und bemerkte: „Der Wanderer über dem Nebelmeer? Das Bild ist grauenhaft kitschig.“
„Romantisch“, verbesserte sie mich.
„Dann ist es eben grauenhaft romantisch.“
Sie kicherte und bückte sich dann hinab zu dem Hund, vergrub ihr Gesicht im struppigen Fell des Tieres und fuhr ihm mit ihren zarten Fingern durch das lange Haar.
„Siehst du, Gretchen, da hinten wohnen wir beide!“, und sie deutete mit ihrem Zeigefinger auf ihr Elternhaus. Es lag etwa fünf Minuten strammen Fußmarsches weit entfernt und war auch aus dieser Distanz sehr deutlich als ziemlich spießiger und protziger Bau zu erkennen. In dieses Sechsziger-Jahre-Ungetüm hatte Marions Vater – der Apotheker – sein ganzes Geld gesteckt.
Der Hund schien jedoch ziemlich desinteressiert am Ausblick und so richtete sich das Mädchen wieder auf und strich sich seinen Mantel glatt, verzog den Mund, als sie den ganzen Dreck auf dem feinen Stoff bemerkte.
„Wie dem auch sei, Konrad“, und sie blickte auf ihre goldene Armbanduhr: „Ich muss mich jetzt beeilen mit dem Nach-Hause-Kommen, bin schon wieder viel zu spät dran. Fred kommt gleich mit dem Moped, um mich zum Ballettunterricht zu bringen.“
„Stimmt“, erwiderte ich: „Es ist ja Samstag.“
„Genau“, entgegnete sie. „Samstag. – Aber wenn du magst, können wir ab jetzt öfter gemeinsam spazieren gehen. Es macht mehr Spaß zu zweit als alleine. - Und du kannst Gretchen auch mal mitnehmen, wenn du laufen gehst. Das würde ihr sicherlich gefallen.“
Ich nickte und wollte etwas erwidern, als sie erklärte: „Ich muss mich jetzt wirklich beeilen“, und sie eilte den Abhang hinab, den Hund zu ihrer Seite.
„Vielen Dank für das schöne Gespräch“, rief sie mir noch zu und winkte mir zum Abschied. Ich blieb verdutzt zurück.
„Marion findet dich ganz in Ordnung“, erklärte mir Fred am Abend und machte sich ein wenig über mich lustig, als er hinzufügte: „Du scheinst sie mit deinem intellektuellen Geschwafel beeindruckt zu haben!“
Fred nämlich hatte schon seit einigen Jahren nicht mehr viel übrig für meine Vorträge. Ziemlich plötzlich war seine Abneigung gegenüber ernsten Unterhaltungen aufgetaucht. Vielleicht schien mir sein Banausentum deshalb aufgesetzt. Oder aber es ging schlicht über meine Vorstellungskraft, dass er nicht diesen Drang empfand, den Dingen auf den Grund zu gehen, wo es mir doch beinahe unerträglich war, wie wenig ich erst wusste von der Welt.
„Sie hält dich jetzt für verdammt klug, Mann“, fügte Fred spöttisch hinzu und ich erwiderte besorgt: „Ich hoffe, ich habe sie nicht allzu gelangweilt mit meinem Gerede.“
„Das glaube ich nicht“, sagte Fred leichthin und verschwand dann in seinem Zimmer.
Ich traf häufiger auf Marion in diesem Frühjahr. Zugegebenermaßen nicht ganz zufällig. Sie spazierte meist die selbe Strecke mit ihrem Hund und dies stets zwischen drei und fünf Uhr. Ich genoss die Unterhaltungen mit ihr. Sie sprach gerne über Literatur, Kunst und Musik, hatte auch ziemlich solide Kenntnisse. Für die Moderne hatte sie nichts übrig, war ganz der Klassik zugetan. Ich nahm an, dass diese Meinung der ihres Vaters entsprach. Sie äußerste diese auch mit einer Vehemenz und Absolutheit, die ihrem Alter und ihrer Erfahrung unangemessen schien. – Ich legte mich daher nicht mit ihr an in diesen Geschmacksfragen. Zumal ich auch das Gefühl nicht loswerden konnte, dass Marion sich ziemlich viel auf ihre Kultiviertheit einbildete und ein Widerspruch für sie einer Beleidigung gleichgekommen wäre.
Dennoch: Marion war ein heiteres und aufgewecktes Mädchen und wir führten viele lebendige Unterhaltungen. Sprach ich über Religion oder Philosophie hörte sie mir aufmerksam, ja beinahe ehrfürchtig zu, und als sie mich bat, ihr in Latein Nachhilfe zu geben, willigte ich nur allzu gerne ein. Fred beäugte unsere Freundschaft beinahe belustigt.
„Sie hat es raus, das muss man ihr lassen!“, erklärte er lachend.
Ich sah ihn fragend an.
„Sie hat dich nicht weniger um den Finger gewickelt als mich“, fügte Fred hinzu.
„Jetzt gibst du ihr schon kostenlos Nachhilfe und freust dich noch darüber. – Und ihren Hund führst du mittlerweile auch für sie aus! Zumindest bei schlechtem Wetter!“
Und obwohl Fred Recht hatte, konnte ich mich doch nicht als Verlierer betrachten.
*
Es wurde Sommer und mittlerweile waren die Stunden mit Marion Teil meiner Woche wie die Stunden bei Frau Reger oder es die Stunden bei Doktor Eichinger einst gewesen waren.
Bei schönem Wetter saßen wir bei ihr im Garten und tranken Limonade beim Lernen. Regnete es dagegen, saßen wir in ihrem Zimmer. Dann setzte sie sich im Schneidersitz auf ihre geblümte Bettwäsche und der seidene Himmel hing über ihr wie ein Baldachin. Ich saß dann auf der Fensterbank, die Beine angezogen und betrachtete die Regentropfen, die die Scheibe hinunterliefen. Dann und wann warf ich ihr einen Blick zu, wie sie dasaß, auf ihrem Füller kaute und ihre Aufgaben machte. In den Sommerferien trafen wir uns jeden Samstag und Mittwoch. Nur ein paar Tage verbrachte sie mit Fred bei ihrer Tante in der Stadt und zwei Wochen war sie mit ihren Eltern in Italien.
Fred warf mir ein amüsiertes Grinsen zu, als ich am späten Nachmittag das Lateinbuch unterm Arm das Haus verließ. Es war ein heißer Augusttag gewesen und die Hitze hing noch immer in den Straßen. Als sie mir die Tür öffnete, sprang mir Gretchen entgegen. Ich streichelte den Hund und kraulte ihn hinter den Ohren. Über unsere zweisamen Ausflüge hatte ich mich mittlerweile mit dem Tier vertraut gemacht. Es machte mich auch irgendwie glücklich zu sehen, wie sehr sich der Hund über meinen Anblick zu freuen vermochte.
„Konrad?“, meinte Marion und strich sich ein Haarsträhne hinters Ohr. Ich ließ von dem Hund ab und sah sie auffordernd an.
„Würde es dich stören“, fragte sie in gesenktem Tonfall: „Wenn wir uns heute mit Gretchen davonmachen und irgendwo draußen lernen? Wir haben nämlich Familienbesuch...“, und sie drehte sich absichernd Richtung Wohnzimmertür, fügte dann sehr leise hinzu: „Meine kleinen Cousinen sind schreckliche Nervensägen. Ich muss wirklich mal raus hier.“
Wenige Minuten später befanden wir uns auf dem Feldweg Richtung Wald. Gretchen trottete etwas unter der Hitze leidend neben Marion her.
„Und wo wollen wir jetzt hingehen?“, fragte ich. „Zum Weiher? Dort wird es vermutlich angenehm kühl sein. Und Gretchen kann etwas trinken.“
„Daran habe ich auch gedacht“, erwiderte Marion und ihr geblümter Rock schwang mit jedem ihrer Schritte hin und her. – Dazu trug sie ein weißes T-Shirt und gelbe Sandalen. Ich nahm an, dass sie die Sachen zusammen gekauft hatte. In der Stadt. Vielleicht hatte Fred sie ihr auch spendiert. Er arbeitete nun so oft er konnte in der Schreinerei. Marion war eine recht kostspielige Freundin.
Ich hatte befürchtet, dass einige Leute zum Baden zum Weiher gekommen wären, doch außer uns war keine Menschenseele im Schatten der Bäume zu sehen. Aber wo das Wasser einem auch nur bis zum Bauchnabel reichte und der Grund ziemlich schlammig war, bevorzugten die meisten Leute wohl doch das Freibad im Nachbarort. Wir setzten uns auf die Bank unterhalb der Trauerweide. Aber Marion war nicht sonderlich konzentriert an diesem Nachmittag.
Schon nach einer Viertelstunde meinte sie: „Es ist einfach zu heiß.“
Sie zupfte an ihrem verschwitztem T-Shirt.
„Da kann ich nicht richtig denken.“
„Wir können’s ja auch lassen heute“, erwiderte ich und fügte dann hinzu: „Immerhin sind Ferien.“
Sie nickte dankbar und einen Moment herrschte Schweigen. Dann ging ein Ruck durch Marion und sie streifte sich die Sandalen ab.
„Jetzt wo ich schon mal hier bin kann ich zumindest die Füße hineinhalten“, und sie watschelte vorsichtig durch das Gras und Laub zum Ufer. Der Hund, der im Schatten döste, blickte kurz zu ihr auf, ließ dann seinen Kopf wieder fallen.
„Meinst du, es ist tief?“, fragte sie und streckte ihre Zehen ins Wasser.
„Man kann den Grund nicht sehen.“
„Zu tief auf jeden Fall, um ganz hindurchzuwaten“, erwiderte ich und beobachtete sie aufmerksam.
Sie sah sehr hübsch aus in dem luftigen Rock. Wie eine Ballerina. Ihre langen Beine waren noch gebräunt von der italienischen Sonne.
„Du würdest mich im Zweifel doch retten, nicht wahr?“, fragte sie lachend, fügte dann hinzu: „Auch wenn ich nicht deinesgleichen bin!“
Damit meinte sie einmal wieder, dass ich es mit den Naturwissenschaften und sie es mit den Künsten hatte und freute sich über ihre Anspielung.
„Ich weiß nicht“, erwiderte ich grinsend: „Das Wasser riecht nach Moder.“
Sie verzog tadelnd den Mund, ließ sich dann vorsichtig an einem Ast hinab ins Nass, tastete mit dem Fuß nach dem Grund.
„Ihhhh“, meinte sie und lachte: „Das ist ja ganz glitschig da unten“, und sie suchte nach einem festen Stand. Das Wasser reichte ihr weit übers Knie, so dass sie ihren Rock raffen musste. Sie stieg jetzt auch mit dem anderen Bein ins Wasser, stand dann etwas unbeholfen in der brackigen Suppe. Ihren Rock hielt sie mit beiden Händen.
„Willst du nicht auch hineinkommen?“, fragte sie.
„Es ist angenehm kühl.“
„Eigentlich nicht“, erwiderte ich trocken.
„Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon einmal einer gesagt hat, aber Sie sind ein Langweiler, Herr Wenk. Ein Langweiler, jawohl!“, erklärte sie lachend.
„Und ein Spielverderber“, fügte ich hinzu.
„Vielleicht hast du guter Katholik auch Angst davor, dich zu amüsieren“, erklärte sie und watete dann langsam voran.
„Oder aber ich habe Angst vor den Egeln“, erwiderte ich nüchtern.
„Welchen Egeln, denn?“, fragte sie und sah mich skeptisch an.
„Den Sumpfegeln“, und auf ihren fragenden Blick, erläuterte ich wie selbstverständlich: „Wie Blutegel sehen die aus, sind aber ein bisschen kleiner.“
Sie sah mich ermahnend an: „Das ist nicht lustig, Konrad“, fragte dann nach: „Es gibt hier doch nicht echt solche widerlichen Dinger, oder?“
„Natürlich nicht“, erwiderte ich lächelnd: „Nur ein wenig origineller Scherz meinerseits.“
„Hilf mir lieber hier raus, ja?“, bat sie mich nun und kam auf das Ufer zu.
„Jetzt ist es mir hier drin irgendwie unheimlich geworden“, und sie rümpfte die Nase. Ich erhob mich also und zog sie dann mit beiden Händen hinauf auf die Wiese. Schwungvoll landete sie im saftigen Gras.
Einen Moment standen wir wie erstarrt da, noch immer ihre Hände in den meinen. Filigran und fein waren ihre Finger. Marion sah mich seltsam unverwandt an. Dann entzog sie mir eilig ihre Hände und boxte mir in den Oberarm: „Das war nicht nett, Konrad“, doch ihr Tonfall konnte nicht über ihre Unsicherheit hinwegtäuschen.
„Dann lass uns mal zurückgehen, ja?“, meinte sie und zog sich ihre Sandalen wieder an. „Meine Cousinen vermissen mich sicherlich schon. – Außerdem habe ich jetzt das dringende Bedürfnis nach einer Dusche.“
Auf dem Rückweg fiel kaum ein Wort zwischen uns.
Ich fragte mich, was in ihr vorging. Offensichtlich war sie über etwas erschrocken. Und tatsächlich hatte ich befürchtet, das dies geschehen könnte, war ich bisher jeglicher Berührung oder sonstiger Intimität aus dem Weg gegangen. Dabei musste sie doch wohl schon längst bemerkt haben, was ich für sie empfand und das meine Gefühle über kameradschaftliche Zuneigung weit hinausgingen. Warum sonst hätte ich es wohl auf mich genommen, bei Wind und Wetter ihren Hund auszuführen oder meine knapp bemessene Freizeit für lateinische Übersetzungen zu opfern? Oder hatte sie etwa bemerkt, dass sie ebenso empfand wie ich? Dass sie sich in mich, den Bruder ihres Freundes, verliebt hatte? Aber so oder so: Ich würde Fred nicht seine Freundin abspenstig machen. Immerhin war er mein Bruder.
Wir gingen etwas verhalten auseinander an diesem Abend und ich fürchtete, dass nun alles verdorben wäre. Doch als ich am nächsten verregneten Nachmittag vor ihrer Tür stand, um Gretchen auszuführen, da schien mir alles wieder beim Alten. Und wenn gleich die Nachhilfestunden nun etwas professioneller verliefen, so ging Marion mir nun genauso wenig aus dem Weg, wie sie meine Nähe suchte. Dennoch wurde ich das Gefühl nicht los, dass von diesen Nachmittag am Weiher an etwas zwischen uns stand. Oder nur eine Einbildung meinerseits? Ich war mir nicht ganz sicher, traute mir selbst nicht mehr.
*
Im Herbst dann trennte sich Marion von meinem Bruder. Es war eine seltsame Angelegenheit. Eines verregneten Tages kam Fred sehr aufgelöst nach Hause, den Motorradhelm unterm Arm stand er einen ganzen Moment im Flur und die Tropfen liefen von seiner Jacke auf den Fußboden, dass Mutter sich beschwerte, als sie es sah. Als er dann in sein Zimmer trottete, wischte ich erst den Boden, klopfte dann vorsichtig an.
Zu diesem Zeitpunkt war Fred bereits in den Lagerraum umgezogen. Eines Morgens, da waren wir wohl vierzehn oder fünfzehn gewesen, hatte er verkündet, er bräuchte ein eigenes Zimmer und so hatte ich ihm geholfen, sich dort unten in dem Raum mit dem vergitterten Fenster einzurichten. Sein Bett hatten wir heruntergebracht, den Schreibtisch, den Stuhl und eine Kommode. Und so wohnte er von diesem Tag an zwischen den Kartons und Kisten.
Manchmal nahm er Freunde mit zu sich und auch Marion hatte mit ihm alle Zeit in dem kleinen Zimmer verbracht, hatte sich kaum ins Wohnzimmer oder die Küche gewagt. Manchmal war sie auch über Nacht geblieben, dann hatte ein unterschwelliges Kichern das Haus erfüllt. Häufig jedoch hatte sie nicht bei uns übernachtet, eher war Fred des Nachts hinüber zu ihr geschlichen. Denn Marions Vater hatte die Beziehung nur ungern gesehen.
„Fred?“, fragte ich zögerlich: „Darf ich hineinkommen? Was ist denn los?“
Eine ganze Weile rührte sich überhaupt nichts, und ich erinnerte mich an frühere Zeiten, wenn Fred sich eingeschnappt und beleidigt in sein Zimmer zurückgezogen hatte. Den Vorsatz jedoch, nie mehr mit mir zu sprechen, hatte er nie länger als eine Viertelstunde einhalten können. Wohl auch, weil er nach dem Verrauchen der ersten Wut rasch hatte einsehen müssen, dass ich im Grunde – wie immer eigentlich – im Recht war. Dieses Mal jedoch schien er weder zornig noch beleidigt, nein viel mehr niedergeschlagen und das war trotz seiner üblichen völlig übertriebenen geradezu theatralischen Gefühlsausbrüchen beunruhigend. So nämlich hatte ich ihn noch nie erlebt. Ich klopfte ein weiteres Mal an, Fred zeigte jedoch erneut keine Reaktion. Einen Moment überlegt ich, ob ich nicht einfach eintreten sollte, Höflichkeit hin oder her, dann jedoch packten mich Zweifel. Wir waren beide keine Kinder mehr. Ich hatte kein Recht, mich über seine Wünsche hinwegzusetzen. Und ganz offensichtlich wollte er jetzt seine Ruhe. Ich klopfte noch ein letztes Mal, weil drei mir eine gute Zahl zu sein schien, hatte mich aber bereits zum Gehen gewandt, als sich die Tür einen Spalt breit öffnete. Fred schien tatsächlich geweint zu haben. Ich versuchte seine verklebten, rötlich geschwollenen Augen zu ignorieren. - Ich hatte angenommen, er wäre mittlerweile in der Lage, sich zumindest ein wenig zusammenzunehmen.
„Kann man irgendetwas für dich tun, Fred?“, fragte ich und bemühte mich auf dem schmalen Grad zwischen Mitgefühl und Mitleid zu wandeln.
„Marion hat mit mir Schluss gemacht“, erklärte Fred lediglich und schloss dann die Tür weit kraftvoller als er sie geöffnet hatte. Etwas verdattert blieb ich auf dem Flur stehen, dann blickte ich auf meine Armbanduhr. In zwei Stunden säße ich üblicherweise mit dem Mädchen in dessen hübschem Zimmer, um ihr mit den nervigen Lateinaufgaben zu helfen. Es war nicht anzunehmen, dass Fred sich bis dahin wieder beruhigen und mit mir sprechen würde.
Mir wurde etwas bang bei der Vorstellung, unvorbereitet auf seine Ex-Freundin zu treffen. Wer konnte schon wissen, was zwischen den beiden vorgefallen war? Die ganze Sache schien mir überhaupt völlig unwirklich. Schließlich war Fred ihr treuer ergeben als es jeder Hund hätte sein können. Sie war sein ein und alles. - Oder hatte sie sich in einen anderen verliebt? In meiner jämmerlichen Lächerlichkeit zog ich sogar in Erwägung, dass ich dieser jemand war. Dann jedoch schalt ich mich einen Narren, da ein schönes und beliebtes Mädchen wie Marion sich nicht mit einem hässlichen Langweiler wie mir abgeben würde. - Doch für den Moment ließen sich nicht alle Träume vertreiben und es sollte sich zwei Stunden später herausstellen, dass ich tatsächlich Grund für die Trennung der beiden war, wenn auch auf eine Weise, die ich mir nicht hätte erträumen lassen.
Ich war ziemlich unkonzentriert während der verbleibenden Minuten, erwartete auch insgeheim eine telefonische Absage oder einen Einwand Freds, der doch genau um den Nachhilfetermin wie um alle anderen Termine Marions wusste. Es geschah jedoch weder das eine noch andere und so verließ ich denn tatsächlich das Haus, das Lateinbuch unter dem Arm, und konnte selbst nicht glauben, dass es zu diesem Treffen kam. Denn wenn gleich ich in meinen Träumen schon viele intime Stunden mit Marion verbracht hatte, so waren unsere bisherigen Treffen doch stets vom Bewusstsein durchdrungen gewesen, dass sie meinem Bruder gehörte, ganz und gar. Dabei könnte ich so viel werben, wie ich wollte, sie würde mir niemals die Gunst erweisen und ich würde sie niemals annehmen können. Und obwohl ich wusste, dass das Mädchen trotz Trennung noch immer Fred gehörte, weil er sie nun einmal zuerst gehabt hatte, musste ich mich bemühen, das euphorische Zappeln im Bauch zu ignorieren.
Auch Marion schien geweint zu haben und obwohl es regnete, bat sie mich nicht hinein. Den Hund hielt sie erst am Halsband fest, damit er nicht zu mir hinausliefe, sperrte ihn dann jedoch hinter sich ins Haus. Etwas zu energisch schloss sie die Tür und hätte fast Gretchens Schnauze eingeklemmt. Ich stand etwas unbeholfen auf der Steintreppe, der Regen lief mir von den Haaren ins Gesicht und den Nacken hinunter. Das Lateinbuch hielt ich vor der Brust unter der Jacke.
Seit dem Moment, indem sie die Tür auf mein Klingeln geöffnet hatte, war mir immer klarer geworden, dass es zwischen ihr und mir eine unangenehme Aussprache geben würde. Und als sie nun den Mund öffnete und ein vorwurfsvolles Quaken zwischen ihren Lippen hervorkam, überraschte es mich nicht im Geringsten. Dennoch traf mich ihr böser Blick bis ins Mark. „Hat Fred dir nicht Bescheid gegeben?“, und sie verschränkte die Arme. Auch weil es ziemlich frisch war draußen und sie nur eine feine, weiße Bluse trug.
„Er meinte, ihr hättet euch getrennt“, versuchte ich so neutral wie möglich vorzubringen und wischte mir den Regen aus dem Gesicht.
„Ja, also. Warum bist da dann gekommen?“, erwiderte sie ein wenig schroff und drehte sich ein wenig zur Tür, weil sie offensichtlich gerne wieder hinein ins Warme gegangen wäre. Dabei stand sie doch unter dem Vordach, im Trockenen.
„Was hat denn das eine mit dem andren zu tun?“, fragte ich.
Sie sah mich ungläubig an, so als sei der Zusammenhang doch völlig klar. Ich schüttelte langsam den Kopf, wandte dann ein: „Zum einen komme ich zur Nachhilfe und nicht zu wer-weiß-was sonst, zum anderen mag ich zwar Freds Bruder sein, aber eben nur sein Bruder. Nur weil ihr beide Streit habt...“
Sie unterbrach mich zornig: „Ich will überhaupt nichts mehr mit euch beiden zu tun haben. Nicht mit dir und erst recht nicht mit Fred. Also lasst mich doch einfach in Frieden“, und sie wandte sich um und griff nach dem Türknauf. Ich machte eilig ein paar Schritte die Steintreppe hinauf zu ihr, sie sah mich verärgert an.
„Was denn?“, rief sie aufgebracht, als ich sie zurückhielt.
„Also entschuldige Mal“, meinte ich etwas forsch und wischte mir erneut das Wasser aus dem Gesicht.
„Würdest du wenigstens die Güte besitzen und mir erklären, warum du mit mir brichst?“
Einen Moment sah sie mich nur zornig an, dann erwiderte sie: „Weil Fred ein Vollidiot ist und du... Ihr seid beide völlig irre. Ich habe keine Lust mehr, da noch länger mitzumachen. Ihr macht mich noch ganz krank mit eurem Mist!“
Damit öffnete sie die Haustür.
„Aber was hat Fred denn gem...?“
„Sieh ihn dir doch an, Konrad!“, und jetzt schrie sie mich regelrecht an.
„Meinst du denn, er ist dümmer als du? Meinst du das?“
„Ich denke...“
Doch da fuhr sie mir schon ins Wort: „Nein, natürlich ist er nicht dümmer. Das kann ja gar nicht sein. Er ist nur so verdammt...“
Und nun traten ihr Tränen in die Augen. Ich hatte Mühe, ihrem Stimmungswechsel zu folgen.
„Er hat einfach aufgegeben, Konrad!“
Sie schielte ein wenig, als sie das sagte.
„Er hat aufgegeben. Vielleicht hat er das ja schon als Kind. Aber ich bin zu jung, um mich mit einem Typen abzugeben, der sich immer mit allem zufrieden gibt und in diesem Kaff hier versauern will.“
Damit hatte sie ihre Fassung fast wiedergewonnen und trat ins Haus. Der Hund war weg.
„Aber was hat das mit mir zu tun?“, fragte ich sie.
„Du bist sein verdammter Zwillingsbruder, Konrad. Das hat nur etwas mit dir zu tun.“
Sie schloss die Tür. Einen Moment stand ich nur da, dann machte ich mich auf den Rückweg, ärgerte mich nicht einmal über den Regen. Ohnehin war ich völlig durchnässt. Kaum trat ich durch das Gartentor, als ich eine schroffe Männerstimme nach mir rufen hörte.
„Wenk?“
Ich drehte mich zögerlich um. Da stand Marions Vater auf der Türschwelle, die Hände in den Taschen seiner Stoffhose, und blickte auf mich hinunter, etliche Treppenstufen zwischen uns. Seine albernen Hausschuhe befanden sich auf Höhe meiner Augen. Sie waren aus beigen Filz. Ich blickte auffordernd, auch ein bisschen genervt zu ihm hinauf. Schickte sie also ihren eingebildeten Vater vor. Jämmerlich!
„Du brauchst auch nicht mehr wegen des Hundes kommen“, meinte er und fügte dann hinzu: „Das wollte ich dir nur noch sagen.“
Mir lag eine zynische Erwiderung auf der Zunge, dann jedoch schüttelte ich nur den Kopf und machte mich davon.
Erst ganze drei Wochen später erzählte mir Fred, was an jenem Samstagnachmittag zwischen ihm und Marion vorgefallen war. Doch auch nach dieser Erklärung verstand ich nicht, was ich mit alldem zu schaffen hatte. Dass Marion mich nicht mehr sehen und sprechen wollte, musste ich trotzdem hinnehmen. Aber so wie die Dinge nun zwischen uns standen, wäre jeder weitere Kontakt ohnehin unangenehm gewesen. - Dass ich allerdings den Hund nicht mehr mitnehmen durfte in den Wald und auf die Felder, dass ging mir einfach nicht in den Kopf.
Ich vermisste das fröhliche und ausgelassene Geschöpf an meiner Seite, in dessen Begleitung ich dem Laufen sogar etwas Freude hatte abgewinnen können. Es erstaunte mich ja selbst, wie sehr ich mich an das Tier gewöhnt hatte, an diesen stummen Gefährten. Wie schön war mir auf einmal der herbstliche Wald erschienen mit seiner Fülle an Farben und Gerüchen. Manchmal waren wir stehengeblieben und ich hatte Bucheckern gesammelt und sie aus ihrer stachligen Schale befreit. Der Hund hatte mir neugierig dabei zugesehen und sich dann glücklich über die blanken Nüsse hergemacht. Wir hatten um Stöcke gerangelt und Wettrennen veranstaltet, waren einmal stundenlang der Wildschwein-Fährte gefolgt, auch wenn unsere Jagd nicht erfolgreich gewesen war. Wir hatten Eichhörnchen beobachtet und uns gefragt, wie sich die buschigen Schwänze wohl anfassen würden. Und wir hatten das eiskalte Wasser aus dem Brunnen getrunken. Mit beiden Händen hatte ich für den hechelnden Hund das Wasser geschöpft, dass dieser eilig leckte, ehe es zwischen meinen Fingern auf den Boden lief. Nun war ich wieder allein im Wald und verlor mich erneut in der öden Einsamkeit. Die Stille war mir dann fast unerträglich. Mal fiel zwar eine Nuss vom Baum ins raschelnde Laub, und manchmal flog auch eine erschrockene Amsel auf, doch selbst dass Reiben der Federn waren dann zu hören und ich musste an den Friedhof denken und die verwitterten Engelsstatuen, fragte mich, ob geschwungene Engelsflügel wohl ebenso klängen. Der Herbst schien mir in diesen Momenten den Tod mit sich zu bringen und versetzte mich in eine allzu melancholische Stimmung. Da waren mir die herbstlichen Stürme weit lieber, wenn die Bäume ächzten und mit ihren nackten Ästen um sich schlugen. Doch bei stürmischen Wetter war es nicht sicher im Wald, wenn gleich die Bäume dann besonders laut nach mir riefen.
So oder so: Ich leistete auch weiterhin jeden Tag meine Kilometer ab. Nun wieder allein, bei Wind und Wetter. Doch wann immer ich aufbrach, musste ich kurz daran denken, wie freudig mich Gretchen wohl begleitet hätte an diesem Tag. Den Regen hatte sie ganz besonders zu genießen vermocht.
„Sie möchte, dass ich studiere“, erklärte Fred beim Abwasch. Ich trocknete ab. Er brauchte nicht zu erklären, dass er von Marion sprach.
„Aber ich will überhaupt nicht studieren, Konrad. Warum denn auch? Ich kann doch auch eine Lehre hier im Ort machen. Warum kann ich denn nicht Schreiner werden? Das ist doch auch eine gute Arbeit.“
„Das muss jeder für sich entscheiden, was er mit seinem Leben anfangen will“, erwiderte ich.
„Wahrscheinlich hätte sie es gern, wenn ich wie du Medizin studieren wollte oder Jura....“, und er spritzte mit dem Spülwasser um sich. Ich meinte beschwichtigend: „Aber sie macht sich doch nur Sorgen um dich, dass du es später bereuen...“
Er sah mich böse an.
„Nein, Konrad“, erwiderte er vehement.
„Sie macht sich Sorgen um sich.“
Dann fügte er aufgebracht hinzu: „Vielleicht will sie später auch nur angeben können vor ihren Freundinnen.
„Also mein Mann, der hat mir einen Brillanten geschenkt. Einfach so!“, und er verstellte dabei die Stimme, dass sie zu einem nervigen Piepsen wurde, und hielt mir die schaumigen Finger vor die Nase, als trüge er einen fetten Ring daran. Dann normalisierte sich sein Tonfall.
„Aber meinst sie denn wirklich, man ist glücklicher, wenn man mehr Geld auf dem Konto hat? Meinst sie, da ist auch nur der geringste Zusammenhang?“
Er verzog dabei angewidert den Mund und griff nach der fettigen Bratpfanne, die noch auf dem Herd stand.
Dann, fuhr er lauthals fort: „Ich verstehe ja, dass man in abgesicherten Verhältnissen... Aber liegt es denn nicht bei mir, was ich später einmal arbeiten will?“
Er ließ die Pfanne krachend ins Becken rutschen.
„Ich glaube nicht, dass Marion so oberflächlich ist“, erwiderte ich beschwichtigend.
„Aber sie hat sich bestimmte Vorstellungen gemacht von ihrem späteren Leben und die unterscheiden sich offenbar von deinen Vorstellungen...“
„Also, Konrad“, und er wischte sich mit den nassen Händen das Haar aus der Stirn: „Was sollen das denn für Vorstellungen sein? Sie ist eine verdammte Träumerin, wenn sie meint... Guck mal: Sie will Literatur studieren.“
Er verzog angewidert das Gesicht.
„Literatur!“, wiederholte er aufgebracht.
„Da kann sie sich auch gleich arbeitslos melden! Als ob ihr später irgendwer Geld zahlen würde fürs Lesen!“
„Also es ist ja nicht jeder Germanist arbeitslos. Da übertreibst du jetzt“, wandte ich ein, doch er sah mich nur wütend an.
„Handwerk hat goldenen Boden“, erwiderte er trocken, verzog dabei den Mund und versenkte seine Hände im Spülwasser.
Ich griff nach einem Geschirrtuch und machte mich daran, die Teller abzutrocknen.
„Wahrscheinlich hat sie Recht und wir passen einfach nicht zusammen“, erklärte er nach einer Pause in weit ruhigerem Ton.
Die monotone Arbeit beschwichtigte ihn wohl ein wenig.
„Sie möchte in der Stadt leben, wo sie in die Oper kann und ins Ballett. Und ich finde dieses ganze intellektuelle Tamtam einfach nur aufgesetzt. Sie ist genauso Landpomeranze wie die andren Mädchen hier.“
Er reichte mir die Pfanne.
Obwohl Fred offenbar abgeschlossen hatte mit Marion, machte er keine Anstalten, sich eine neue Freundin zu suchen, auch ging er kaum noch aus. Er litt sichtlich unter der Trennung und wann immer er Marion über den Weg lief, spannte sich sein ganzer Körper schmerzerfüllt an und er musste den Blick abwenden. Ich bemühte mich um ein wenig mehr Würde und begegnete ihr zumindest erhobenen Hauptes, konnte ein Stechen in der Brust jedoch ebenfalls nicht ignorieren.
Sie dagegen schien kaum unter der Trennung von Fred zu leiden und wurde schon bald von einem neuen Verehrer auf Schritt und Tritt begleitet. Zu Freds großem Leidwesen handelte es sich um Tizian Effner, gegen den er noch aus Kindertagen einen tiefen Groll hegte. Ich konnte das Gefühl nicht loswerden, dass Marion gerade deswegen mit diesem Widerling anbandelte. Denn wenn gleich der Kerl später sicherlich vorzüglich verdienen würde und auch zum Studium der Betriebswirtschaft in die Stadt zöge, konnte der feiste und schmierige Kerl unmöglich nach ihrem Geschmack sein. Und tatsächlich hielt sie ihn trotz all seiner Mühen auf eisiger Distanz. Immerhin aber durfte er sie nun anstelle meines Bruders zur Ballettstunde fahren. Für die kalten Monate war dies auch recht vorteilhaft, denn er besaß schon einen eigenen Wagen, einen lavendelfarbenen Alfa Romeo. Fred ballte die Fäuste, wann immer er den Kerl sah.
Doch wie schrecklich es mir auch in den Latein-Stunden ergehen mochte, wenn Marion direkt vor mir saß und ich ihre leisen Wortwechsel mit ihrer besten Freundin nur allzu schlecht überhören konnte, ihr baumelnder Pferdeschwanz beinahe eine hypnotische Wirkung auf mich hatte, so hatte die ganze unschöne Angelegenheit zumindest einen Vorteil: Fred und ich kamen uns wieder näher.
Im Dezember verbrachten wir viele gemeinsame Stunden beim Mastermind-Spielen. Ich trank dann Tee, er heiße Schokolade. Und oft saßen wir auch nur gemeinsam in unserem früher gemeinsamen und jetzt meinem alleinigen Zimmer und lasen. Während ich mich mit meinen neusten Errungenschaften plagte, denn ich kaufte mir in diesen Jahren nichts weiter als Bücher, dies jedoch in einem Ausmaß, dass der mürrische Buchverkäufer mich mit größter Zuvorkommenheit behandelte, begnügte sich Fred mit jenen Büchern aus meinem Sortiment, die ich bereits gelesen hatte und ihm wärmstens empfehlen konnte. Sherlock Holmes mochte er sehr gerne und auch gefielen ihm Nathan der Weise und Die Schachnovelle. Zu lang und aufgeplustert durften die Geschichten nicht sein und Sachbücher fand er generell öde. Dennoch herrschte stets eine melancholische Stimmung, wenn wir so beisammen waren und mir war allzeit bewusst, dass Fred stumm litt. Dabei gefiel er sich jedoch durchaus in der Rolle des unglücklich Verliebten und pflegte sein Elend. Es kam eine ruhige und tiefgründige Seite an ihm zum Vorschein, die ich nicht gekannt hatte, die meinem Wesen jedoch erstaunlich entsprach. Wenn wir gemeinsam spazieren gingen oder er mir im Laden half, denn auch gab er sich nun weit interessierter an den familiären Angelegenheiten, dann war ich immer wieder erstaunt, ob der ähnlichen Ansichten und Vorstellungen, die wir beide hegten. Fort war alle Albernheit und Vergnügungssucht, alle Verantwortungslosigkeit und Unrast. Jedoch schien auch all seine überschäumende Energie dahin, sein Charme und seine Ausgelassenheit. Dann schmerzte es mich, dass er nun ebenso ein düsteres Geschöpf geworden war wie ich.
*
Kurz nach dem Jahreswechsel stand unser gemeinsamer Geburtstag bevor und wenngleich Fred nicht sonderlich zum Feiern zu mute war, meinte er doch: „Man hat nur eine begrenzte Anzahl von Geburtstagen, Konrad. Man sollte jede Chance nutzen. Und den Tag nicht zu feiern: Da kann man das ganze neue Jahr gleich zum alten tun und beide abstempeln von wegen: Verpfuscht. Dabei war nicht alles schlecht und überhaupt: Ich habe bisher immer gefeiert. Nur weil Marion jetzt... Das Leben ist jetzt nicht vorbei, nur weil sie Schluss gemacht hat mit mir. Und es wird auch Zeit, dass ich mich wieder zurückmelde.“
Fred lud also seine Freunde ein und wenn gleich ich an besagtem Tag, einem Freitag, ebenfalls Geburtstag hätte, war ich nur als Gast geladen. Fred hätte zwar auch gemeinsam mit mir gefeiert, hatte mich sogar etliche Male dazu aufgefordert, doch da ich im Grunde keinen einzigen Freund außer ihm selbst besaß, schien mir dies reichlich abwegig.
Karl war so freundlich, Fred die Gartenhütte seiner Familie zur Verfügung zu stellen, die direkt am Waldrand auf einer Obstbaumwiese stand, und ich fragte mich, wie die dreißig bis fünfzig Gäste da hineinpassen sollten. Meinen Bruder trieb wohl die selbe Frage um und an besagtem Morgen stellten wir beide besorgt fest, dass es zwar nicht regnen oder schneien, es aber eisig kalt würde. Januar eben. Der Silvesterschmutz lag noch immer auf den Straßen und ein wenig wunderte es mich, dass die Menschen schon wieder Lust auf Gesellschaft hatten. Ich selbst hatte ehrlich gesagt nie sonderlich viel Lust auf Gesellschaft, ob es nun Sommer oder Winter war. Große Menschenansammlungen wirkten zu diesem Zeitpunkt sogar regelrecht bedrohlich auf mich. Später fände ich solche Veranstaltungen einfach nur belästigend. Wenn überhaupt, dann vermochte ich immer nur, mich über andre, nicht mit ihnen zu amüsieren. Und dieses Vergnügen wandelte sich, wenn ich ehrlich bin, auch recht schnell in Überdruss, wenn nicht gar in Bitterkeit.
Frederik zu Liebe konnte ich der Veranstaltung auf jeden Fall nicht fern bleiben und mit den Vorbereitungen hatte ich ihm natürlich voller Eifer zu helfen. Karl, der ebenfalls hatte helfen wollen, entpuppte sich im Laufe des frühen Nachmittags, vor allem als großartiger Delegierer. Dabei waren wir nur zu dritt. Aber es war ja auch wichtig, dass einer den Überblick behielt!
Ich kam erst mit einiger Verspätung auf die Feier, weil Fred erst das Bad besetzt hatte und ich dann noch Mutter mit der Abrechnung hatte helfen müssen. Es waren 367 Pfennig aus der Kasse verschwunden uns sie hatte mich beschuldigt, falsch abgerechnet oder gar das Geld gestohlen zu haben. Letzteres war aber selbst ihr ein wenig lächerlich vorgekommen. Ich hatte also alles noch einmal überprüft. Doch tatsächlich fehlte von den 367 Pfennigen jede Spur. Ich hatte schließlich den fehlenden Betrag aus meinem eignen Portemonnaie in die Kasse gegeben. Ich wusste, dass das einem Schuld-Eingeständnis gleich kam. Aber was nützte es schon?
Schon von der Straße unten war einiger Lärm zu hören. Zuerst traf ich auf die Raucher, die Plastikbecher mit Punsch in den Händen hielten und mir zur Feier des Tages zumindest ein Nicken schenkten. Ich stakste den Hügel weiter hinauf zur Hütte. Die Tür stand offen und man blickte auf ein Menschengedränge in ihrem Innern, wie ich es nie zuvor gesehen hatte. Mir graute bei der Vorstellung, mich dort hineinbegeben zu müssen, aber da es mir an den Füßen schließlich allzu kalt zu werden drohte, atmete ich noch einmal tief ein und trat auf die Tür zu. Ich würde Fred kurz vor Augen treten und mich dann wieder davonmachen. Auf Fred war ich momentan ohnehin nicht gut zu sprechen. Meinen ganzen Nachmittag hatte ich ihm geopfert und er hatte sich nicht einmal bei mir bedankt. Dabei konnte ich mir für meinen eignen Geburtstag weit Schöneres vorstellen, als den Dreck von Karls letzter Feier zu beseitigen.
Tatsächlich aber, und ich schämte mich ein wenig dafür, war ich aus einem anderen Grund ärgerlich. Am Morgen hatten Fred und ich nämlich unsere Geschichtsklausuren zurückbekommen. Und nicht nur, dass ich mit zwölf Punkten weit schlechter als gewöhnlich abgeschnitten hatte, Fred hatte auch noch 13 Punkte und damit die beste Note erhalten. Nun hätte ich meine Missgunst durchaus hinunterschlucken können, wie ich es für gewöhnlich tat. Denn schließlich stand jede Leistung für sich und im Grunde sollte ich mich doch freuen für Fred. Geschichte war trotz Dr. Eichingers Bemühungen ohnehin nie mein Fall gewesen.
Und ich hätte mich ja vielleicht noch beherrschen können, selbst wo Herr Henning Fred über alle angebrachten Maße gelobt hatte, während er für mir nur einen hämischen Blick voller stiller Genugtuung übrig gehabt hatte. Aber Tatsache war doch: Fred hatte wie eh und je betrogen mit seinem blöden Spickzettel im Federmäppchen! Und auf sein dummdreistes Grinsen hin hätte ich ihm am liebsten eine verpasst.
Aber ich hatte mich natürlich zusammengenommen, mir jedweden Kommentar verkniffen. Und jetzt galt es, sich noch ein paar Stunden zusammenzunehmen. Morgen früh wäre mein lächerlicher Ärger wieder verraucht. Ich war mir meiner kindischen Missgunst durchaus bewusst, was es in gewisser Weise noch ärgerlicher machte.
Die Luft in der Hütte war mir unerträglich und ich stellte etwas frustriert fest, dass vom ganzen Putzen und Räumen am frühen Nachmittag nichts mehr zu bemerken war. Der Boden klebte vor vergossenem Punsch. Es kostete mich einige Überwindung meine Rücksicht über Bord zu werfen und mich grob durch die Menge zu wühlen.
So oder so, sagte ich mir, er war mein Bruder, heute war sein Geburtstag und ich konnte doch auch ein bisschen Größe beweisen und über seine kleinen Tricksereien hinwegsehen. Wie er selbst sagte: Jeder machte es doch so. Was regte ich mich denn auf in meiner übertriebenen Rechtschaffenheit? Und Fred hatte sich doch mehr als sonst bemüht, mir am Vorabend der Klausur noch diverse Fragen gestellt, die ich denn so gut wie irgend möglich beantwortet hatte.
Frederik kümmerte sich, zumindest hatte er das vorgehabt, um die Musik und hatte sich daher vermutlich ein klein bisschen Platz hinter dem Plattenspieler gesichert. Ansonsten war es dermaßen voll in der Hütte, dass man sich kaum rühren konnte. Die anderen Gäste warfen mir tadelnde Blicke zu, weil ich meine Jacke nicht ausgezogen und auf den großen Stapel draußen geworfen hatte. Ich entschuldigte mich immerzu, bemühte mich um größtmögliche Höflichkeit und geringsten Körperkontakt. Trotzdem hätte ich nicht wenig Lust gehabt, mir mit den Ellbogen einfach den Platz freizukämpfen. Was sollte das alles denn? Und wieso musste Fred seinen Geburtstag überhaupt feiern? Es war ja von gestern auf heute auch nur eine ganz normale Nacht vergangen.
Ich schalt mich für meinen Verdruss. Es war ja wohl nichts dagegen einzuwenden, dass Fred seinen Geburtstag feierte und mich gerne dabei hatte. Im Grunde war das sogar sehr nett von ihm. Und an meiner Stelle hätte es sich eigentlich gehört, sich zu amüsieren. Zumal auch ich Geburtstag hatte. Aber ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, wie man sich amüsierte.
Auf etwa halber Strecke trat mir ein Mädchen in den Weg und ich bemühte mich um ein freundliches Gesicht. Sie schien etwas jünger als ich zu sein. Ein eigentlich recht hübsches Mädchen mit dunkelblondem Haar und weichen Zügen. Sie kam mir irgendwie bekannt vor und ich rätselte, wo und wann ich sie schon einmal gesehen hatte. Aber erst nachdem ihre Stimme ertönte, wurde mir klar, dass sie der Leichtathletikmannschaft beigetreten war, kurz bevor ich dieselbe aus Zeitmangel hatte verlassen müssen. Wie ich mich zu erinnern meinte, war das hochgewachsene und schlanke Mädchen gut im Hochsprung gewesen. Bei den Anlagen keine sonderliche Leistung.
„Konrad“, rief sie laut, um die Musik zu übertönen, und riss mich damit aus meinen Überlegungen. Sie umarmte mich und mir entging nicht, dass ich mich dabei beinahe so steif anstellte wie meine Mutter es tat.
„Alles Gute zum neunzehnten Geburtstag!“
Ich rang mir ein Lächeln ab.
„Danke schön, Ulrike!“
Mir war in letzter Minute ihr Name eingefallen. Etwas schleppend war er mir über die Lippen gekommen. Einen Moment sahen wir einander etwas dümmlich an. Dann nippte sie verlegen an ihrem Plastikbecher mit Punsch. Vermutlich wäre es jetzt an mir gewesen, etwas zu sagen. Etwas Lustiges oder Originelles am besten, wie es Fred zu jeder Tages- und Nachtzeit vermochte. Mir fiel aber nichts ein. Überhaupt nichts.
Wäre sie eine meiner alten Damen gewesen, hätte ich wohl gefragt: „Wie geht es Ihnen denn heute? Und Ihr Rücken?“
Aber Ulrike war keine meiner alten Damen, tatsächlich war sie mit ihren samtig wallenden Haaren und der makellosen, wenn auch leicht geröteten Haut Beispiel blühender Jugend.
„Meine Großmutter redet immer so gut von dir“, erklärte sie nun: „Wüsste ich's nicht besser: Man könnte meinen, sie wäre verliebt in dich.“
„Frau Falks?“, fragte ich peinlich berührt.
Wieso musste sie jetzt dieses unsägliche Thema ansprechen? Es ließ sich nicht gerade brüsten mit meiner Fürsorge den alten Damen gegenüber. Eher deuteten die meisten meinen Kontakt mit den Gebrochenen und Einsamen als Zeichen meiner eignen Aussätzigkeit. Denn es hatte zwar jeder Mitleid mit den sozialen Restposten aber wer wollte sich schon wirklich mit ihnen abgeben? Und ich selbst kam manchmal nicht umhin, mich zu fragen, ob es sich wirklich um Nächstenliebe meinerseits handelte oder ob ich im Grunde nicht ebenso arm dran war wie diese unsäglichen Geschöpfe.
„Ich habe sie schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen“, erwiderte ich, fügte dann hinzu: „Aber sie lädt mich ab und an auf ein sehr gutes Stück Kuchen ein und überhaupt: Sie ist eine sehr nette Frau.“
„Findest du?“, erwiderte Ulrike keck grinsend und fügte dann, ehe sie ihre Nase erneut in den Plastikbecher steckte, hinzu: „Ich finde sie manchmal ziemlich garstig.“
„So wollte ich es jetzt nicht unbedingt ausdrücken“, entgegnete ich prompt und erbleichte ob meiner dreisten Erwiderung.
Es war doch sonst nicht meine Art, schlecht über andere zu sprechen.
Ulrike kicherte und meinte dann: „Großmutter weiß ja selbst, dass sie hin und wieder unausstehlich ist“, und Ulrike verdrehte die Augen: „Aber wir haben sie natürlich trotzdem gern.“
Sie nippte erneut an ihrem Becher. Ich blickte etwas ungeduldig zu Fred herüber, konnte ihn hinter all den Menschen jedoch nicht ausmachen.
„Sag mal, Ulrike, weißt du, ob Fred noch da hinten ist, und Musik aufgelegt?“, wechselte ich etwas unhöflich das Thema. Doch mir stand nicht der Sinn nach weiterer gezwungener Konversation. Zudem bekam ich andauern Ellenbogen in die Rippen.
Ulrike erwiderte gelassen: „Ich denke schon. Zumindest hab ich weder ihn noch Marion hier vorbeikommen sehen.“
Ich sah sie ungläubig an, fragte dann beinahe hysterisch: „Marion ist hier? Bist du dir sicher?“
„Natürlich. Ich bin ja gemeinsam mit ihr gekommen. Sie ist doch die beste Freundin meiner Cousine...“
Doch ich hörte Ulrike gar nicht mehr zu, sondern bahnte mir bereits meinen Weg Richtung Fred.
Und tatsächlich: Mein Bruder stand noch immer beim Plattenspieler, eine Bierflasche in der Hand. Marion stand neben ihm und rief ihm etwas ins Ohr, betatschte dabei seine Schulter über Gebühr. Er grinste dümmlich und der Anblick ließ mir den Schweiß auf die Stirn treten. Meine dicke Bekleidung in dem überhitzten und sticken Raum tat ihr übriges. Ich musste auf jeden Fall dringend an die frische Luft und schob mich brutal zum Ausgang, drängte etliche Leute grob beiseite, die mich ärgerlich ansahen. Dann stand ich endlich in der Kälte. Die Raucher nahmen nur kurz Notiz von mir, widmeten sich dann wieder ihrem Gespräch. Ich atmete tief durch. Ein und aus. Ein und aus. Doch der Rauch bekam mir nicht sonderlich und auch kam ich mir reichlich dumm vor so nutzlos vor der Tür. Also machte ich mich davon in den angrenzenden Wald.
Es war eine sternenklare Nacht und ich hatte das Gefühl, die Luft klirre mit jeder meiner Bewegungen. Meine Jacke rauschte und meine Schritte ließen den gefrorenen Boden knirschen. Ich machte mich auf in Richtung Weiher. Der war hier ganz in der Nähe. Nur noch den Hügel hinauf und dann rechts. Die Musik wurde immer leiser, drang jedoch bis zum Weiher als nerviges Gedüdel zwischen den kahlen Bäumen hindurch. Fred hatte einen grauenhaften Musikgeschmack. Ich setzte mich auf die Bank, auf der ich im Sommer mit Marion gesessen hatte und starrte auf das gefrorene Wasser hinaus. Früher einmal hatten Vater, Fred und ich hier die Enten mit altem Brot gefüttert. Das schien mir Jahrhunderte her zu. Die Erinnerung an Marion, die da in ihrem gerafften Rock im sumpfigen Wasser stand, allerdings war mir allgegenwärtig und ich ärgerte mich, überhaupt hierhergekommen zu sein. Die Luft schmerzte in meinen Lungen. Ich trug keine Handschuhe und in meinen Fingern breitete sich bereits der stechende Kälteschmerz aus. Aber ich blieb sitzen, blieb einfach sitzen und verstand mich selber nicht. Hatte ich den beiden nicht genau das gewünscht? Die Versöhnung? Hatte ich mir das für die beiden nicht erhofft? Und doch: Ich konnte ihr lächerliches Liebesglück kaum ertragen. Was war ich nur für ein grauenhafter Bruder! Weshalb war ich ein so boshafter Mensch? Wieso freute ich mich denn nicht für Fred? Und dann, ganz allmählich, wurde mir bewusst: Ich war kein schlechter Mensch. Hatte ich nicht immer versucht, gut und richtig zu handeln? Hatte ich nicht immer mein Bestes gegeben? Und? Was hatte ich nun davon? Nichts. Ich litt seit meiner Geburt und wurde von meinem schlechten Gewissen malträtiert jeder Zeit und immerzu. Und das schlimmste war: Ich fühlte mich tot, innerlich tot. Warum durfte ich denn nicht glücklich sein? Hatte ich denn keine Zufriedenheit verdient? Es war ungerecht. Es war einfach ungerecht. Wieso durfte er glücklich sein und ich nicht? Und dabei hatte ich mir doch solche Mühe mit allem und jedem gegeben. Neunzehn verdammte Jahre lang tat ich nun schon mein Bestes, neunzehn verdammte Jahre lang. Und ging es mir deshalb auch nur ein klein wenig besser als ihm? Nein. Es war einfach nicht fair. Ein Konto voller guter Taten und großer Leistungen hatte ich vorzuweisen, aber ich war nicht glücklich. Nein, ich war verdammt noch mal nicht glücklich. Und wenn Gott, trotz all meiner guten Taten, einfach mit seinem Eimer voll Zufriedenheit über mich hinwegging und ihn über meinem Bruder vergoss, so konnte mir dieser Mistkerl auch mit seinen bescheuerten Regeln gestohlen bleiben. Ich würde da nicht länger mitspielen.
Weshalb sollte ich mich an Regeln halten, die doch ganz offensichtlich mit Füßen getreten wurden? Wer hatte denn entschieden, dass er glücklich sein sollte und ich nicht? Ich hatte das Glück wohl tausend Mal eher verdient als er. Warum musste ich denn immer gerecht, ehrlich und großzügig sein und er nicht? Stand es mir nicht ebenso zu, schlecht zu sein, wann immer es mir beliebte? Ach, es war seine Art? Nun, dann würde es auch meine Art werden. Ich würde mir nehmen, was mir zustand. Vielleicht würde ich mir sogar noch mehr nehmen als mir zustand, denn ganz offensichtlich scherte sich doch niemand darum, ob es einem zustand oder nicht. Ganz offensichtlich war es völlig gleich, wie man sich benahm! Oder sollte ich etwa noch warten? Warten auf Gottes Gerechtigkeit? Aber ich wartete doch bereits neunzehn Jahre lang. Wie lange sollte ich denn noch warten? Und wie sollte jemand, der von Beginn an von Gott verspottet worden war, noch großes Vertrauen in dessen grenzenlose Gerechtigkeit haben? Nein, der da oben war weder gerecht noch großzügig und er konnte mir gestohlen bleiben mit seinen Geboten. Was kümmerte mich dieser Heuchler? Hatte er nicht versprochen, es ließe sich ein Paradies auf Erden schaffen, hielte man sich nur an ihn? Wo war dieses Paradies? Und wurde es nicht eher denen zu teil, die sich nicht um ihn und seine Gebote scherten? Ach, das Paradies ließ sich durch tadelloses Benehmen nicht erkaufen? Meine guten Taten wären Lohn genug für meine Seele, kämen sie nur aus dem Herzen? Wären sie in Wahrheit nicht vollkommen selbstsüchtig und verdorben? Aber einmal ganz ehrlich: Die Selbstsucht ließ sich nicht austreiben, egal mit welchen selbstlosen Taten man auch aufwartete. Und warum sollte ich denn noch länger zu bezwingen versuchen, was doch offensichtlich unbezwingbar war?