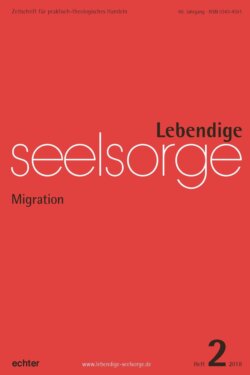Читать книгу Lebendige Seelsorge 2/2018 - Echter Verlag - Страница 6
ОглавлениеDas gesellschaftliche Aushandeln von Migration – und seine Grenzen
Einseitige Positionierungen und Polarisierungen beherrschen das Reden und Schreiben über das soziale Phänomen Migration: Die einen verstehen unter Migration das Ergebnis von Krisen, Katastrophen und Defiziten – und ihre Folgen als Gefahr für Sicherheit, Wohlstand, gesellschaftliche und kulturelle Homogenität. Migration erscheint damit als Risiko, das dringend der intensiven politischen Vor- und Nachsorge bedarf. Die anderen wiederum sehen vornehmlich Potentiale für die Entwicklung des Arbeitsmarkts sowie Perspektiven für ökonomische, soziale und kulturelle Innovationen – im Zielland wie im Herkunftsland der Bewegungen. Jochen Oltmer
Migration ist weder grundsätzlich gut noch schlecht. Wie für jedes soziale Phänomen können die Hintergründe, Bedingungen, Folgen und Effekte von Migration sehr unterschiedlich verstanden werden. Dabei erweisen sich die Wahrnehmungen und Zuordnungen keineswegs als stabil. Jede Gesellschaft handelt vielmehr unter Beteiligung zahlreicher unterschiedlicher Akteure fortwährend neu aus, wer unter potentiellen Zuwanderinnen und Zuwanderern als nützlich gilt und deshalb mit einer gewissen Offenheit rechnen kann, wer zugehörig ist oder wem wenigstens ein Naheverhältnis zugebilligt wird, wen sie als hilfs- und damit als schutzbedürftig wahrnimmt.
Solche Aushandlungen münden in rechtliche Regelungen, Gesetze, den Auf-, Ab- oder Umbau von Organisationen -Normen und Strukturen, die wiederum den Rahmen bilden für neues Aushandeln über Homogenität oder Heterogenität, Differenz oder Gleichheit, Nähe oder Distanz.
Seit drei, vier Jahren bewegt sich die bundesdeutsche Gesellschaft in einer Phase beschleunigten Aushandelns von Migration. Neu daran ist nicht das Aushandeln selbst, sondern die hohe Zahl der beteiligten Akteure aus Politik, Ökonomie, Medien und Zivilgesellschaft und damit auch das Ausmaß der Unübersichtlichkeit der Positionierungen und Polarisierungen. Wissenschaftlich bedeuten solche Aushandlungen eine enorme Herausforderung. Es erweist sich als ausgesprochen komplex, ihre Dynamik zu verstehen und beispielsweise zu erklären, warum in der einen Gesellschaft eine Tendenz zur Schließung gegenüber Zuwanderung auszumachen ist, in einer anderen aber zeitgleich eine Perspektive der Öffnung.
Warum war in der Bundesrepublik bis in den Herbst 2015 hinein die Bereitschaft relativ hoch, Menschen aus Syrien als Schutzsuchende zu verstehen? Warum erwies sie sich in Frankreich, Polen oder Großbritannien als weitaus niedriger? Warum sind die Chancen auf die Zubilligung eines Schutzstatus in Bayern anders als im Saarland oder in Sachsen – obgleich ein einheitlicher Rechtsrahmen herrscht? Wer wird warum als „echter“ Flüchtling eingeordnet, wer hingegen aus welchen Gründen und mit welchen Begründungen als „Wirtschaftsflüchtling“?
Jochen Oltmer
Dr. phil. habil., Apl. Professor für Migrationsgeschichte und Mitglied des Vorstands des Instituts für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS) der Universität Osnabrück.
HERMETISCHE DEBATTE
Die Intensität der gesellschaftlichen Aushandlung über Migration verspricht in der Bundesrepublik Deutschland und in Europa auch in den kommenden Jahren nicht nachzulassen. Zu fragen ist allerdings, ob die Voraussetzungen gegeben sind, die Debatten in Zukunft sachhaltiger zu führen. Auffällig ist, dass die Diskussionen der vergangenen Jahre in vielerlei Hinsicht ausgesprochen hermetisch blieben, das heißt: Gesprochen und geschrieben wurde vor allem über Bewegungen nach Deutschland und über Fragen der Niederlassung von Zugewanderten in Deutschland. Informationen über Migrationsbewegungen und ihre Folgen, die nicht unmittelbar Deutschland betrafen, waren ausgesprochen dünn gesät. Man könnte also davon sprechen, die deutsche Debatte sei weltvergessen geführt worden.
Hermetisch war sie auch in anderer Hinsicht: Diskutiert wurde vornehmlich über Migrantinnen und Migranten, selten mit ihnen. Vor dem Hintergrund ausgeprägter Polarisierungen ergaben sich zudem kaum Gespräche zwischen unterschiedlichen Meinungslagern. Vielfach dominierten Ad-hoc-Thematisierungen, die zum Teil in Form von Skandalisierungen Einzelaspekte hervorhoben. Sie beherrschten über Tage und Wochen die Debatten über Migration, führten auch zu raschen politischen Positionierungen und gesetzlichen Regelungen, verschwanden aber zumeist ebenso rasch wieder aus den politischen, medialen und öffentlichen Diskussionen, wie sie gekommen waren. Ein Bemühen darum, solche Einzelaspekte in einen weiteren Zusammenhang einzubetten und sie historisch einzuordnen, blieb meist aus. Mithin erwiesen sich die Debatten nicht nur als weltvergessen, sondern auch als geschichtsblind und kontextarm.
Solche Bedingungen führten dazu, dass zahlreiche Verkürzungen und Mythen das gesellschaftliche Aushandeln über Migration prägten. Am Beispiel der Vorstellungen über die Realisierungschancen des politischen Konzepts der „Fluchtursachenbekämpfung“ sollen solche Beschränkungen der Debatte skizziert werden.
POLITISCHE UND GESELLSCHAFTLICHE ERWARTUNGEN AN EINE „BEKÄMPFUNG DER FLUCHTURSACHEN”
„Fluchtursachenbekämpfung“ gilt weithin als ein migrations- und entwicklungspolitisches Zukunftskonzept. Kaum jemand vermag sich der auf den ersten Blick bestechenden Logik zu entziehen, ein effektives und nachhaltiges Mittel im Umgang mit den Fluchtbewegungen der Welt sei die Beseitigung ihrer Ursachen. Europäische Union und Bundesregierung haben dazu in den vergangenen Monaten umfangreiche Maßnahmenkataloge vorgelegt. Nicht zuletzt deshalb ist der Etat des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für 2017 erheblich gewachsen und erreichte ein Rekordniveau von 8 Milliarden Euro.
Die Vorstellungen der EU, ihrer Mitgliedsstaaten, aber auch diverser Nicht-Regierungsorganisationen und vieler Expertinnen und Experten beziehen sich auf die unterschiedlichsten Aspekte: Sie reichen von kleinen Einzelprojekten zur Sicherung der Wasserversorgung an einem Ort bis hin zu Konzepten, die einen grundlegenden Umbau der Entwicklungszusammenarbeit vorsehen und ein globales „Migrationsmanagement“ begründen wollen. Sie verweisen auf sicherheitspolitische Maßnahmen, die die Intervention in Krisenzonen beinhalten oder auf diplomatische Aktivitäten, die Konflikte beenden oder verhindern sollen. Sie beschreiben handels-, wirtschafts- bzw. entwicklungspolitische Projekte, die ökonomisches Wachstum in Afrika oder Asien fördern und auf diese Weise Menschen dazu bewegen könnten, ihre Herkunftsgebiete nicht zu verlassen. Sie zielen darauf, Transitbewegungen zu steuern, umzulenken bzw. aufzuhalten oder durch Beratung oder Unterstützung zivilgesellschaftlicher Organisationen potentielle Migrantinnen und Migranten vom Bleiben in der Heimat zu überzeugen. Auf eine kurze Formel gebracht: Immobilisierung von Menschen durch politische Stabilisierung, verstärkte Zugangsbarrieren, Konfliktbegrenzung und Wirtschaftswachstum.
ERNÜCHTERNDE ERFAHRUNGEN
Auffällig ist, dass im Rahmen der Aushandlung des Zukunftskonzepts „Fluchtursachenbekämpfung“ Erwartungen formuliert werden, die selten auf Erfahrungen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte verweisen: Flucht ist bekanntlich kein neues Thema. Und intensive Debatten um die „Bekämpfung von Fluchtursachen“ gab es schon nach dem Ersten Weltkrieg. „Fluchtursachen bekämpfen -Flüchtlinge schützen“ lautete bereits 1991 das Motto des im Rahmen der „Interkulturellen Woche“ abgehaltenen „Tags des Flüchtlings“. Vor allem die 1990er Jahre waren eine Hochphase des Nachdenkens über das „Bekämpfen der Fluchtursachen“. Tatsächlich sind die Erfahrungen ernüchternd. Inwiefern und warum?
Fluchtbewegungen lassen sich dann ausmachen, wenn staatliche, halb-, quasi- und zum Teil auch nicht-staatliche Akteure (Über-)Lebensmöglichkeiten und körperliche Unversehrtheit, Rechte, Freiheit und politische Partizipationschancen, Autonomie und Sicherheit von Einzelnen oder Kollektiven so weitreichend beschränken, dass diese sich zum Verlassen ihres Lebensmittelpunkts gezwungen sehen. Eine solche Migration vor dem Hintergrund der Androhung bzw. Anwendung von Gewalt kann als Nötigung zur räumlichen Bewegung verstanden werden, die keine realistische Handlungsalternative zuzulassen scheint. Meist stehen Kriege, Bürgerkriege, Staatszerfall und Maßnahmen autoritärer politischer Systeme dahinter.
Die vergangenen Jahre und Jahrzehnte bieten in großer Zahl Beispiele, wie schwierig es angesichts ausgesprochen unterschiedlicher Interessen verschiedenster beteiligter Akteure ist, Konflikte stillzustellen und Friedenslösungen zu finden. Die weltweit umfangreichsten Fluchtbewegungen sind Ergebnis von Konflikten, die seit Jahren oder Jahrzehnten laufen: Afghanistan, Irak, Somalia, Kongo. 41 Prozent der unter dem Mandat des Flüchtlingshochkommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) stehenden Schutzsuchenden leben in sogenannten „Langzeitsituationen“, die gegenwärtig seit durchschnittlich 26 Jahren andauern.
Weltweit herrscht Einigkeit, dass es dringend geboten ist, zwischen- und innerstaatliche bewaffnete Auseinandersetzung zu verhindern, ihre Folgen zu begrenzen und friedliche Konfliktlösungsstrategien zu forcieren. Eine globale Friedensordnung aber ist nicht in Sicht. In den vergangenen fünf Jahren hat sich vielmehr die Zahl der militärischen Konflikte erhöht, ebenso die Zahl der Betroffenen und der Umfang der materiellen Kosten. Humanitäre Hilfe für die Opfer von Kriegen und das Bemühen um den Schutz der Betroffenen haben folglich nichts an ihrer Bedeutung verloren.
2015 beispielsweise wurde zwar ein großer Teil der von den Vereinten Nationen für Nothilfe verausgabten 28 Milliarden US-Dollar für Flüchtlinge verwendet, allerdings blieben die zur Verfügung stehenden Mittel deutlich hinter den benötigten Summen zurück, weil Krisenaufrufe nicht genügend Spenden und Beihilfen einbrachten. 28 Milliarden US-Dollar mag als viel erscheinen, bleibt aber doch ein geringer Betrag angesichts von 14,3 Billionen US-Dollar, die 2016 weltweit für das Führen von Kriegen und Bürgerkriegen aufgewendet worden sind.
Fluchtbewegungen waren in der Vergangenheit und sind in der Gegenwart ein Normalfall der Weltgesellschaft. Das Bemühen um die Verhinderung und Stilllegung von Konflikten kann von daher auch für die Zukunft nicht bedeuten, den Schutz von Flüchtenden zu vernachlässigen. Im Gegenteil: Die vergangenen Monate haben erneut die enormen Defizite deutlich werden lassen, die die nationalen, regionalen und globalen Schutzregime aufweisen. Eine Debatte über die Weiterentwicklung der seit langem bestehenden Schutzmechanismen (z. B. Reform der Genfer Flüchtlingskonvention, Resettlement) und über eine Stärkung der Akteure des Schutzes, wie etwa den UNHCR, verspricht neue Perspektiven für von Gewalt Bedrohte, Fliehende oder Geflohene – aber auch für die Gesellschaften, die Schutz gewähren.
FÜHRT WIRTSCHAFTLICHES WACHSTUM ZU EINEM RÜCKGANG VON MIGRATION?
Die weit verbreitete und im Kontext der „Bekämpfung von Fluchtursachen“ häufig diskutierte Vorstellung, durch Entwicklungsprojekte mit dem Ziel einer Förderung wirtschaftlichen Wachstums Menschen immobilisieren zu können, ignoriert die Erkenntnisse der Migrationsforschung über die Hintergründe von Migration. Sieht man von durch Gewalt oder Umweltkatastrophen ausgelösten Bewegungen ab, streben Migrantinnen und Migranten danach, durch den temporären oder dauerhaften Aufenthalt andernorts Erwerbs- oder Siedlungsmöglichkeiten, Arbeitsmarkt- oder Bildungschancen zu verbessern. Migration verbindet sich dann oft mit biografischen Grundsatzentscheidungen wie Arbeits-, Ausbildungs- oder Studienplatzwahl, Berufseintritt oder Familiengründung; die Mehrzahl der Migranten sind folglich Jugendliche und junge Erwachsene.
Ein Großteil der weltweiten Bewegungen findet nicht deshalb statt, weil Menschen im Elend leben und dem zu entfliehen suchen. Unzählige Forschungsergebnisse machen vielmehr deutlich, dass Armut und Not die Handlungsmacht von Menschen beschränkt, Migration behindert oder sogar verhindert. Ein großer Teil der Menschen in den ärmsten und armen Gesellschaften der Welt kann keine Bewegung über größere und große Distanzen absolvieren, weil Migrationsprojekte immer kostspielig sind.
Darüber hinaus sind elementare Ressourcen vieler Menschen lokal gebunden, sodass die Möglichkeiten einer (zumal dauerhaften) Abwanderung vielfach eher gering bleiben: Das gilt für Bodenbesitz ebenso wie für Qualifikationen oder Bildungsabschlüsse, die nur im Herkunftsland anerkannt werden. Hinzu treten soziale Bindungen vor Ort: Sind die persönlichen Netzwerke eines Menschen vornehmlich lokal verankert, ist eine Migration unwahrscheinlich. Weltweit betrachtet, ist der Umfang der translokalen verwandtschaftlich-bekanntschaftlichen Netzwerke gering und damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass räumliche Bewegungen stattfinden.
2017 gab es nach Angaben der UN weltweit 258 Millionen Menschen, die seit mehr als einem Jahr in einem Staat lebten, in dem sie nicht geboren worden waren. Das mag als viel erscheinen, entsprach aber nur einem Anteil von 3,4 Prozent der Weltbevölkerung.
Entwicklungszusammenarbeit kann das Ziel verfolgen, Notlagen zu beseitigen, die Gesundheitsversorgung zu verbessern, den Bildungssektor zu stärken, die wirtschaftliche Produktion zu erhöhen, internationale Wettbewerbsfähigkeit herzustellen und Rechtssicherheit zu verbessern. Aber sie wird nicht substantiell dazu beitragen können, dass Menschen die Vorstellung verlieren, andernorts gäbe es für sie Chancen, die sie durch Bewegungen im Raum für sich erschließen können. Wäre Migration ein soziales Phänomen, das nur aus der Not geboren ist, gäbe es nicht die umfangreichen Bewegungen zwischen den Staaten des reichen globalen Nordens der Welt.
Die Fokussierung vieler Debatten um globale Fluchtbewegungen auf die „Bekämpfung von Flucht- und Migrationsursachen“ könnte mithin die Entwicklung von Ideen und Maßnahmen be- oder verhindern, Schutzregime zu verbessern. Und sie könnte Entwicklungszusammenarbeit, noch stärker als es ohnehin schon gilt, auf die Interessen ausschließlich der „Geberländer“ ausrichten. Ein erfolgversprechendes globales Zukunftskonzept wäre das nicht.
LITERATUR
Oltmer, Jochen, Globale Migration. Geschichte und Gegenwart, München32016.
Ders., Migration. Geschichte und Zukunft der Gegenwart, Darmstadt 2017.