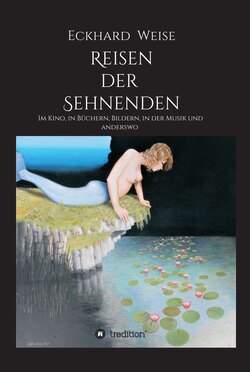Читать книгу Reisen der Sehnenden - Eckhard Weise - Страница 7
ОглавлениеKapitel I: A long, long way home …
Reisen in der Verdunkelung
Von Moglis Schmusekurs und Nils Holgerssons Gänseflugbereitschaft eher gelangweilt kämpfe ich doch lieber mit Superman gegen King-Kong zur Errettung der weißen Frau, mit Hemingway gegen Stiere aus Spaß an der Fiesta, mit John Wayne gegen Nashörner, weil die womöglich schneller sind als Geländewagen.
Und weiter: was leg ich mich bloß ins Zeug zusammen mit Kapitän Ahab, Steven Spielberg, der malträtierten Melanie Daniels und ihrem überaus mutigen Freund Mitch Brenner, damit weiße Wale, weiße Haie und in Furien verwandelte Vögel uns nicht länger Gliedmaßen, Augen oder gar das Leben rauben dürfen.
Nein, nein, durchaus nicht von kleinen fröhlich trällernden und zwitschernden Kanarienvögel im goldenen Käfig ist länger die Rede.
Ja, ja, Edgar Allen Poes Vögel sind es, die frau und man zu tautologisieren neigt, schwarze Raben., die hämisch und durchtrieben auf pechschwarzen Starkstromkabeln hocken … ach quatsch: nicht hocken, sondern lauern auf den punktgenauen Moment für die brutalstmögliche Attacke!
Am Ethologen Adolf Remane geschult entdecke ich doch tatsächlich zögerliche Rabinnen darunter. Diplomatinnen vielleicht?
Durchaus? Womöglich schon.
Aber die traurigen Reste des einstigen Matriarchats werden bedrohlich umzingelt von testosterongesteuerten schwarzbefrackten Herren im Reiche der Schatten.
War da nicht noch was?
Ach ja, natürlich! Und nicht zuletzt gilt mein mithelfender emotionaler Einsatz vom gesicherten Sitzplatz aus der Bewahrung einer großen Liebe in Bodegabay, die durch die Eifersucht einer Königin der Nacht, Missis Brenner nämlich, die - gemäß der bekannten Deutung dieser allzu menschlichen Eigenschaft mit Eifer sucht, was Leiden schafft, danach trachtet, die aufkeimende Romanze womöglich im Keime zu ersticken.
Verstand der Meisterregisseur in seinem Horrorszenario vielleicht nicht den Ausbruch des ornithologischen Furors als Metapher für die Boshaftigkeit einer schwachen Witwe, die fürchtete, noch einmal den starken Mann an ihrer Seite zu verlieren?
Und übrigens apropos John Wayne: sich von seinen Schlachten gegen Tier wie Mensch begeistern zu lassen - wie lange in ferner Zukunft eigentlich noch wird man sich dafür schämen müssen? Im Hellen.
Rosebud II
Um Haaresbreite wäre es dem Pressezaren William Randolph Hearst gelungen, einen Jahrhundertfilm und die weitere Karriere eines Jahrhundertregisseurs nachhaltig zu beschädigen.
Wegen der unverblümten Kritik an einer anscheinend unbegrenzten Einflussnahme eines vordemokratischen Zeitungsmagnaten auf die Politik.
Wie wir alle zu wissen glaubten.
Das Leinwanddrama brachte den Meinungskonzern keineswegs ins Schwanken.
Gab es also für Hearsts Hass auf den Grünschnabel von der Ostküste, der die Frauen in Hollywood im Sturm eroberte, einen anderen – tiefergreifenden – Grund?
Das Kunstwerk hatte ein noch in engen Kreisen gehütetes Geheimnis Hearsts in alle Welt hinausposaunt, die romantische Bezeichnung, die der steinreiche uralte Herr seiner jungen nicht sonderlich treuen Geliebten, der Schauspielerin Marion Davis, einst zugehaucht haben muss, nämlich diejenige für ihre Klitoris!
Und die raunte nun sein Abbild, John Foster Kane, als letztes Wort, bevor er stirbt, in der Eröffnungsszene und prangte in schwarzen Lettern und einer stilisierten schwarzen Rosenknospe im Finale verbrennend und orakelhaft bleibend auf einer Studiorequisite, einem Schlitten . . . den sich übrigens „Citizen-Kane“-Verehrer Steven Spielberg später auf einer Auktion ersteigerte - im Glauben, es sei ein Unikat. Na, wenn der gewusst hätte! Aber das ist ja eine andere Geschichte.
(Und eine andere wäre, zwei Fragen nachzugehen, und zwar erstens, wieso sich ein Reporter auf die Suche nach der Bedeutung des Sterbenswortes begibt, wenn es doch niemand gehört haben kann, denn der Multimilliardär verstarb einsam und allein, und zweitens, wie es denn angehen kann, dass dieser Widersinn innerhalb der siebten Kunst einst und womöglich bis heute – fast - niemandem aufgefallen ist.)
Genial, aber viel zu naiv hatte Orson Welles 1941 ein heiliges Gesetz in seinem Land gebrochen: über Geld und – zumindest nicht geschützt genug – über Sex zu reden.
Zwischen Weimar und uns liegt Buchenwald.
Schwerst erkrankt verlangte mir nach einem Buch, das zu lesen ich in Zeiten des Wohlergehens scheute.
Triftige Gründe für die eine wie die andere Gestimmtheit sind mir unerfindlich geblieben.
Im Konzentrationslager Buchenwald, dort, wo es unter zerstörter Humanität allenfalls kleinste Regungen von Mitmenschlichkeit geben konnte, durfte – auf Seiten der Täter ohnehin schwerlich, auf Seiten der Opfer nicht selbstverständlich.
Und doch wird eines Tages ein kleines jüdisches Kind hineingeschmuggelt, um es vor der Vergasung zu bewahren.
Meine Erkrankung hinderte mich daran, mehr als zwei, drei Seiten am Tage zu lesen.
Oder war es doch die Schilderung der Grausamkeiten, die diese Hinderlichkeit verursachte, und nicht die Erkrankung?
Nach einer Woche dieser Art der Lektüre im Trippelschritt ein Wunder.
Mit einer Taschenlampe unterm Bettlaken las ich das Buch – zumeist ungestört von Mitpatienten und Nachtschwestern – zügig bis zum befreienden Ende, für den Leser, mehr aber noch für das Kind und die meisten seiner Retter: der Junge hatte also Auschwitz und zuletzt eben auch Buchenwald überlebt.
Die Ärzte*innen untersuchten mich immer wieder, prüften und verglichen die Befunde.
Sie schüttelten die Köpfe und konnten sich meine überraschende Genesung nicht erklären.
Wie sollten sie denn auch!
Hatte sich mein Leiden durch Nacherleben von und Einfühlung in unermesslich größeres Leid und einer finalen Befreiung davon womöglich wenn nicht auf wundersame, so doch heilvolle aristotelische Weise relativiert?
Preziosen mit Prognosen
Auf einer Insel gibt es das Café „Crêperti Tati“, das offenbar bestbesuchte weit und breit.
Am Eingang prangt ein Schild mit der Aufschrift „Elvis“ - anscheinend passend zu den Rhythmen von drinnen.
Davor parkt ein blau-rot-rostfarbener Cadillac, fahruntüchtig seit langem, soviel ist sicher.
Dieses ins Auge stechende Empfangsensemble wird weitläufig eingekreist von einer Vielzahl an Oldtimern: Volvos, Mercedes, Peugeots, VW, und last but not least steht da doch ein alter Linienbus.
Hatten wir den nicht zuletzt im Kino gesehen, in Hitchcocks Politthriller „Der zerrissene Vorhang“ (Torn curtain), und zwar in der Kulisse einer Fahrt von Leipzig nach Berlin? Unter den Passagieren versuchten ein amerikanischer Physikprofessor und seine Verlobte samt seiner schlau erschlichenen östlichen Geheimformel den Häschern zu entkommen.
Das wohl Einmalige an dieser Installation: die Wagenburg erscheint ausschließlich in Rost bei ansonsten halbwegs erhaltenen Karosserien.
Wo hat man so etwas schon gesehen und gehört?
Der erste Eindruck: Bild und Ton erzeugen verklärte Vergangenheit.
Der zweite Eindruck: Bild und Ton provozieren einen Blick auf Künftiges.
Während der kraftvolle Rock, gespielt und gesungen von dem erst seit einem Jahr von seiner Drogensucht befreiten Neil Young mit „Everybody knows this is nowhere“ bereits eine Zeit jenseits der Gegenwart kreiert, sprechen die glaslosen Scheinwerfer des seltsamen Fuhrparks eine andere Sprache.
Dem nachzutrauern oder sich daran zu erfreuen, das mag jeder so tun, wie er mag.
Moonlightexpress
Jede gute Familie ist bestens geordnet. An kleinen eckigen Tischen steht an jeder Seite ein Stuhl.
Selbst Spiele verlaufen nach Regeln. Das weiß man ja.
Eisenbahnen drehen ihre Runden im Kreis oder in Achten.
In Puppenstuben werden beständig blonde, brünette oder schwarze Haare gekämmt.
Manchmal jedoch ist es Kindern erlaubt, Stühle aneinanderzureihen zu einem Zug, der sich bei Tageshelle langsam in Bewegung setzt – nicht allzu weit, immerhin zu neuen Ideen:
Die Decken fehlen!
Verdeckt wird das Gestühl zum Nachtexpress. Aus dem Kaufmannsladen schnell ein wenig Puffreis und paar Zuckerperlen gegriffen für den Speisewagen, ach – und die verstruwelte Puppe beinahe vergessen, und los geht’s mit Volldampf durch Wälder voller Wölfe und über Gebirge reich an tiefen Schluchten hinauf zum sanft lächelnden Mond, auf dem uns all die den Anreisenden gewogenen Geister, Feen und Trolle uns freudig erwartend entgegeneilen und nun händereichend rufen: „Wo ward ihr denn so lange, ja, wo ward ihr denn bloß?!!“
Und ein aufgeregtes Erzählen will gar nicht enden, einander mit Freudentränen anschauend – wie immer auf gleicher Augenhöhe. Auf Augenhöhe? Wie war das denn nur möglich bei all den vielen Riesen und Zwergen in der Runde?!
Zuletzt singen wir zusammen mit Peterchen und Anneliese unser liebstes Trostlied – begleitet von Herrn Sumsemann auf seiner Geige voller Inbrunst, denn er hatte es heute mit hilfreichen Mächten vermocht, sein sechstes Beinchen zurückzuerobern:
„… verschone uns, Gott, mit Strafen, und lass uns ruhig schlafen und unseren kranken Nachbarn auch.“
Und wie sehnsüchtig doch begeben wir uns auf den Heimweg – zu unser geliebten Mutter. Hat sie nicht bereits zum dritten Mal zum Abendbrot gerufen?
Mit Mut und Zuversicht kehren wir zurück in unseren nächsten Lebensabschnitt - in den Vertrauen stärkenden geplanten Alltag.
Statione Termini
Etwas jünger vielleicht als Bruno, der an der Seite seines bislang arbeitslosen Vaters nach dem diesem gestohlen Fahrrad (die Voraussetzung für den Minijob als Plakatkleber) sucht – vergeblich! -, habe ich erstmals erlitten, dass Väter nicht nur streng sein, sondern auch weinen können.
Jahre später noch habe ich wie die Laientheaterenthusiasten und die Müllmänner den beiden bei der Suche helfen wollen …
Endlich in Rom suche ich nach Bruno, meinem gefühlten Alter Ego.
Doch kein Viertel der Stadt zeigt sich mehr so, wie es einmal war, als Bruno sie durchstreife.
Und dennoch entdecke ich ihn endlich an der Statione Termini.
Er winkt mir bedauernd zu mit einer Handbewegung, wie sie als typisch erscheint für Menschen aus Italien, steigt in den Zug und reist hinfort.
In einem kleinen Kino nicht weit vom römischen Hauptbahnhof durchschauert mich ein arabisches Leinwanddrama über ein Mädchen, das davon träumt, ein Fahrrad zu besitzen.
Meine Gewohnheit, mich nur innerhalb der Grenzen Europas zu bewegen, werde ich wohl bald aufgeben müssen.
Brescella
In der italienischen Region Emilia-Romagna hat Jesus Christus zu einem Menschen gesprochen.
Deswegen hat dieser – gelegentlich auf einem Rennrad unterwegs – für seinen geheiligten Herren gekämpft – manchmal sogar mit der Faust.
Und gekämpft hatte der katholische Geistliche einst gegen den Faschismus, gemeinsam mit einem Kommunisten, der später von den Einwohnern Brescellas zum Bürgermeister gewählt wird.
Im Roman und im Kino ist alles möglich. Zumindest Letzteres hat es auch in der Wirklichkeit gegeben.
Neben der Buchreihe hat bzw. haben wohl kaum ein Film (und seine fünfteilige Fortsetzung) das Italien-Bild der 68er-Bewegung mehr geprägt als die immer wieder zu Lachtränen rührenden Darstellungen der Zwistigkeiten zweier Dickschädel, aber auch ihrer Zeichen der Versöhnlichkeit aus alter und neuer Verbundenheit. Inszeniert wurden sie in dem am Po liegenden Dorf Brescella.
Und das ist das Wunderbare für uns Kinoreisende: das Drama über Brunos vergebliche Fahndung nach dem gestohlenen Rad ist auch die hier gedrehte Serie überwiegend außerhalb vom Studio Cinecità entstanden.
Im Unterschied zu Rom jedoch ist in Brescella fast noch alles am alten Ort.
Die Gassen, die Pappelallee vor dem Deich, der Platz in der Dorfmitte.
Und welche Liebhaber*innen dieses einzigartigen Ambientes trotz Strapazierung aller grauen Zellen gar nicht mehr so sicher ist, mit bzw. von wem, was, wann passiert ist, gesagt, geflüstert oder gebrüllt wurde, der oder dem sei ein Besuch des inzwischen zentrumsnah errichteten „Museo di Don Camillo e Beppone“ anempfohlen, das immerhin mit allen sechs Teilen der Kultserie aufwartet.
Wir lauschen indessen unbeirrt dem vertrauten Klang der Glocken, du betrittst andächtig das altehrwürdige Kirchenhaus, den angenehmen Duft des Weyrauchs nimmst du wahr - erstmals natürlich.
Doch dann? Ich traue meinen Ohren nicht.
Spricht da nicht plötzlich aus der Apsis eine sanfte Männerstimme zu dir?
Warschau
Mitten im Krieg war mein Großvater mit meiner kaum 16 Jahre alten Mutter in der Straßenbahn durchs Warschauer Ghetto gefahren, um sie davon zu überzeugen, dass, wenn sie es denn täte, nicht länger an Hitler glauben dürfe.
Und von diesem Tage an glaubt sie tatsächlich ihrem gütigen Vater mehr als der Anführerin des „Bundes deutscher Mädel“ in ihrem Wohnviertel – was gar nicht so wenig Mut erforderte unter den damals herrschenden Verhältnissen.
Dennoch. So oft mir beide von ihrer kurzen Durchfahrt durchs Ghetto erzählten, in der sie eingesperrte jüdische Menschen betrachteten, der Eindruck, den ihr Erschrecken in meiner jugendlichen Vorstellungswelt hinterließ, erwies sich als recht wage, und das Ausmaß des Leides der Gefangenen blieb über viele Jahre allzu abstrakt.
SS-Schergen erstürmen eine Ghettowohnung im 4. oder 5. Stock, in der sie Widerstandskämpfer vermuten.
Sie treffen auf eine gutbürgerliche Familie beim Abendessen. Als der im Rollstuhl sitzende Großvater es wagt, die Soldateska zu fragen, warum man sie beim Essen störe, wirft man ihn in Sekundenschnelle vom Balkon.
Roman Polanski, der als Kind das Ghetto erleiden musste und ihm wie durch ein Wunder entkam, veranschaulichte für mich allein schon mittels dieser einzigen Filmszene das schlimmste Ausmaß solcher Willkürherrschaft. Ich erschauderte an Leib und Seele.
Mein Großvater und meine Mutter – hatten sie denn das Martyrium, das sich hinter dem Bild der zwar gefangenen, aber doch auch geschäftig erscheinenden Kinder, Frauen und Männer, verbarg, zu erahnen oder zu verspüren vermocht?
Um wie viel stolzer bin ich doch seit diesem Kinotag auf meine Mutter und auf meinen Großvater!
Anderort
1
Die Verfolgung von religiösen Menschen durch andersgläubige Menschen reicht weit zurück in der Historie von uns Erdenbürgern und wird leider auch unsere Zukunft prägen – in welchem Maße, darüber entscheidet das veränderbare Größenverhältnis von Humanisten zu Menschenfeinden: erbarmungslose Verfolgung von Schwarzen durch Weiße, Christen, Juden, Sinti, Roma und andere Ethnien und Glaubensrichtungen auf der einen Seite, deren beherzte Rettung auf der anderen Seite.
Die Macht von Verbrechen gegenüber Barmherzigkeit ist, wie wir ja wissen, nicht abhängig von einem womöglich alternativlos waltenden höheren Schicksal sondern vom Gewissen jedes einzelnen von uns.
Ich will eine kleine utopische Geschichte erzählen aus einer Schreckensepoche, als Millionen jüdischer Mitbürger insbesondere von Deutschland aus nach Auschwitz verbracht wurden, um dort vergast zu werden.
Angesiedelt ist sie in einem waldhessischen Bergdorf namens Anderort zwischen Hersfeld und Fulda gelegen und sieben Kilometer südlich von einer anderen waldhessischen Ortschaft namens Rhina.
In der Zeit der Schilderung dieser Geschichte, nämlich vom 7. bis 9. November 1938, lebten in beiden Dörfern jeweils um die 700 Einwohner, wobei die Mehrheit jeweils dem jüdischen Glauben anhing.
Die Geschichte Rhinas ist im Unterschied zu der Anderorts eine Dystopie und sehr real: alle jüdischen Einwohner*innen wurden gefasst, nur die wenigsten überlebten die Todeskammern.
Die Utopie Anderort dagegen besteht, je nachdem, wie wir es sehen wollen, aus faked news oder aus der Schilderung einer möglichen Welt, die anders ist und erst sieben Jahre später an einem realen anderen deutschen Ort geschieht, nämlich im KZ Buchenwald auf dem Ettersberg bei Weimar, wo malträtierte gefangene Männer mit einem gelben Stern und andersfarbigen Winkeln am blauweiß gestreiften KZ-Einheitshemd, Juden also, Kommunisten, Sozialdemokraten, Christen, Homosexuelle, Kriminelle gar der Welt ein wahres Wunder bescherten, nämlich gemeinsam ein kleines jüdisches Kind in ihren Behausungen zu verstecken und somit vor der Reise in den Tod zu bewahren.
Der ostdeutsche Schriftsteller Bruno Apitz hat über das Wunder dieser glaubens- wie anhängerschaftsübergreifenden Mitmenschlichkeit einen ergreifenden Roman geschrieben, „Nackt unter Wölfen“, der verfilmt wurde zunächst in der DDR u. a. mit Armin Müller-Stahl fürs Kino und später nach der Wiedervereinigung noch einmal fürs Fernsehen.
2
Es war gegen Mittag, als Pfarrer Thomas Altrock in Anderort einen Anruf von seinem Amtsbruder Jakob Münster aus Kassel erhielt. Der fragte nur, ob es bei ihnen im Dorfladen heute auch weniger Bananen gegeben habe, und erhielt eine verneinende Antwort. Sie legten rasch wieder auf. Beide Männer verstanden sich als Anhänger der von Dietrich Bonhoeffer gegen die opportunistische Mehrheitskirche der Deutschen Christen begründeten antifaschistischen Bekennenden Kirchengemeinschaft. Genau wie die Amtsbrüder, die aus Fulda und Bebra in Anderort anriefen mit ähnlichen Fragen wie diejenige von Pastor Münster, nämlich ob es nach wie vor nötig sei, mit Gesangsbüchern bzw. einer Vervielfältigungsmaschine auszuhelfen.
Am 7. November 1938 lag Brandgeruch in der nord- und osthessischen Luft.
Was aber genau hatten die Telefonate der geistlichen Herren zu bedeuten?
In einer Art Geheimsprache – denn selbstredend wurde die Telefone von der Gestapo abgehört – hatten sich die Kollegen darüber informiert, dass einerseits Zerstörungen jüdischer Geschäfte, initiiert durch SA-Schlägertrupps, begonnen wurden, diese andererseits aber offenbar ohne nennenswerte Gewaltbereitschaft von Seiten der breiten Bevölkerung blieben.
Und am Abend wusste man mit hinreichender Sicherheit, dass es den Nazis mit dieser Art Generalprobe in den drei genannten hessischen Städten nicht gelungen war, den höllischen Funken auf weitere Gebiete überschlagen zu lassen.
Für Pfarrer Altrock, dem trotz aller Vorahnung die Nachrichten mit großem Schrecken in die Knochen gefahren waren, bedeuteten sie, sofort Alarm zu schlagen in dem Teil der Dorfgemeinschaft, der sich eindeutig dafür entschieden hatte, in unterschiedlichen Formen Widerstand zu leisten gegen die rassistische Diktatur – dort also den Notfall auszurufen so heimlich wie nur irgendwie möglich, aber auch so nachdrücklich.
Thomas Altrock wählte die Nummer der örtlichen Polizei. Neben dem Pastorat und der Feuerwehr gab es nur dort noch ein Telefon im Dorf.
Es meldete sich die Gattin des Wachtmeisters, Frau Lohmann, die er bat, ihre Tochter Paula, seine Konfirmandin, zu ihm zu schicken, um mit ihr noch Einzelheiten der Gestaltung des Ende des Monats stattfindenden Totensonntages vorbereiten zu können.
Kaum fünf Minuten später klingelte es an der Tür des betagten Pastorats. Lisbeth, die Frau des Pfarrers, öffnete, bat Paula herein und im Wohnzimmer Platz zu nehmen und bot ihr eine Tasse mit heißem Kakao an.
Als der Pfarrer den Raum betrat, wusste Paula sofort Bescheid.
Seit vielen Wochen wurde im Konfirmandenunterricht ein Plan erarbeitet, um im Fall der Fälle Leib und Leben der jüdischen Mitbewohner*innen, der liebgewonnenen Nachbar*innen, Freund*innen, Vereins- und teilweise sogar Familienmitglieder zu bewahren.
Über viele Wochen also war ein engmaschiges Netzwerk entstanden, das von evangelischen Kindern und Jugendlichen ausgehend die Hilfsbereitschaft in praktischen Rettungsmaßnahmen durch einen maßgeblichen Teil der Dorfbewohner*innen effektiv zu koordinieren vermochte.
Nach Pfarrer Altrock war die 14-jährige Paula Lohmann sozusagen der zweite Eckstein dieser Bewegung. Sie benachrichtigte in aller Eile aber nicht unbesonnen ihre beteiligungswilligen Mitkonfirmand*innen, die wiederum ausschwärmten, um die verschworenen erwachsenen Vertreter*innen der Dorfgemeinschaft zu kontaktieren, damit ein sogenannter Dorfrat einberufen werden konnte.
In der Zusammensetzung dieses Rates spiegelten sich in etwa die altersmäßigen, sozialen, beruflichen und glaubensmäßigen Verhältnisse von Anderdorf: ein christliches 14-jähriges Mädchen also war vertreten wie eine 93 Jahre alte Baronin, Arbeiter*innen, Bäuerinnen und Bauern, Bürger*innen, ein staatlicher Mandatsträger, nämlich Bürgermeister Niemeyer, selbstverständlich Mitglied der NSDAP … wie sollte es auch anders sein. Und auch meine Wenigkeit, das berichtende Dorfschullehrerlein.
Von besonderer Wichtigkeit in der Runde erwies sich die Beteiligung des kommunistischen Druckermeisters Erwin Grosche, der seit der Machtergreifung der Nazis Anfang 1933 gute vielfältige Erfahrungen sammeln konnte mit der Fälschung von Pässen, in der es nicht allein genügte, das „J“ verschwinden zu lassen.
Zum Vorsitzenden hatte die Versammlung den 85-jährigen dänischen Kapitän Asmus Rasmussen gewählt, der seine Heimat in den frühen 20er Jahren verlassen hatte, um seiner großen Liebe Rosemarie nach Deutschland zu folgen, einer einst hochrangigen Genossin der KPD, die im Zuge des Reichstagsbrandes 1933 verhaftet worden war und seitdem in den Folterkellern der Gestapo als verschollen galt.
Ihr trauernder Ehemann, ein aufrechter Sozialdemokrat, hatte viel lernen können von seiner mutigen Frau, von den Kader- und Konspirationsprinzipien der KPD, insbesondere im Zusammenhang mit Aktionen in rein politischer wie auch militanter Form, die generell so durchgeführt wurden, dass die Aktivisten gemeinsam handelten, naturgemäß, jedoch niemand eine Genossin und/oder einen Genossen persönlich kennen durfte, um im Falle der Gefangennahme niemanden verraten zu können – was bekanntlich nicht, wie erhofft, vor Folter der Nazischergen schützte.
Der alte Käpten eröffnete die Sitzung mit seinem Credo: „Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.“ Dann setzte er fort: „Meiner Meinung nach sind unsere Chancen, hier und heute zu gewinnen, sehr gering. Was wir wissen, ist, dass sie heute Vormittag mit der Generalprobe begonnen haben. Was wir nicht wissen, wann die Stunde der großen Erstaufführung folgt. Heute Abend noch? Morgen früh? Aber genau diese Unwissenheit lässt uns für Momente nur - vielleicht - nicht den Mut verlieren, unseren Rettungsplan schnellstmöglich in die Tat umzusetzen, statt wie das Kaninchen vor der Schlange zu erstarren. Aber wir müssen sofort handeln. Es begebe sich bitte jeder an seinen Platz. Gott sei mit uns.“
3
Das von langer Hand vorbereitete Notfallkonzept sah im wesentlichen drei Ebenen der Errettung vor:
- das direkte Verstecken von Menschen hier im Dorf an vielen geheimen Örtlichkeiten insbesondere im Bereich der Bauernhöfe, die zunächst mit Vorräten für zwei bis drei Wochen ausgestattet waren
- das indirekte Verstecken vor allen von Kindern und Jugendlichen in nichtjüdischen Familien. Ihnen wurden nicht nur der Judenstern abgenommen, sie erhielten auch neue Ausweise, soweit das vom Alter her nötig war. Dies war eine sehr kurzfristige Maßnahme, bis geeignete Reisewege gefunden wurden, denn es war selbstverständlich damit zu rechnen, dass kein Einwohnermeldeamt den Blick in seine Karteien verweigern würde.
- die Flucht ins Ausland von möglichst vielen umliegenden Bahnhöfen aus. Die Exilanten waren versorgt worden mit unauffälligem Gepäck, Fahrkarten für Bus, Bahn und Schiff, neuen Papieren und das wichtigste vielleicht – mit Adressen von Gastgebern in Skandinavien, Großbritannien, Frankreich und Übersee.
Das zivile wie zivilcouragierte Kommando „Schutzengel“ lief weitgehend reibungslos ab, weitaus besser zumindest, als Kapitän Rasmussen zu hoffen gewagt hatte. Besonders erfreut hatte ihn das vorbildliche Engagement von nichtjüdischen und jüdischen Freundeskreisen unter den Jugendlichen. Andererseits tat sich gerade hier eine höchst enttäuschende Neigung zum Verrat der Aktion auf.
Zunächst möchte ich von der gelungenen „Verbringung“ der Tante Mie berichten, der Besitzerin des Dorfladens. Wie konnte wohl der allseits sehr beliebten jüdischen Kauffrau geholfen werden, damit sie nicht an Leib und Seele Schaden nehmen würde, und die Dorfbevölkerung womöglich Hunger erleiden müsste?
Fast um die Uhr herum versorgte sie ihre seit Jahrzehnten gewachsene treue Kundschaft stets mit dem Nötigsten an Lebensmittel vor allem. Wenn etwas fehlte in ihren Regalen, dann notierte sie sich das mit einem dicken Bleistift auf einer Liste. Mit der und einer großen hellbraunen ledernen Einkaufstasche begab sie sich in den einmal pro Woche, nämlich freitags, fahrenden Bus sommers wie winters ins 23 Kilometer entfernte Hersfeld, um die Kundenwünsche zu erfüllen.
So kam es in der schneereichen Adventszeit schon mal vor, dass Tante Mie manchen Freitag Abend nicht nur mit ihrer Einkaufstasche sondern mit weiterem Gepäck überhängt und vollgeschneit vor ihre Ladentür trat und dem einen Mädchen oder anderem Jungen wie die leibhaftige segenbringende Weihnachtsfrau erschienen sein mochte.
Seit vielen Jahren hatte sie es sich zur Angewohnheit gemacht, ihre Kunde*innen allen Alters zur Selbständigkeit zu ermuntern – Kinder und Jugendliche vorzugsweise. Es gab zuletzt kaum Käufer*innen, deren Warenwünsche nicht mit Tante Mies Aufforderung beschieden worden waren: „Nimm selbst!“
Und diese Schrulle erwies sich als besonders nützlich – jetzt, in der Situation, in der Tante Mie versteckt werden musste, und sie wahrhaftig vertreten werden konnte durch Jugendliche vor allem, die die Lücke, die ein so herzensguter Mensch wie Tante Mie hinterließ, zwar nicht zu ersetzen vermochten, die aber voller Selbstvertrauen an ihre Stelle traten und dieser alle Ehre erwiesen.
„Edel sei der Mensch, hilfreich und gut.“ Wer weiß denn nicht, dass Goethes Imperativ, sein himmlischer Vorsatz, bis heute beständig angefeindet wurde und weiterhin wird. So auch in unserer kleinen Geschichte über das Ausnahmemusterdorf - gleichwohl mit Ausnahmen von der Regel.
In welchem Spiel gibt es denn nicht einen Schwarzen Peter? In welchen Legenden gibt es nicht einen Verräter Judas Ischariot und/oder einen Verleugner Petrus?
Bevor der Hahn gekräht hatte, zogen sie los mit ihren Rädern, Otto, Aron und Hans-Peter, nach Hersfeld, und zwar mit der festen Absicht, das Fluchtprojekt „Schutzengel“ an die Henker zu verraten, weil sie sich von ein paar Silberlingen hatten verlocken lassen.
Die drei Jungen waren enge Freunde. Aber war denn Aron nicht ein Jude? Sehr wohl – was der Freundschaft indes keinen Abbruch leistete. Was durchaus schwer zu verstehen ist, dass Aron der Freundschaft zu zwei Nichtjuden einen wesentlich höheren Stellenwert einräumte als der Sicherung seines Lebens. Vielleicht, um nicht ewig der Außenseiter zu bleiben?
Aron hatte mit seinen Freunden bis Ostern 1936 das 5. Schuljahr des Hersfelder Gymnasiums für Jungen besucht, das er nun im Zuge der Nürnberger Rassengesetze verlassen musste. Auch aus der Mitgliedschaft im Deutschen Jungvolk der Hitler Jugend, den Pimpfen, war er – selbstredend? - ausgeschlossen.
Es war der Oberscharführer eben dieser Hitlerjugend Kurt Wolf, der seit Monaten seinen Jungstamm zur Wachsamkeit ermahnte in Stadt und Land, wo immer jeder einzelne von ihm auch wohnte, sich umzusehen und umzuhorchen, ob es irgendwelche Versuche der bolschewistischen Juden, dieser schmarotzenden Ratten, wie er sich stets auszudrücken pflegte, sich davonzuschleichen wie die Strauchdiebe, um ihrer gerechten Strafe zu entkommen. Für jede einzelne Aufdeckung solcher heimtückischen Vorhaben würden aufmerksame Detektive in unseren Reihen mit 100 Reichsmark und einer Tapferkeitsmedaille belohnt.
Und die angefeuerten Freunde Otto und Hans-Peter versprachen ihrem guten getreuen Kameraden Aron feierlich, sich im Falle des erwartbaren Erfolgs die Geldbelohnung zu teilen.
Als die Drei Unterhaun erreichten, den südlichen Vorort von Hersfeld, schlugen ihnen ätzende Rauchschwaden entgegen. In der Stadt angekommen trauten sie ihren Sinnen nicht: Flammen loderten aus allen Himmelrichtungen, lautes Gebrüll von teils in Kolonnen marschierenden, teils wild umherlaufenden SA-Leuten, die Fensterscheiben einschlugen und Sprüche wie „Kauft nicht beim Saujuden!“ mit weißer Farbe an Hauswände neben offenbar jüdischen Geschäften schmierten.
Ihre Schule fanden die Jungen geschlossen vor. Der Pausenhof war übersät mit verletzten Menschen in Zivil wie in Uniform – unter ihnen der blutüberströmte Oberscharführer Wolf.
Ihm die Aktion „Schutzengel“ verraten?
Mit Abscheu wandten sie sich von ihm ab.
Sie schämten sich vermutlich in einem ähnlichen Maße dafür, sich in Versuchung geführt haben zu lassen. Otto und Hans-Peter in der Hoffnung, ihr Taschengeld deutlich aufbessern zu können. Und der Aron wegen vermeintlicher oder tatsächlicher Blutsbrüderschaft oder einfach blinder Gefolgschaft.
4
Wie getretene Hunde kehrten sie in Richtung Anderort zurück, zitternd vor Angst, sie würden zu Hause ein ähnliches Bild der Zerstörung im Kleinen vorfinden wie in der Stadt. Dort angekommen staunten sie nicht schlecht darüber, das ihr Dorf verschont geblieben war.
Hatte es denn selbst einen Schutzengel gehabt?
Sie suchten sofort Ottos und Hans-Peters Konfirmationspfarrer auf, um ihm vom Inferno in Hersfeld zu berichten und ihre schändlichen Gedanken und Begehrlichkeiten tränenreich zu beichten.
Der Seelsorger hielt jedem von den drei Freunden für einen Augenblick die Hand auf den Kopf und sprach: „Im rechten Moment ist aus dir, einem Saulus, ein Paulus geworden. Es sei dir verziehen.“
Dann berichtete er ihnen, dass er bereits gehört hätte, die Nazis wären auch mit ihrem zweiten Versuch, diesmal in einer einzigen Stadt, gescheitert, den Flächenbrand einer reichsweiten Pogromstimmung zu entfachen. „Gott sei‘s geklagt. Wir wissen nicht, wie es weitergeht.“
Was denn aus der Aktion „Schutzengel“ geworden sei, wollten die Jungen von Herrn Altrock wissen.
Dieser verweigerte ihnen die Antwort auf ihre Frage mit der Begründung, das dürfe er ihnen gar nicht sagen. „Alle aktiv und passiv Beteiligten seien zu strengstem Stillschweigen verpflichtet. Aus Sicherheitsgründen. Ihr seht ja, was ihr beinahe angerichtet hättet. Aber eines kann ich euch sagen. Von einer Konfirmandin, den Namen darf ich euch natürlich nicht nennen, war etwas von eurem gemeinen Vorhaben zu Ohren gekommen, fragt mich nicht wie. Der mögliche Verrat wurde seinerseits zum Glück verraten, und die Alarmsignale standen auf Rot. Gott sei‘s gedankt!
So, Kinners, wir müssen eilen. Wir haben schnellsten eine Lösung für die Sicherheit Arons zu finden.
Ich kann euch nur raten, sofort Kapitän Rasmussen aufzusuchen. Vielleicht vermag er noch Hilfe zu leisten. Lieber heiliger Gott, beschütze uns. Amen!“
5
Tatsächlich wusste der alte Ozeanüberquerer Rat und vermochte noch, wenn auch spät, den für Aron eigentlich längst vorgesehenen Platz im „Seenotrettungsboot“ zuzuweisen. Womöglich durch Gottes Beistand. Denn warum bewegte sich heute am 8. November die Hasswelle von Hersfeld nicht weiter ins umliegende Land bis hinein in die kleinsten Dörfer? Wir wissen es mal wieder nicht.
Zeit war also gewonnen, und die reichsweite Katastrophe wütete erst oder aber dennoch am folgenden Tag, am 9. November, der Reichspogromnacht – oder im Volksmund verharmlosend Reichskristallnacht genannt.
Wir wissen, welche unglaublichen Schrecken und nachfolgende Leiden sie verursachte als unmittelbarer Vorläufer des Holocausts nicht nur aber auch im kleinen Dorf Rhina. Wer kann das Ausmaß dieses Unheils wohl jemals fassen?!
Berichtete ich anfangs nicht, dass sich das utopische Wunder von Anderort in der realen Ansiedlung Buchenwald wiederholte? Gewiss …
Zu ergänzen ist in diesem Zusammenhang nämlich die Kunde, dass sich solch unglaubliches Geschehnis der Verschwesterung und Verbrüderung von weit größerem Ausmaß als an zwei kleinen Orten in Deutschland ereigneten, nämlich in einem ganzen Land, einer kleinen Nation im Norden Europas, in Dänemark.
Bevor die deutsche Wehrmacht samt SA, Waffen-SS, SS und Gestapo im Gepäck unser nördlichstes Nachbarland am 9. April 1940 im Schnellschritt eroberte und besetzte, hatte sich längst der greise weise Kapitän Rasmussen mit seiner Tochter Kirsten und Enkelin Bente in die alte Heimat aufgemacht, um von seiner Geburtsstadt Slagelse auf Seeland aus die Verschiffung der dänischen jüdischen und ziganen Bevölkerung mitzuorganisieren. Auch und gerade dank seiner aus praktischen Erfahrungen erwachsenen Taktiken und Strategien konnte der Großteil der vom Tode bedrohten Menschen ins sichere neutrale Schweden verbracht werden.
Dass der getaufte Christ Rasmussen selbst abstammte aus einer Sippe der verfolgten Roma – wie somit seine Tochter und Enkelin -, hatte nie jemand außer seiner lieben Ehefrau erfahren, weder jemand sonst in Anderort noch in Dänemark – ausgenommen natürlich seine Vorfahren.
Er starb in den frühen 50er Jahren einen friedlichen Tod in den Armen abwechselnd mal von Kirsten, mal von Bente – mit sich und den Seinen im Reinen.
Wie hatte er doch seine Verdienste um das Menschenheil anlässlich seines 90sten Geburtstages genannt? „Och, Kinners, alles doch bloß Taktik!“
Ist ein solches Märchen nicht wert, auch zweimal gelesen zu werden, würde wiederum d e r deutsche Anekdotenerzähler Johan Peter Hebel gefragt haben.
Damals in Zeiten, als viele Menschen noch gelesen und ans Wünschen geglaubt hatten.
Reisen ins Verlassenwerden und Verlassen. Und ins Vergessen?
Im Alter von 15 bis 16 Monaten etwa glaubte ich schmerzhaft, von Mutter und Vater verlassen worden zu sein.
Mit angebrochenem Schädel wurde ich von einer Spielplatzschaukel eiligst in eine Kinderklinik verbracht, wo man damals tatsächlich noch mit höchster Sicherheit meinte, dass der Heilungsprozess verkürzt und beschleunigt werde, wenn man Mütter und Väter von uns fernhielt.
Als ich im Alter von 15 Jahren von einer Klassenfahrt heimkehrte, fand ich – trotz Absprache - meine Mutter nicht vor. Vater war letztes Jahr verstorben.
Nach langem Klingeln saß ich viele Stunden traurig und vereinsamt vor der Haustür.
Es musste ihr etwas zugestoßen sein!
Als mein Bangen ins Unermessliche zu steigen schien, hatte ich eine zündende Idee.
Meine Tante und mein Onkel wohnten ja auch in der Stadt, in die wir vor kurzem hingezogen waren.
Mit beklommenem Herzen und feuchten Augen stand ich vor der Tür.
Schon nach dem ersten Läuten öffneten sie alsbald und schauten mir voller Betroffenheit in mein nach Hilfe rufendes Gesicht.
„Aber Junge, was ist denn bloß passiert?“
Sie zogen mich zu sich hinein, wollten mich sogleich mit allerlei Köstlichkeiten in Speis und Trank sehr liebevoll beruhigen. Aufgebracht wie ich war, wollte ich zunächst erzählen, was ich soeben erlebt hatte.
Immer wieder warfen sie kopfschüttelnd und schallend die Hände zusammen aus Kummer und tiefstempfundenem Mitgefühl, aber auch aus Verzweiflung darüber, dass sie mir nicht recht zu helfen wussten.
Schließlich versuchte mein lieber Patenonkel, mich zu trösten, vielleicht sogar ein wenig aufzumuntern, indem er murmelnd flüsterte: „Ja, du mein armer und noch so junger Neffe, manchmal ist das Leben wie eine Hühnerleiter. Einfach nur beschissen!“
Doch weder ihm noch mir gelang es, dem ach so leidenden Jungen ein wenn auch noch so kleines Lächeln abzuringen.
Wo meine Mutter sich derweil aufgehalten hatte – und wieso, weshalb, warum, habe ich sie seltsamerweise zu ihren Lebzeiten nie befragt.
Wieso, weshalb warum sie ihr Geheimnis ungelüftet mit hineinnahm in ihr kühles Grab, das habe ich vergessen.
Wenn einer eine Reise tut, dann hat er was zu erzählen
Rosanna und Robert hatten es sich nach Feierabend auf der Terrasse bei einem Glas Rotwein gemütlich gemacht. Rosanna leitete eine große Tourismusfirma, und Robert arbeitete als Realschullehrer. Nächste Woche begannen die Sommerferien, und beide freuten sich seit Tagen darauf, mal wieder auf einer ihrer Lieblingsinseln Urlaub zu machen: Gotland, Bornholm oder Elba.
Beide bekannten sich dazu, eingefleischte Zentraleuropäer zu sein. Mit anderen Worten: sie hatten ihren Kontinent noch nie verlassen – weniger aus politischen Gründen, vielmehr wegen der klimatischen Bedingungen – aber a u c h aus politischen.
Rosanna und Robert waren von der 68er-Bewegung sozialisiert worden. Beide fühlten sich keiner extremen Seite nah, sondern neigten zu gemäßigten Positionen, denen sie noch heute mit gutem Gewissen anhingen.
Heute morgen hatte es in Rosannas Büro eine große Überraschung gegeben: Die Sektkorken knallten, und der Hauptpreis des diesjährigen Großpreisausschreibens der Firma ging ausgerechnet an die Leiterin der Filiale - der Gewinn - nicht mehr aber auch nicht weniger als eine komplette Weltreise all inclusive!!
Freude wollte in Rosanna nicht so recht aufkommen. Drohte der große Glückswurf womöglich überwiegend aus politischen Gründen zur halben Niete zu mutieren?
Sie saß etwas zerknirscht in ihrem Sessel, während sich der hocherfreute Robert alle Mühe gab, seine Frau aufzuheitern und vor touristischen Kompromissvorschlägen nur so zu sprühen.
Die beiden gerieten in eine unvermeidliche kontroverse Unterhaltung, keineswegs gab es richtigen Streit, denn dafür hatten sich die beiden viel zu gern, die bereits als junge studentische Rucksacktouristen hochverliebt durch Skandinavien getrampt waren. Wir hören mal rein in den Meinungsaustausch.
Robert: „Schatz, kannst du dir vorstellen, dass wir uns zumindest teilweise mal auf die rein touristischen Highlights in dem einen oder anderen Land konzentrieren? Ich hätte große Lust, mit dir auf einer Harley-Davidson über die Route 66 zu touren oder voller Ehrfurcht vor der Oktoberrevolution das Winterpalais in St. Petersburg zu besichtigen.“
Rosanna: „Nach Russland und in die USA zieht mich so gar nichts hin, nein.
Wie gerne wäre ich dereinst in die Tschechoslowakei gereist oder nach Chile, um hautnah zu erleben, wie Allendes Revolution oder der Prager Frühling große Menschheitshoffnungen gegenüber gelebter Realität habe gedeihen lassen, den Glauben fest verankert in Menschlichkeit in einer Freiheit, welche auch die Unverletzlichkeit der Andersdenkenden garantiert!
Unter russischen und US-amerikanischen Panzern wurden solche Träumer über Nacht zermalmt – samt deren Angehörige – sowie sie nicht in zappendusteren Verliesen oder flutlichthellen Stadien zu Tode gefoltert wurden.
Denn der sogenannte real existierende Sozialismus und der kapitalistische Wirtschaftsliberalismus hatten gefälligst alternativlos zu bleiben! Aber das weißt du ja alles.“
Robert: „Dem habe ich auch herzlich wenig entgegenzusetzen. Du hast wohl wie meistens Recht. Meinen Schülerinnen und Schülern würde ich vermutlich die Geschichte in deinem Sinne folgendermaßen weitererzählen: Nach Ende des Ost-West-Konflikts schien der sogenannte Kommunismus – weil augenscheinlich fest verbunden mit Gulags, Mauer und Schießbefehl für alle Zeiten diskreditiert.
Im Unterschied zum Kapitalismus, der nur bedingt mit Schreckensherrschaften wie dem Faschismus in Deutschland, Italien und Japan, in Portugal und Spanien bis in die 80er Jahre und erneut in der Türkei und Griechenland in Verbindung gebracht wurde, konnte er doch bis in die Gegenwart als reformierbar, zumindest als bereit, von vermeintlich oder tatsächlich erschrockenen Politikern sich zügeln zu lassen.“
Rosanna: „Ich weiß nicht so genau, Robert. Zeigt sich heute nicht doch eher das Gegenteil?
Politiker werden gegängelt von freiagierenden Finanzmärkten zum Preis einer nie dagewesenen Umverteilung der Einkommen von unten nach oben. Der soziale Friede scheint weltweit gefährdet, ohne dass Spielarten von Sozialismus oder Kommunismus einen Ausweg böten – nirgendwo in der Welt in praktikabler Form.
Und Kuba, China, geschweige denn Nordkorea bestätigen die Gewissheit, dass es auch im Brennkessel der Welt, im Nahostkonflikt, bis auf weiteres keinen Ausweg geben wird – mit aller Gewissheit.“
Robert: „Du bringst mich als alten Pauker auf eine blendende Idee. Vielleicht wäre heute, wo Kinder und Jugendliche die Schule schwänzen, um Freitags auf die Straße zu gehen, die Lösung aus dem Dilemma so schwierig nicht: Ein hochdotierter Preis müsste ausgelobt werden für die Gewinner des Wettbewerbes ,Jugend forscht‘!
Erforscht werden müssten in Deutschland und/oder auch in anderen Ländern für ein Jahr ausnahmsweise nicht der Bereich der Natur-, sondern der der Sozialwissenschaften – konkret mit der Aufgabe, Gesellschaftsmodelle zu entdecken oder zu erdenken, die den Frieden der Menschen untereinander aufrechtzuerhalten im Stande sind und die Wohl und Gedeih aller Erdenbürger samt der Natur nachhaltig zu fördern und zu sichern helfen und sich in gründlichst-strengen Praxistests zu bewähren versprechen.
Einzige Voraussetzungen solcher Modellversuche: das offensichtlich Üble von Kommunismus und Kapitalismus müssen ohne wenn und aber ausgeschlossen bleiben: Die Verringerung jeglicher Freiheit der Menschen durch den Willkürstaat sowie die hemmungslose Ausbeutung der Menschen zwecks Maximierung der Gewinne um jeden Preis durch die Finanzmärkte insbesondere also.
Das Gute jedoch beider Ideologien im Ansatz, nämlich das Anreizprinzip einerseits, das Ausgleichs- bzw. das gerechte Umverteilungsprinzip andererseits dürfte zur Prämisse des Unternehmens werden.“
Rosanna: „Mensch Klasse, dein Anreizsystem, mein Liebling! Komm, gieß mir noch ein Glas ein.
Die Gold-, Silber- und Bronzemedaillen gehen - vermutlich – an Jugendliche in Griechenland, Portugal oder Spanien und die USA. Da dort eine besonders hohe Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen zu beklagen ist – natürlich!
So ist nämlich dort die Motivation zu forschen wahrscheinlich am höchsten.“
Robert: „Der Gewinn der Preise würde die Siegerinnen und Sieger persönlich belohnen, aber auch als Angehörige einer Generation der Hoffnung: der Erhalt der Berufs- bzw. der Erwerbsfähigkeit werden sich für sie als plausible Auswege aus Weltkrisen erweisen – und die von Tausenden anderer Mitstreiter ebenfalls. Und jetzt gieß du mir noch ein Glas ein.“
Inzwischen hatten die beiden eine zweite Flasche Wein angebrochen und angefangen, sich g e m e i s a m auf die Weltreise zu freuen. Gotland, Bornholm und Elba wurden in den Bereich der angenehmen Erinnerungen verschoben.
Beim Inselhopping sollte es gleichwohl bleiben. Das Schachbrett wurde hervorgezogen, und wer siegte, durfte eine Insel benennen oder zumindest vorschlagen: Sansibar – wunderbar! Sri Lanka, na klar! Borneo, jo, jo!
Zuletzt gewinnt Robert noch einmal: „Kuba!“. Rosanna: „Einspruch, Euer Ehren!“
Und dann fielen beiden recht bald die Augen zu.
Wer bin ich?
Und wenn nein, warum nur der Gekreuzigten so viele?
Ich, das ist relativ.
Ich, das ist multiple.
Einer der vielen Götter sein zu müssen, fürchtete ich oftmals als junger Mann, der womöglich grausamste überhaupt, der des Alten Testaments, der das eine Volk empfangen und gesegnet hatte, um dieses eine gnädig auserwählte Volk andere in Ungnade gefallene Völker kollektiv ausrotten lassen zu dürfen, und zwar bis ins letzte Glied.
Seine Nachfahren darin, tierischer als die Tiere zu sein, unter ihnen Hitler, Stalin, Mao. Pol Pott (ach, wer zählt all die Verbrecher bis heute!?) - war diese unsagbare Mit-Stumpf-und Stiel-Ausrottungsgründlichkeit auch nie ganz gelungen – humaner Mensch sei Dank ;-)!
Ich bin nicht Stiller, die berühmten Romanfigur Max Frischs, die sich kein Bildnis von sich und anderen Menschen machen soll. Ganz im Gegenteil: mich und mein Persönlichkeitsprofil so weit wie möglich eigenständig zu erkennen - wenn auch noch dunkel wie in einem Spiegel - ist mir seit langem Lebenselixier.
Endlich Heilung zu bringen in mein unheiliges Gemetzel und das der Welt – sind es vielleicht Jesus und seine viele Frauen, die dies mit ihrem Glauben und Handeln schaffen?
Die eine oder andere wird er geehelicht haben, seine getreuen Apostolinnen, die ihren Messias unermüdlich darum gebeten haben, ihrer Lebensbahn voranzugehen. Unter ihnen seine geliebte Mutter Maria natürlich und deren Schwester Maria Magdalena. Sie alle waren es nämlich, die ihn Empathie lehrten, denn wir Männer haben nun einmal keine oder kaum emotionale Intelligenz von Geburt an; wir müssen sie von den Frauen in unserem Leben erst beigebracht bekommen.
Jesus hatte von ihnen also erfahren, was tiefes Mitleiden und Barmherzigkeit bedeuten.
Wurde er womöglich wegen seines offensichtlichen Höchstmaßes an Einfühlungsvermögen als männlicher Außenseiter, als weibische Memme, als zu nichts Nutze Karikatur eines wehrhaften Mannes ans Kreuz geschlagen?
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“
Warum sollte sein vermeintlicher Vater es anders sehen als das Männerstrafgericht im lupenreinen Patriarchat des heiligen römischen Reiches?
Wer bin ich?
Allzu viel weiß ich bis heute immer noch nicht über mich.
Doch eines ist mir gewiss: Ich bin ein Mensch, der sich entscheiden darf zwischen Jesus Menschensohn und einer Welt, in der Väter glaubten, mit ihren Kindern nicht reden zu müssen.
The long, long way home …
1
In Schleswig-Holstein gibt es den Ort England gleich zwei Mal. New York immerhin einmal in Deutschland, und zwar in Osthessen.
Und dort wuchs Phil auf, der eigentlich Hans-Peter hieß.
Das kleine und das große New York haben neben der Namensgebung eine seltene Gemeinsamkeit: die Straßen werden nicht nach mehr oder weniger bekannten, manchmal längst in Ungnade gefallenen Männern wie Carl (Hänge-)Peters benannt, nach Pflanzen oder anderen Ortschaften, sondern schlicht und einfach nach Zahlen.
Phil wohnte mit seinen Eltern und seinem drei Jahre älteren Bruder Rüdiger, besser bekannt als Jerry, in der Straße Nr. 131.
Jerry war ein begeisterter Konsument von Heftchenliteratur, die es nicht in Buchhandlungen sondern nur am Kiosk zu kaufen gab: heiße Abenteuer aus dem wilden Westen mit ständigen Bedrohungen der braven Siedler durch kriegerische Indianerstämme, Landserhefte, die in immer ziemlich gleichen Geschichten unsere Wehrmachtssoldaten im Nachhinein als die im Grunde guten Kämpfer zur Verteidigung ihrer Heimat heroisierten – und am liebsten von allen las er die im ostamerikanischen New York spielenden Jerry-Cotton-Kriminalromane.
Phil war vielleicht sieben oder acht Jahre alt, als Jerry damit begann, seinem kleinen Bruder Abend für Abend von seiner stets brandneuen Jerry-Cotton-Lektüre zu berichten. Jerry wusste so spannend von den Einsätzen der beiden Freunde, Jerry Cotton eben und Phil Decker, gegen das Böse zu berichten, dass der kleine Junge jedes mal heiße Ohren bekam.
Das, was sich vor seinem inneren Auge abzeichnete, das waren zwei Filmebenen: auf der einen die konkreten Einsätze der beiden FBI-Agenten gegen das organisierte Verbrechen, Drogen- und Waffenschmuggel, Bandenkämpfe, Einbruchdiebstähle, Geiselnahme, Vergewaltigungen u. v. a.
Die zweite Ebene wurde Phil bald zur zweiten Heimat: Die Geografie der Weltstadt und ihre Infrastruktur mit ihren auch aus dem Fernsehen bekannten Vierteln wie Eastside, Westside. Manhattan, New York City, die Bronx, Brooklyn, Harlem, das Ghetto der Schwarzen usw.
Bald hatte er die Struktur der Stadt fest im Bild mit all den Straßen, die er nach jeder allabendlicher Erzählung immer besser den Stadtteilen zuzuordnen wusste. Im Osten seines Dorfes gab es eine kleine Sintisiedlung – was lag da näher, als sie mit Harlem zu benennen.
2
Nach zwei, drei Jahren war plötzlich Schluss mit New-York-Geschichten-Erzählen vor dem Einschlafen. Jerry hatte das Genre gewechselt, nachdem er zur Konfirmation drei Karl-May-Bände geschenkt bekommen hatte.
Phil erbte Jerrys ansehnlichen Jerry-Cotton-Stapel, machte aus der Not eine Tugend und begann damit, Heft für Heft noch einmal selbst zu lesen, was wie nebenbei dazu führte, dass sich seine Schulnote im Schreiben und Lesen deutlich verbesserte.
Später besuchte Phil die Realschule. Die Jerry-Cotten-Hefte gehörten längst nicht mehr zu seiner Standartlektüre. Er hatte die Welt von Jerry Cotten und Phil Decker schlicht und einfach verinnerlicht. Mit einem weiteren Vorteil im Hinblick auf seine schulischen Leistungen. Englisch war längst zu seinem Lieblingsfach geworden, und im 6. Schuljahr begann er damit, ganze Passagen aus der Krimireihe ins Englische zu übertragen – von uppercut zu uppercut sozusagen.
Ab dem 9. Schuljahr beteiligte er sich an einer Englisch-AG, in der amerikanische Dramen behandelt wurden: Thornton Wilders „Our town“, Eugene O‘Neils „A Long voyage throug the night“, Tennessee Williams „A Streetcar named desire“ und – sein absolutes Lieblingsstück: Arthur Millers „Death of a Salesman“. Alles Stücke im übrigen, die ihre Erstaufführung am Broadway erlebt hatten. Dieses Theater mit seinen Programmen begeisterte ihn so sehr, dass er sich sein erstes Buch in Englisch kaufte: „The history of Broadway“.
Besonders spannend darin fand er die Darstellung der 30er und 40er, als der junge Bühnen- und Hörfunkregisseur Orson Welles, das spätere Filmgenie, dort nach der Weltwirtschaftskrise seine höchst gesellschaftskritischen Stücke inszenierte hatte.
Nach Abschluss mit der Note „sehr gut“ absolvierte er eine Lehre als Bankkaufmann in einer näheren Stadt. Auch hier war das Abschlusszeugnis derart ausgezeichnet, das seine Chefs gerne seinem Wunsch nachkamen, ihm allerbeste Referenzen auszustellen für eine Bewerbung an einer Bank oder Börse in den USA oder vorzugsweise in New York.
3
Phil hatte schnell Karriere als Börsenmakler in einem renommierten Brokerhaus gemacht.
Der Job war einfach, aber höchst aufreibend. Er hatte aus einem Dollar in Windeseile zwei oder drei zu zaubern, ohne dass diese zwei oder drei Doller irgendwie durch reale Arbeit gegenfinanziert werden mussten, d. h., sie hatten sich auf dem Parkett summiert durch reine Spekulation.
Nach einem Zehn-Stunden-Tag und dem regelmäßigen Konsum zweier Kannen Kaffee fiel Phil in seiner mondän ausgestatteten Suite in der Nähe des wiederaufgebauten Tradecenters wie ein Klotz ins Bett.
Die Wohnung hatte Stil, war aber äußerst karg eingerichtet: ein Schallplattenapparat von Bang & Oluffson gehörte dazu wie ein Blu-ray-Player von Sony und zwei Buchstützen aus edlem Marmor. Dem entsprach ein Minimum an Software: auf dem Plattenspieler lag seit Jahren verstaubt sein Lieblingsmusical, Leonard Bernsteins „Westside Story“, im DVD-Player steckte Woody Allens „Manhattan“, und vom schweren Gestein leidlich eingeklemmt wurde Paul Austers New-York-Trilogie samt Grafic-Novel-Fassung.
Die Musik hatte er sich einmal vor Jahrzehnten zu Gehör gebracht in perfekten High-Fidelity-Klang. Woody Allens Kultfilm hatte er bis zur Hälfte anzuschauen geschafft, bevor ihm die Augen zufielen. Und von der „New-York-Trilogie“ hatte er nicht eine Zeile zu lesen vermocht.
Nicht dass das Anhören, Ansehen, Lesen der einzigen Software in seinem Hause nicht zu seiner täglichen Agenda gehörte, seit Jahren, seit Jahrzehnten, indes: sein Beruf verhinderte stets die Umsetzung des lang gehegten Vorhabens. Tatsächlich? Tatsächlich oder vorgeblich?
Über kaum ein literarisches Werk hatte Phil so viel gelesen wie über Austers Meistertrilogie - „seine“ Stadt betreffend. Seitdem beschlich ihn das Gefühl, dass die Lektüre ihn aus der beruflichen Bahn hätte werfen können angesichts der behaupteten oder der tatsächlich zu erwartenden einfühlsamen Entfaltung alternativer Lebensentwürfe.
Was hätte er denn machen sollen? Einfach kündigen und stattdessen ein Antiquariat erwerben in New Yorks Bücherquartier?
4
Nach 40 Jahren wurde Phil pensioniert. Da war er ergraut und 70 Jahre alt.
Die ersten Tage und Nächte in der Freiheit verbrachte er im Tiefschlaf. Wenn er plötzlich hellwach im Bett saß und Herzklopfen bekam, half er seinen noch unbekannten Wehwehchen mit einer Flasche Tullamore Whiskey ab.
Nach Wochen verließ er die Wohnung, um erstmals im Leben „seine“ 81. Straße auf- und abzuschschreiten. Es war Winter, und es hatte geschneit. Im Abstand von 30 bis 50 Metern hatten sich Obdachlose vor den Hauswänden unter Plastikplanen platziert – zumeist Männer.
Er passierte einen Lebensmittelladen, vor dem ein Menge offensichtlich unverkäuflicher Ware aufgehäuft wurde. Eine Gruppe von etwa einem Dutzend junger Leute, die Joggingjacken trugen mit der Aufschrift „Food for everybody“, begann damit, Salatköpfe, Bananen, Hähnchenkeulen, Garnelen u. a. in ihren großen Sporttaschen zu verstauen. Polizeifahrzeuge mit Blaulicht und Sirenengeheul näherten sich rasch den Aktivisten. Männer wie Frauen wurden im Polizeigriff in die Einsatzfahrzeuge verfrachtet - wie Schwerstverbrecher.
Verwundert schaute sich Phil die eine oder andere Packung vom Abfall an, um das Verfallsdatum zu überprüfen. Nicht einmal stieß er auf abgelaufene Ware. Und hieß der Zugriff der Ordnungshüter etwa, dass womöglich die Händler a l l e i n i g e Besitzer ihrer Ware blieben von der Theke bis zur Müllhalde?
Was nur was hätten Jerry Cotton und Phil Decker dazu gesagt?
Das neue Zeitalter ohne Arbeit, von früh bis spät eingepfercht in einen goldenen Käfig, in dem es nicht einmal einen singenden Kanarienvogel gab, ödete ihn, ja kotze ihn zu zuletzt nur noch an.
Abends verfolgte er auf seinem Laptop eher gedankenlos die Nachrichten. Nur eine einzige weckte ihn aus seinem Dauerhalbschlaf: „In England ist heute ein neues Ministerium eingerichtet worden, und zwar eines gegen die Einsamkeit.“
5
Am nächsten Tag hatte Phil ein Flugticket geordert nach Frankfurt und war von dort mit dem Zug nach Waldhagen gefahren, dem Bahnhof, der nur zwei Kilometer von Klein-New-York entfernt lag, der Hauptort der Großgemeinde Kirchrode mit Rathaus und kleinem Hotel.
Er quartierte sich dort für einige Tage ein, um die üblichen bürokratischen Notwendigkeiten zu erledigen und sich nach dem Wohnungsmarkt im hiesigen New York zu erkundigen.
Auf der Gemeindebehörde kannte ihn niemand mehr, aber wie hocherfreut war man auf dem Amt, einen alten New Yorker wieder in der ach so schönen Heimat begrüßen zu dürfen. Und gerne würde man seinem Wunsch nachkommen, ihm Exposés von zum Vermieten oder Verkauf angebotenen Wohnungen und Häusern zu unterbreiten.
Phil hatte sich schnell entschlossen. Ein kleines altes Fachwerkhaus in der 11. Straße direkt neben der Kirche, in der er vor 55 Jahren eingesegnet worden war, hatte es ihm angetan, zumal er alles vom Keller bis zum Boden bestens renoviert und einzugsfertig vorfand.
Das eigentliche Herz des Hauses bildetet ein großzügiger Kaminkachelofen, der sich als derart effektiv erwies, dass er mit nur wenigen Buchenscheiten die gesamte Wohnung angenehm zu erwärmen vermochte. Mit nur wenigen Möbeln aus der Region richtete er es sich behaglich ein und hörte dabei all die Musik, deren Wohlklang zu lauschen, nie wieder auf den St. Nimmerleinstag verschoben werden sollte.
Drei Tage bewohnte er jetzt seine neue Bleibe, zumeist wie eine schnurrende Katze in das knisternde Feuer schauend, als es an der Tür klingelte. Vor ihm stand eine attraktive Frau, etwa Mitte 30 Jahre alt.
„Guten Tag, Herr Frings. Mein Name ist Franziska Trede. Ich bin die Pastorin der Pfarrstelle hier und der Nachbargemeinde Waldhagen und möchte Sie bei uns sehr herzlich mit Brot und Salz begrüßen.“
Hocherfreut bat er sie herein und bewirtete sie sogleich wunschgemäß mit Tee und Gebäck.
Franziska Trede berichtet so lebendig über die Aufs und Abs in ihrer Berufslaufbahn, dass er glaubte, die eine oder andere Übereinstimmung mit seinem durchaus nicht nur unkritisch zu betrachtenden Lebensweg entdecken zu können.
Sie war lange Jahre an der Universität als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig gewesen, viel zu lange, wie sie betonte. Sie hätte sich nach Gemeindearbeit gesehnt, und vor zwei Jahren sei ihr Wunsch weitgehend in Erfüllung getreten.
Jetzt habe sie ein Dreiviertelstelle, die allein von der Kirche finanziert werde. Eine reduzierte Stelle auf eigenen Wunsch? wollte Phil wissen.
„Die Kirchensteuer fließt nicht mehr so, wie vor Jahrzehnten noch, wissen Sie. Und wir haben einen guten Kompromiss gefunden, den man einen brüderlichen-schwesterlichen Glücksfall nennen könnte.
Meine Berufstätigkeit beruht auf vier Säulen, die mir meine Lebensgrundlage auf Dauer und in hinreichendem Maße sichern hilft und mich unter die Leute bringen lässt in einer von mir nie erträumten Vielfalt der Begegnungen.
Aber fangen wir vorne an – die erste Säule: ich arbeite als Klinikseelsorgerin im Kreiskrankenhaus.
Säule zwei und drei wie gesagt Gemeindearbeit hier und drüben.
Säule vier ist und bleibt für mich ein Zauberwerk. Die beiden Dorfbevölkerungen haben mit der Kirche und meiner Wenigkeit eine einvernehmliche Lösung gefunden: das Geld für Säule 4 wird zumindest zu einem Großteil aufgebracht durch Einnahmen, die gemeinsame Dorffeste erbringen, Feste und Veranstaltungen der zahlreichen Vereine, von den Sport- und Wandervereinen, über die freiwillige Feuerwehr bis hin zu den Kirmesburschen und - mädels.“
Manchmal treffen wir uns nach dem Gottesdienst auch unten in der kleinen Kirchengrotte zu einem Weinfest. Kaum zu glauben, wie viele Leute immer auf einen Schoppen und Plausch vorbeikommen. Solche fürsorglichen Dorfgemeinschaften hatte ich vor meinem Theologiestudium und meiner Assistentenstelle an der Uni natürlich nie erlebt.“
„Wie ist es nur möglich, aus der Not solche Tugend zu machen!“ Phil klatsche in die Hände und rief begeistert: „Welch wunderbare Win-Win-Situation!“
„Ich lade dich“ - inzwischen war man beim Du angelangt -“sehr herzlich am kommenden Sonntag zu unserem Gottesdienst mit anschließendem Flohmarkt und Grillfest hier an der Kirche dir gegenüber ein.“
Am nächsten Tag schickte sich der Neu-Alt-Bürger an, einen Kubikmeter Buchenholz aus einer Palette vor der Garage in Bananenkartons hinter das Haus unter das Dach der Loggia zu tragen. Nachbarn boten an zu helfen.
Mit jüngeren gab es ein nette neue Bekanntschaft, mit älteren ein zum Teil tränenreiches Wiedersehen.
6
Die kleine zweistöckige Kirche aus dem frühen 18. Jahrhundert war bis auf den letzten Platz besetzt.
Nach dem Eingangslied sprangen urplötzlich Franziska mit ihren Konfirmandinnen und Konfirmanden aus der Kulisse - und die Pfarrerin im Pippi-Langstrumpf-Kostüm – , um unter all den Bänken Pippis Lieblingssuchobjekt, dem Spunk, nachzuspüren, denn es galt, auf witzige Weise in das Thema dieses dritten Sonntagsgottesdiestes nach Trinitatis einzuleiten: Suchen-und finden-Ritual.
In ihrer Predigt gelang es Franziska, einen spannenden Bogen von den Psalmen Davids über das Gleichnis vom verlorenen Sohn bis zu unseren heutigen Formen alltäglichen, sehnsüchtigen - vielleicht sogar bislang noch verborgenen? - Suchens und Findens zu schlagen.
Drei auserwählte Paare dreier Generationen erzählten unaufgeregt, wonach sie in ihrem Leben gesucht und was sie mit großem Glück gefunden hatten: den richtigen Beruf, Gesundheit, zumeist aber die*den richtige*n Lebenspartner*in und fröhliche Kinder.
Gerne hätte sich Phil dazugestellt, aber plötzlich verschlug es ihm die Stimme, als ihm bewusst wurde, dass die neuen Eindrücke von einem wiedergewonnenen Zuhause noch viel zu frisch waren, um ein Wort darüber zu verlieren. Viel Größeres war es womöglich noch, das ihn dazu veranlasste, sich einfach still und leise wie ein getretener Hund in der Bankecke zusammenzukauern: Suchen und finden, das war nicht mehr und nicht weniger sein Lebensthema – beständig durchzogen von Fremdbestimmungen, Versagen, Mutlosigkeit, schwersten Fehlentscheidungen.
Zum Flohmarkt trug er einige filigrane Porzellanpreziosen aus dem alten Hausbestand bei sowie seine gesamte Jerry-Cotton-Sammlung – das Stück zu 10 Cent. Nach Ende der Veranstaltung war der kleine Stapel tatsächlich verschwunden.
Das anschließende Grillfest und die große Waldwanderung am übernächsten Sonntag durch Mischwald und über Feld und Wiesen von Kirchlein zu Kirchlein gaben reichlich Gelegenheit zu weiteren Bekanntschaften mit Nachbarn aus nächster Nähe wie näherer Ferne, z u reichlich vielleicht, wie er befürchten musste.
So froh er auch war über das ihm eher überraschend zugewachsene hohe Maß an mitmenschlicher dörflicher Gemeinschaft, der fast lebenslange Groß-New-Yorker lonesome Cowboy fühlte sich indes so manches mal überfordert, so dass er damit begann, einen für ihn passenden Rhythmus von Zuwendung und … nein n i c h t Abwendung, sondern Pausen von Zuwendung zu finden. (Am kürzesten, was die Abstände betrifft, gewiss gegenüber der ohnehin vielbeschäftigten unverheirateten Franziska, in die sich vermutlich bereits die gesamte männliche Bevölkerung von New York und Waldhagen verliebt hatte ;-!).
Die ganztägige Begegnung mit Baron von Fürstenberg, dem Besitzer der Waldungen in und um die beiden Kirchengemeinden führte zu einer Art der näheren Bekanntschaft, wie sie Phil so nie in den Sinn gekommen wäre.
Der Baron, selbst ein passionierter Förster, gab höchst kompetent Auskunft über den üblen Zustand der Wälder. Phil wich lange nicht von seiner Seite, weil er eine für ihn ganz andere Vorstellung von der Rettung der Wälder vertrat als sie gerade in Mode waren. Phil hatte auf der Eisenbahnfahrt von Frankfurt nach Waldhagen das Buch eines Försters gelesen, der mit Bäumen und anderen Pflanzen sowie Tieren tatsächlich oder angeblich zu sprechen vermag.
Phil war recht angetan von dieser Sichtweise. Er vermochte sie zwar nicht so recht rational nachvollziehen, sie entsprach aber seinem tiefen emotionalen Bedürfnis, dass die allzu disparate Welt ein wenig näher zusammenrücken möge.
Baron von Fürstenberg wiederum verachtete die Humanisierung des Waldes und vertrat die Auffassung, dass ein Wald wie seit 300 Jahren lediglich drei Funktionen zu erfüllen habe: Lebensgemeinschaft zu sein, Erholungsraum und Wirtschaftsareal.
Sein Sohn gebe die „Schloss-Fürstenberg- Zeitung“ heraus, in der gerade über den Waldstreit ausführlich berichtet werde. Wenn Phil ihm seine e-mail-Adresse gebe, werde er ihm das Blatt zukommen lassen. Natürlich sei er auch eingeladen, selbst Artikel beizutragen – ob in sachlicher oder poetischer Form sei ganz egal.
Wie herrlich die Pilze, der Waldboden die Bäume doch rochen. Sachtexte zu verfassen zur Thematik, er, der Sonntags zumeist immer nur im Centralpark zu flanieren vermochte, dazu fühlte er sich nun wirklich nicht berufen.
Aber schon als Kind liebte er Bäume, als seien sie gute Freunde des Menschen.
Plötzlich bekam er große Lust, über Bäume zu schreiben für die Schloss-Zeitschrift … kleine, große, aller Art… und zwar in Gedichtform.
Im Verlauf seiner Teilnahme an der Englisch-AG hatte er den Wunsch verspürt, nicht nur Dramen zu lesen, sondern dazu angehalten werden, welche – und wenn es noch so kleine gewesen wären – selbst abzufassen. Hätte er statt Noten in Mathematik, Wirtschaft und Englisch auch ein Zertifikat für praktische Literatur (er war voller Ideen) erhalten, wäre er womöglich Schriftsteller geworden?
Den Lehrer*innen konnte er keine Vorwürfe machen, denn es wäre allein seine Entscheidung gewesen zu schreiben. Jerry-Cotten-Texte zu übersetzen hatte ja auch keines Anstoßen von oben oder außen bedurft.
Im nächsten Augenblick war ihm nicht länger zumute, über verpasste Lebenschancen zu räsonieren. Er nahm sein Notitzbuch aus der Jacke und skizzierte Verse über Birken im Schnee, Eichelhäher in der Spitze seiner alten Linde zwischen seinem Haus und der Kirche, sich suhlende Wildschweine mit ihren Frischlingen, eine Ameisenstraße – ach, wollte er sich nicht auf das Thema Bäume beschränken?
Bei einem sonntäglichen Spaziergang trat eine ihm bekannt erscheinende etwa gleichaltrige Frau mit ihrem Hündchen auf ihn zu: „Hallo, ich bin die Bettina. Wir sind zusammen zur Schule und zum Konfirmandenunterricht gegangen.
Ich war sehr verliebt in dich, aber du hattest es, glaube ich, nicht bemerkt.
Der Mann, der mich geheiratet hatte, ist seit langem verstorben, und ich möchte gerne mit dir heute Abend zum Tanz gehen. Im Dörfergemeinschaftshaus findet heute ein Vorfrühlingsfest statt mit zünftiger böhmischer Volksmusik. Hast du Lust?
Du musst mir unbedingt von deiner Zeit in den Staaten erzählen. Weißte, es war auch mein Traum, dort einmal hinzufliegen …“.
7
Wir neigen in unserer kleinen Geschichte vielleicht dazu, das große New York z u schwarzweiß zu sehen und das kleine z u sehr idealisieren zu wollen, was nicht dem Geschmack aller Leser*innen entsprechen mag.
Deswegen könnten wir Bettina und Phil mit gutem Gewissen von 22 Uhr bis zwei Uhr nachts aufs Tanzparkett schicken (was im großen New York hätte ja genauso passieren können) und sie dann nach Hause schleichen zu lassen – todmüde, und jeder fällt in sein eigenes Bettchen.
Andererseits hat sich der Autor einer nachfolgenden Geschichte, „Die Meerjungfrau“, möglicherweise von der Macht des Märchens z u sehr einstimmen lassen. Er geht nachts gegen zwei Uhr noch einmal zurück zur Festhalle.
Bettina und Phil verlassen gerade Hand und Hand das Fest, und er hört ihn sagen:
„Du, ich spüre, das könnte der Beginn einer sehr großen Freundschaft werden!“
Na denn, good luck and good night!