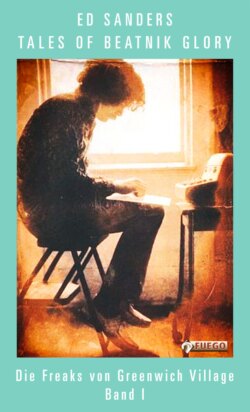Читать книгу Tales of Beatnik Glory, Band I (Deutsche Edition) - Ed Sanders - Страница 7
TOTAL ASSAULT CANTINA
ОглавлениеDa sitze ich nun, im Tal des Jammers, in den Gassen der Verzweiflung und schreibe. Der Keller, in dem ich hause, ist feucht. Im flackernden Kerzenschein sehe ich, wie braun schimmernde Kakerlaken über die Holzbalken kriechen. Mein Bett ist eine Matratze aus Lumpen, die ich in abgewetzte alte Hemden gestopft und zugenäht habe; acht Stück insgesamt, sie erinnern mich immer an Vogelscheuchen. Normalerweise besteht meine Nahrung aus Abfallresten. Aber manchmal gehe ich auch rüber ins Armenhaus und staube da was ab. Wenn ich mich hier beim Schreiben so umschaue, kann ich nichts entdecken, was auch nur einen Schimmer von Hoffnung ausstrahlt. Nur Dreck, nur Gangster, die sich auf Algenfarmen verkriechen und damit die Erde umkreisen, traurige Überbleibsel vergangener Zeiten. Meine Zeitungen beziehe ich gewöhnlich aus der nächsten Mülltonne. Meistens sind sie mit einer schleimigen Schicht oder Eigelbflecken überzogen, und wenn sie trocken sind, strecke ich mich auf dem Fußboden aus, um sie zu lesen. Und alles kotzt mich an. Alles ist so sinnlos. Keine Sprossen mehr auf der weißen Leiter der Reinheit — nur die zwei Pfosten links und rechts sind übrig geblieben, die Sprossen zerschlagen und in alle Winde zerstreut. Und diese Pfosten liegen schwer auf den Schultern der Trauernden, wenn sie die schlaffen Reste enttäuschter Hoffnungen zurückschleppen ins Elend.
Mein Vermieter ist ein verlauster alter Gangster. Gnadenlos erhöht er in regelmäßigen Abständen die Miete für meinen Keller. Ich wünsch ihm nur, dass es ihn eines Tages mitten in der Rush Hour erwischt! Ach was, soll er leben. Was kümmert’s mich. Ist doch eh alles egal. Die Milchstraße bringt’s auch nicht. Und solange die KZ-Scheinwerfer nicht gerade in die Fenster meines feuchten Kellers strahlen, ist mir sowieso alles schnuppe. Grex ist das lateinische Wort für Pöbel. Grex Hex Sex Speck Fleck.
Ich habe mir schon mal ausgemalt, wie es wäre, langsam auseinanderzufallen und mich nur noch kriechend fortzubewegen. Mir vielleicht Rollschuhe unter Arme und Beine zu schnallen und mich mit kleinen Holzpaddeln vom Pflaster abzustoßen. Aber sie würden mich garantiert einkassieren. Jedenfalls wäre das drin. Und ich kann mich noch gut erinnern, was Judith Malina mir schon vor vielen Jahren geraten hat: Machs’ nie allein, sondern such dir immer einen, mit dem du dich zusammentun kannst.
Ich will euch eine Beschreibung meines Kellers geben. Ich habe ihn mir genau eingeprägt und das fotografisch getreue Abbild in der Vorstellung meiner Erinnerung ist so weit von der Realität entfernt, dass ich plötzlich mit Anflügen von Zärtlichkeit darüber erzählen kann. Er ist schmutzig, feucht und strotzt vor Kakerlaken. Die zwei Fensterritzen oben an der Wand zur Straße hin sind sehr schmal und sehen von außen genauso aus wie die kleinen Kanaldeckel aus Metall, die man auf den Bürgersteigen von New York findet. Schwere Füße stampfen über meine Metalltüren. Manchmal stelle ich mich auf einen Stuhl und kann sogar die Beine der Passanten beobachten. Wenn ich es wärmer haben will, brauche ich bloß die Tür vom Heizungskeller aufzumachen und schon erstickt ein heißer Luftstrom alle Kälte. Über den Fußboden gibt es eigentlich nichts zu berichten, außer dass man beim Betonieren offenbar vergessen hat, den Brei richtig platt zu walzen. Er steckt voller Blasen und Höcker, stinkt nach fünfzig Jahren Kohlestaub und hat überall Flecken von den schmierigen Überresten meiner Beutezüge.
Früher galt ich mal als vielversprechender junger Schriftsteller. Die Kritiker pflegten dem Erscheinen meines »neuen Romans« mit Spannung entgegenzusehen. Heute verstauben diese Werke in meinen Kellerregalen. Aber ich hatte ja sowieso nicht viel zu sagen, außer dass ich die Rebellen aufforderte, aus ihren Löchern zu kriechen, sich zu stellen und zu kämpfen. Und nun halten vergammelte, mit Spinnweben überzogene Ringbücher die Seiten meiner Jugend zusammen. Was war es nur? Es war eine bittere Mischung, Brüder und Schwestern. Und die Zeit hilft dir keinen Deut weiter. Hoffnungslose Ruhe. Stille Verzweiflung. Ruhe! Ich schrie, bis sie sich auf die Straße knieten und durch die Ritzen in meinen Keller linsten. Dann lag ich still. Vielleicht wäre es doch besser, in die öffentliche Bibliothek von New York zurückzukehren und die Arbeit an meiner unersetzlichen zehnjährigen Untersuchung über diesen widerlichen Narko-Hypno-Robo-Schwindel unserer Zivilisation wieder aufzunehmen? Ach was, vorbei!
Ich gehe grade meine Aufzeichnungen durch. Und sobald ich sie einigermaßen in Ordnung gebracht habe, suche ich mir eine Universität, die sie annimmt, und dann werde ich vielleicht Gras fressen und auf den Landstraßen von Amerika herumziehen — hier eine Plastikdose mit einem verschimmelten Rest Kartoffelsalat auflesen und dort eine Blechdose mit einem übrig gebliebenen Zwiebelring oder einen kleinen Beutel Tomatenketchup, den jemand vergessen hat. Und dann werden wir tanzen, Brüder und Schwestern, dann erklingen von Neuem die Trompeten und Saxofone.
Eine purpurne Traube glänzt zwischen Daumen und Zeigefinger von Dionysos. Und eine Olive in der Hand von Demeter. Aber was die Faust des Monsters hier auf der Titelseite umklammert, ist das Siegel des Roboterkriegs. Und dieses Monster lässt mich nicht mehr los und verfolgt mich bis in meine Träume.
Da drüben liegt übrigens auch noch ein alter Heuballen, mit einer schwarzen schmierigen Rußschicht überzogen, aber der Packdraht hält ihn immer noch zusammen. Zwölf Jahre liegt das Ding jetzt schon hier rum, genauer gesagt seit 1961. Immer wenn ich mich draufsetze und lesen will, muss ich lachen. Denn er erinnert mich an die Total Assault Cantina und wie wir vor zwölf Jahren eine ganze Ladung Gewehre in den East River geschmissen haben, die eine Bande von rechtsradikalen Kanaken in die USA geschmuggelt hatte. Hahaha. Tja, das waren noch Zeiten.
Also, passt auf, die Kneipe lag genau über dem Keller, in dem ich jetzt wohne, mit anderen Worten auf der Ecke Avenue A und Elfter Straße. Aber fangt jetzt bloß nicht an, hier nach irgendwelchen Resten der Total Assault Cantina zu buddeln, das Gebäude ist nämlich schon vor Jahren völlig ausgebrannt. Als die Kneipe dichtmachte, benutzte die Mafia die Räume ein paar Jahre als Lager für Jukeboxen. Eines Tages ließen sie alles in Flammen aufgehen und kassierten von ihrer Versicherung ein Schweinegeld.
Wir flippten völlig aus an der unverständlichen Freiheit, die die Zivilisation uns in den frühen sechziger Jahren zugestand. LSD lag noch in weiter Ferne, doch schon damals steckten wir voller Energie und Begeisterung. Wir waren wandelndes Mutterkorn. Und keinen hatte es in diesen Tagen so wild gepackt wie die beiden Manager der Total Assault Cantina. Sie hatten einen Riecher für das, was uns fehlte. Sie brannten geradezu darauf, für die sozialistische Revolution zu kämpfen. Sie schlugen die Fäuste auf den Tisch und machten alle möglichen Pläne, wie man den gewaltlosen Kampf am besten unterstützen konnte. Beide waren zu der Zeit Anfang zwanzig und beide waren in New York aufgewachsen. John McBride war ein nervöser drahtiger Bursche mit einem dicken roten Schnurrbart und kurz geschorenem rotbraunen Haar. Paul Stillmann war ruhiger, nachdenklicher; er trug sein Haar nach hinten gekämmt und im Nacken zusammengebunden.
Gemeinsam betrieben John und Paul das Total Assault, ein Nonprofitunternehmen, das sich voll und ganz der Aufgabe verschrieben hatte, wie Piranhas im Dschungel die Leichen von J. P. Morgans Neo-Anhängern durch einen Sumpf von Speed zu hetzen. Ihre Begeisterung stürzte sie in immer neue Abenteuer, in waghalsige Tänze auf einem gefährlich dünnen Seil aus Jointclips — und so war ihr Weg auf der einen Seite gesäumt von Ghandis Ahimsa und auf der anderen von erbitterten Straßenkämpfen und der gewaltigen Revolte einer potenziellen New Yorker Kommune. Denn im intellektuellen Zweikampf um die Frage der Taktik prallten die Persönlichkeiten der beiden Manager vom Total Assault voll aufeinander. Beide kämpften zwar für die Zertrümmerung des Fernsehturms da oben auf dem Empire State Building, nur ihre Methoden deckten sich nicht ganz. Es war so was wie ein Duell zwischen Anarcho-Mao und Anarcho-Tao. Der Budda-budda-budda-Sound von Johns Maschinengewehren verwandelte sich bei Paul in den Buddha-Buddha-Gesang friedlich demonstrierender Rebellen. So wie es im Moment stand, waren allerdings beide davon überzeugt, dass unmittelbare, spontane Straßenaktionen der einzig richtige Schritt auf dem Weg zur Revolution sein würden.
Sie hatten schon mal ein Café gehabt, ein winziges Ding auf der Neunten Straße zwischen Avenue B und C. Es hieß Cantina de las Revoluciones. Etwa ein Jahr schafften sie es, sich damit über Wasser zu halten, mussten am Ende aber doch zumachen, weil sie total pleite waren und überall Schulden hatten. Dann entdeckten sie ein größeres Lokal auf der Ecke Elfte Straße und Avenue A, ein ganzes Erdgeschoss, und ein Hinterhof gehörte auch noch dazu. Die Miete: hundert Dollar im Monat. Es war der Himmel auf Erden.
Aber es dauerte nicht lange und die Lizenzinspektoren tauchten auf. Und das bedeutete unweigerlich Stunk, denn John und Paul scherten sich einen Dreck um irgendwelche Lizenzen. »Ihr seid gesperrt«, eröffneten ihnen die Beamten, »ohne Genehmigung isses nix mit Gaststättengewerbe!«
»Wir sind Revolutionäre. Steuern sind abgeschafft. Das Gewerbeaufsichtsamt ist abgeschafft. Warum setzt ihr euch nicht lieber ein paar Minuten her und helft uns mit der Zwölf-Cent-Suppe?« Stattdessen überreichten ihnen die Inspektoren eine Verwarnung. Und was das Helfen beim Gemüseputzen für den Ghandischen Götterfraß anging — was für eine Zumutung!
Kurz danach wurden John und Paul gezwungen, sich runter zum Gewerbeaufsichtsamt zu begeben und dort irgendwelche Formulare auszufüllen. Sie wollten ihr Restaurant »Café Haschisch« nennen, aber dieses Ansinnen wurde von den Bürokraten natürlich auf der Stelle abgelehnt. »Wir gehen zur Civil Liberties Union, die werden die Sache schon durchboxen, ihr faschistischen Schweine!«, fauchte Paul nach einer langen Diskussion mit dem zuständigen Beamten. Aber es war einfach nichts dran zu rütteln.
Ein paar Tage später starteten sie ihren nächsten Versuch. Diesmal wurden sie gleich ins Büro von Mr. Karkenschul geführt, dem stellvertretenden Direktor des Gewerbeaufsichtsamts. Der Typ war Mitglied der Liberalen Partei und hatte sich gerade in den Kopf gesetzt, alle Lokale zu schließen, in denen Dichterlesungen stattfanden. Mr. Karkenschul überflog das ordnungsgemäß abgestempelte Anmeldeformular. »Hmm, woll’n mal sehen«, Murmelmurmel, »John Z. McBride und Paul A. Stillmann ... Anmeldung für Kotze — ein Restaurant.« Karkenschul starrte die beiden ungläubig an. »Sie meinen, Sie wollen ein Café aufmachen, das Kotze heißt?« In einem Anflug von Ekel verzog er die Mundwinkel. »Also: Zuerst sind Sie letzte Woche hier erschienen und haben versucht, Ihrer Kneipe einen illegalen Namen zu geben, und jetzt ist es Kotze. Was sollen diese Spielchen?«
»Schauen Sie Karko, wir wollen es nun mal gern Kotze nennen. Was ist denn schon dabei?«
»Ausgeschlossen!« polterte er, »so was lässt die Öffentlichkeit sich nie und nimmer bieten!«
»Wie wär’s denn mit Karkenschuls Kotzkneipe?«, stichelte Paul. Nach diesem Vorschlag wurden sie kurzerhand an die Luft gesetzt. »He, Sie liberaler Mr. Gedichteverächter! Zeigen Sie uns erst mal den Paragraphen, wo drinsteht, dass wir unsere Kneipe nicht Kotze oder Café Haschisch oder sonst wie nennen dürfen, wenn wir Lust dazu haben!«
Ein paar Tage später erschienen sie zum dritten Mal beim Gewerbeaufsichtsamt, diesmal mit einem Namen, der die Untiefen des bürokratischen Ozeans ungeschoren passierte: Total Assault Cantina.
Von da an spezialisierte sich Karkenschuls Behörde auf Überraschungskontrollen. Mindestens einmal in der Woche stand das Total Assault auf der Inspektionsliste. Ich hatte einen Freund, der einmal im Monat eine Wagenladung heißer Zigaretten aus South Carolina in der Kneipe ablieferte. Einmal hätten die Beamten ihn um ein Haar geschnappt und mit Sicherheit auch noch John und Paul ans FBI verpfiffen. Wir schafften die unverzollten Dinger in Windeseile in den Keller. Wie sich dann herausstellte, verlangten die Wichser von den beiden, sich eine sogenannte »Konzession für den Einzelhandel mit Zigaretten innerhalb der Stadt New York« zu besorgen.
Dann fingen John und Paul an, Dichterlesungen zu veranstalten, und Karkenschul stolperte natürlich prompt über die entsprechenden Anzeigen in der Village Voice und hetzte seine Spezialisten los. Die machten den Managern verschiedene Auflagen und klärten sie darüber auf, dass sie erst mal ganz klein werden und sich um eine Konzession für Kleinkunst bewerben müssten, wenn sie die Absicht hätten, mit ihren Gedichten weiterzumachen. Derzeit existierte — und existiert wahrscheinlich heute noch — ein Gesetz in New York, das jegliche Unterhaltung in Lokalen auf drei Saiteninstrumente und ein Klavier beschränkte. Dichterlesungen waren verboten und Gesang ebenfalls. Für diese Fälle war die sogenannte Konzession für Kleinkunst erforderlich — ein bürokratischer Albtraum von Inspektoren, die man bestechen, Künstlern, die sich bei den Behörden anmelden und ständig ihre Identitätsmarken mit sich herumschleppen mussten, und so weiter und so weiter.
Eine andere Sache, die die Behörde zur Weißglut brachte, war die Nachgiebigkeit des Total-Assault-Managements. Sie brachten es einfach nicht fertig, ihren Gästen zu verbieten, auf dem Fußboden zu übernachten, obwohl das den Vermieter langsam, aber sicher wahnsinnig machte. Mitten in der Nacht kamen die Bullen vorbei und leuchteten mit ihren Taschenlampen ins Frontfenster: Dann sah der vordere Raum aus wie eine Konservenbüchse voller Schlafsäcke. Dabei konnten die Typen sowieso höchstens sechs Stunden Schlaf rausschinden, denn morgens um zehn rückten John und Paul an und weckten alle wieder auf, weil sie saubermachen und ihre Brote in den Ofen schieben mussten, ehe der übliche Mittagsansturm auf die Suppe einsetzte.
Das Total Assault war eigentlich mehr Gemeindezentrum als bloßes Restaurant. Hinter einem Streifen Gaze, der quer durch den vorderen Raum gespannt war, lag die Küche, komplett mit wackeligem Kühlschrank von der Heilsarmee, riesigem Backofen, selbst gebastelten Speisekammern aus Holzkisten und einer langen Theke aus lackiertem Kiefernholz. Die ganze linke Wand war mit Collagen, Bulletins, Flugblättern und ähnlichem übersät, und etwas weiter hinten, zum Hof zu, lag auch die Druckerei. Sie war mit wunderbaren schwarzen chinesischen Wandschirmen abgegrenzt, und nur Ptah allein konnte vielleicht Auskunft darüber geben, wie sie ausgerechnet hierher gekommen waren. Die andere Wand war von oben bis unten mit Bücherregalen bedeckt. »People’s Library« nannte John das, und ständig schleppten die Leute hier Bücher weg, ohne sie jemals wieder zurückzubringen. Mehrere Sofas vom Sperrmüll waren für die, die sich beim Essen gern ein bisschen langlegten, um einen großen Tisch gruppiert. Die Fußleisten waren fast überall mit Deckeln von Konservendosen vernagelt, um den Ratten die Löcher zu stopfen. Die auffallenderen Risse in der Wand hatten sie mit einer Mischung aus Brillo Pads und Gips zugeschmiert. Gleich neben dem Fenster, das nach vorn zur Straße hinausführte, stand ein Klavier mit einer sauber aufgeschichteten Pyramide aus Schlafsäcken obendrauf, die nachts für die Liegewiese verwendet wurden.
Da die eine Wand ausschließlich für Flugblätter und Collagen reserviert war, klebten da am Ende des ersten Jahres von der Decke bis zur Fußleiste mindestens tausend Zettel, immer wieder neue über den alten. Übrigens bewahre ich in meinem Keller eine Kiste auf mit Postern und dem ganzen Zeugs, was da mal gehangen hat. Na, worauf wartet ihr denn noch, ihr Macker von der New York Graphic Society?
Versammlungen, Versammlungen und nochmals Versammlungen — in der Total Assault Cantina müssen es mindestens hundert pro Monat gewesen sein. Jeden Abend pünktlich um sieben fand ein New York Times-Sneer-In statt. Wir wechselten uns der Reihe nach ab, Artikel, die an diesem Tag erschienen waren, vorzusingen oder laut zu deklamieren. Es war jedes Mal ein wildes Durcheinander von Geschrei, Gelächter und Wutausbrüchen. Über die zehn Topsprünge des Tages an der Börse machten wir uns besonders lustig. Und wenn die Aktien um ein paar Punkte fielen, erhob sich ein ohrenbetäubender Applaus. Manchmal, wenn sie mal wieder so richtig in den Keller gesackt waren, ging Paul hin und stellte ein Schild mit der erfreulichen Neuigkeit ins Frontfenster.
Ich selbst stand vor allem auf die Bürgerversammlungen Dienstag abends. Das waren nämlich die reinsten Schreiwettbewerbe. Außerdem wurde hier so mancher grandiose Plan aus dem Nichts geschmiedet, zum Beispiel die Idee einer freien Klinik für Medizin und Zahnmedizin. Dieses Projekt existiert sogar heute noch, aber vieles andere war auch einfach nur Gelaber, bei dem Ende doch nichts rauskam. Jedenfalls hatte ich öfters Gelegenheit, meine Jodelkünste aufzufrischen, wenn die Debatten sich mal wieder endlos und langweilig dahinschleppten.
Trotz des positiven, kommunistisch angehauchten Dharma-Karmas entwickelte sich die Kneipe zu einem finanziellen Desaster. Über der Kasse hing ein Schild mit der prophetischen Aufschrift: »Hier wird kein Profit gemacht!« Das meiste Geld ging für die Essensschnorrer drauf. Im Fenster stand eine Badewanne aus Porzellan, in der John und Paul jeden Tag einen riesigen Gemüsesalat anrichteten. Daneben eine Kanne Tee und ein Topf mit Suppe, alles gratis. Mit glasigen Augen kamen die Leute reingelatscht wie die reinsten Fressroboter und bedienten sich reichlich aus Salatwanne und Suppentopf. Danach erhob sich ein allgemeines Geschlürfe und Geschlabber. In Windeseile schlug sich jeder den Wanst voll und verschwand dann wieder, ohne auch nur einen Cent bezahlt zu haben. Es gab eben einfach zu viele, die Hunger hatten. Allerdings kamen auch Leute, die Kohle hatten und sich trotzdem für eine freie Mahlzeit anstellten. Sogar ich muss gestehen, die Total Assault Cantina um Berge von Reis und schüsselweise Suppe gelinkt zu haben, obwohl mir die Moneten in der Tasche klimperten. Zuerst hatten John und Paul versucht, Getränke- und Essensmarken an die Kunden auszugeben, aber sie wurden entweder völlig aufgeweicht auf den Tischen vergessen oder zum Wegwischen von Flecken benutzt. Jeden Tag backten die beiden frisches Brot. Und prompt fingen die Typen an, ganze Brotlaibe auf einmal zu klauen. Sie kamen reingeschlurft, bestellten sich einen Kaffee und waren plötzlich flink wie die Wiesel mit dem Brot unterm Arm zur Tür herausgehuscht — und das auf dem Nachhauseweg von ihrem Job.
Eins der New Yorker Wochenmagazine brachte eines Tages in seiner Beilage eine Story über die Kneipe und nannte sie »einen duften Platz, wo man prima und umsonst essen kann«. Das hatte beinah ein Chaos zur Folge. Die Leute kamen bis aus New Jersey, nur um einmal in ihrem Leben eine Beatnikmahlzeit zu schnorren. Hunderte standen draußen auf dem Bürgersteig Schlange und drinnen war es kaum auszuhalten. Spätestens jetzt hätten John und Paul einen klaren Strich ziehen müssen — von mir aus jedem einen Teller Suppe geben, aber alles andere berechnen sollen. Es kam sogar so weit, dass die Leute in der Druckerei herumschnüffelten, und das brachte mich auf die Palme, weil wir grad versuchten, Wehrpässe und falsche Personalausweise für Wehrdienstverweigerer zu drucken. Um die Flut der Wochenendbeatniks einzudämmen, kamen wir auf die wahnwitzige Idee, eine Speisekarte mit so abschreckenden Spezialitäten wie »Augäpfel au gratin« oder »Froschärschchen am Spieß« zu drucken und zehn bis fünfzehn davon an die Frontfenster der Cantina zu kleistern. Dann füllten wir die Salatwanne bis zum Rand mit einem widerlichen Brei, der aussah, als stamme er mindestens vom Mars, warfen die abgehackten Köpfe von circa einem Dutzend unheimlich echt aussehenden Gummischlangen in die schleimige Suppe, würzten alles mit Puppenköpfen, Unkraut aus dem Park und ein paar Ratten und klebten obendrüber ein Schild mit der Aufschrift GRATIS.
Ich führte die Druckerei, wo wir uns auf Protestaufrufe, Gedichtsammlungen, Wehrpässe, Personalausweise und Flugblätter spezialisiert hatten. Ich hatte alle Hände voll zu tun, und dann kamen die Typen von draußen rein und laberten mir stundenlang die Ohren voll. Am Schluss stand ich immer wie ein Zombie neben der Druckerpresse. Verrückte Macker mit unmöglichen Geschichten. Da waren zum Beispiel welche, die bestanden allen Ernstes darauf, dass ich sofort alles andere liegen ließ und erst mal ihren Gedichtband oder Aufsatz druckte. Oder auch sechs Jahre Tagebuch, wo sie von ihren Experimenten mit Trance-Tanz nach der Zen-Sufi-Methode berichteten, im arabischen Petra. Selbstverständlich erwarteten sie, dass ich die Papierkosten übernahm. Eines Tages kriegte ich Ärger mit einer von den ansässigen Straßengangs — ich glaube, sie nannten sich Visagenknacker oder so ähnlich, jedenfalls wurden sie echt sauer, als ich ihnen nicht meinen Werkzeugkasten aus der Druckerei borgen wollte, damit sie ihre Kanonen wieder auf Vordermann bringen konnten. Am nächsten Tag hatten wir ein eingeschlagenes Fenster.
Natürlich war keine Kohle da, um es reparieren zu lassen, und erst recht keine Versicherung, also mussten wir uns wohl oder übel nach einer Lösung auf der Straße umsehen. Zu der Zeit steuerte die Szene grade in eine Art Drogenpanik. Die Junkies sanken sogar so tief, dass ihnen nichts Besseres mehr einfiel, als das Total Assault auszuräumen. Sie klauten fünfzehn »gestimmte« Gongs, die dem Celestial Freakbeam Orchestra gehörten. Sie klauten die elektrische Kochplatte für die Suppe aus dem Frontfenster. Sie klauten meine elektrische Schreibmaschine, ließen aber die Offset-Presse stehen, wahrscheinlich, weil sie ihnen zu schwer war. Als sie mitten in der Nacht anrückten, wunderten sie sich wohl, über eine schnarchende Matratzenwiese zu stolpern — jedenfalls ließen sie elf Mann gefesselt, geknebelt und bis zum Hals in ihren Schlafsäcken verschnürt zurück. Zu allem Überfluss stellte die Post uns auch noch das Telefon ab, nachdem ein sogenannter Freund vier Stunden lang mit London telefoniert hatte, ohne einem von uns was davon zu erzählen. Der Ruin stand wie eine drohende Wolke am Horizont. Schließlich stellten John und Paul eine Liste mit den wichtigsten Schulden zusammen:
| Gas / Strom | 60 $ |
| Papier | 80 $ |
| Holz | 160 $ |
| Zwei Monatsmieten | 200 $ |
| Lebensmittel | 200 $ |
»Wie zum Teufel sollen wir bloß siebenhundert Kröten zusammenkratzen?«
»Ich hoffe ja nur, es kommt nicht soweit, dass wir uns auf dem Times Square als blinde Bettler verkleiden müssen!«, ulkte Sam.
In unserer Verzweiflung hielten wir eine Wasserpfeifennotstandssitzung ab. Zuerst verfielen wir auf die traditionelle Tour, nämlich bei Brentano die Kunstbuchabteilung auszuräumen. Die Frage war nur: Wie sollten wir Publikationen von Skira und der New York Graphic Society im Wert von siebenhundert Dollar da rausschaffen, ohne dass die was davon mitkriegten? Als Nächstes entwarfen wir allen Ernstes einen Plan für einen gewaltlosen Banküberfall. Stundenlang zerbrachen wir uns die Köpfe damit, uns einen Zettel für den Bankschalter auszudenken, der erstens den Kassierer beruhigen, zweitens ihn tatsächlich dazu bringen sollte, das Geld rauszurücken und drittens nicht unsere unmittelbare Verhaftung zur Folge haben würde. Am Schluss stellte sich heraus, dass ein gewaltloser Banküberfall offenbar ein völlig unmögliches Unternehmen ist.
Eine Sache, die wir sofort in Angriff nahmen, war die Benefizveranstaltung, eine von diesen Marathondichterlesungen, die von abends acht bis morgens um vier dauern. Insgesamt erschienen siebenunddreißig Poeten und warteten aufgeregt auf ihren Auftritt. Das brachte uns lumpige fünfundsiebzig Dollar, obwohl es vom Publikumsandrang her gesehen ein voller Erfolg war. Außerdem hatte jemand seine Flöte unter dem Tisch vergessen, und es stellte sich heraus, dass sie bis zum Mundstück voll Amphetamin steckte. Das wurde natürlich Hals über Kopf verscherbelt, und der Reinerlös des Abends stieg auf einhundertundzehn Dollar. Die andern dachten sogar kurz daran, unsere Druckerpresse zu verkaufen, aber was sollten wir mit einer revolutionären Kneipe, wenn wir da nicht mal drucken konnten?
Am nächsten Morgen rief John bei seiner Tante an. Seine Verwandtschaft verkaufte nämlich Obst und Gemüse auf dem Hunts Point Market, wo das Total Assault mittlerweile mit einer beträchtlichen Summe in der Kreide stand. John wollte seiner Tante noch mal für ein paar Wochen Lebensmittel abluchsen und im Lauf des Gespräches erzählte sie ihm: »Übrigens ist Larry aus Hongkong zurück. Er hat schon versucht, dich zu erreichen. Soweit ich weiß, will er irgendwas mit dir besprechen.«
Larry aus Hongkong zurück bedeutete, dass Dope in Aussicht war, denn Vetter Larry brachte regelmäßig eine Ladung Haschisch und Gras mit, wenn sein Schiff in New York einlief.
Tante Mildred gab ihm die Telefonnummer und ließ sich schließlich sogar breitschlagen, ihnen auch weiterhin Gemüse auf Kredit zu liefern. John rief Larry sofort an: »Irgendwelche Hamburger angekommen?« — »Da kannst du Gift drauf nehmen«, meinte Larry, »hör zu, seit drei Tagen versuche ich, dich zu erreichen. Ich sitze in der Scheiße, können wir uns irgendwo treffen?«
Larry nahm eine U-Bahn in die Lower East Side und verhandelte mit dem Management. Er bot ihnen einen Deal an, der das Total Assault noch mal vor der Pleite retten würde. Wenn John und Paul eine Woche lang zehn Zentnersäcke mit gepresstem Gras lagern könnten, würden Larry und seine Kollegen tausend Dollar dafür springen lassen. »Yippie!«, schrie Paul, »Ra steht uns bei!«
»Unten in Memphis ist was schiefgelaufen«, erzählte ihnen Larry, »und vor nächster Woche können die nicht hier sein, um die Ware abzuholen. Und ich selbst hab noch jede Menge andere, äh — Geschäfte zu erledigen und kann nicht die ganze Zeit hier in New York rumhocken und warten. Und wo soll ich das Zeugs inzwischen lassen, etwa in Daddys Kartoffelsäcken auf dem Markt?«
Der simpelste Deal von der Welt. John und Paul brauchten nichts weiter zu tun als das Dope sicher und trocken zu lagern, bis ein ganz bestimmtes Individuum in einem roten Lastwagen vorfahren und sich mit dem Code-Namen »Agnus Dei« vorstellen würde. »Ähem«, begann Paul zögernd und fragte dann, wie’s denn mit einem kleinen Vorschuss auf die tausend Dollar wäre — und tatsächlich rückte Vetter Larry zweihundert Piepen raus!
Am späten Abend luden sie zitternd vor Paranoia die schweren Säcke aus Larrys Wagen und schleppten sie in den Keller unter der Kneipe. Ein paar Stunden später fing Paul an zu fluchen und schwor, er könnte die Hasch-Schwaden riechen, die durch die Ritzen in den brüchigen Dielenbrettern hochstiegen. Vielleicht war es wirklich nur Paranoia, aber John und Paul bildeten sich ein, dass der Geruch einfach überwältigend war. Früh am nächsten Morgen besorgten sie sich einen Lastwagen und fuhren raus nach New Jersey, wo sie ein paar Ballen Heu erstanden, die sie als »Sofas« in der Kneipe platzierten — in der Hoffnung, dass der Geruch des Heus als Alibi für das Gras reichen würde. Um ganz sicherzugehen, trieben sie zusätzlich noch ein paar Zentnersäcke Mehl, Feldbohnen und Erdnüsse auf, die sie in den Keller hinunterwälzten und strategisch vor den Dope-Säcken verteilten.
Genau eine Woche später erschien ein Bursche in der Kneipe und sagte: »Hi, ich bin Agnus Dei.« Es war helllichter Tag.
Paul fiel beinah in Ohnmacht und fragte: »Soll das heißen, dass wir mitten am Tag die Hamburger aufladen sollen, vor den Augen der ganzen Leute, die hier langlatschen?«
»Nein«, lachte Agnus Dei, »ich komm heut Nacht um eins zurück.«
Und so luden sie im Schutz der Dunkelheit eine halbe Tonne Gras in den Anhänger des roten Lasters. Es war der reinste Albtraum. Wieder und wieder sicherten sie die Straße ab. Jedes vorbeifahrende Auto kam vom FBI. Jeder Schritt auf der Straße kündigte die Bullen an. In einer Rekordzeit von zwei Minuten hatten sie den Job erledigt.
Der Bursche übergab ihnen die restlichen achthundert Dollar. »Seht ihr die Kiste da drin?«, fragte er augenzwinkernd. Sie schauten genauer hin und entdeckten in einem Verschlag eine Holzkiste mit dem Stempel MADE IN HONGKONG auf der einen Seite.
»Yeah, was ist damit?«
»Da sind fünfzig Maschinengewehre drin für die Typen von der Operation Thunder.«
Operation Thunder war ein rassistischer, halbmilitärischer, rechtsradikaler Flügel, der Anfang der sechziger Jahre draußen im Mittelwesten operierte und sich später auf politische Attentate spezialisierte.
»Die zahlen uns hundert Piepen pro Stück!«
John und Paul starrten sich an. Paul fragte: »Und wie willst du ihnen die Dinger übergeben?«
»Ich weiß von nix. Alles was ich dabei zu tun habe, ist diesen Laster an der Ecke Dreiundzwanzigster Straße und Siebter Avenue zu parken und über Nacht da stehen zu lassen. Die Thunderbolts, oder wie die Kerle sich nennen, übernehmen dann den Rest.«
Kaum war der Lastwagen außer Sichtweite, flüsterte Paul:
»Die Knarren reißen wir uns unter den Nagel!«
»Yeah, wir schmeißen sie in den Fluss!«
»Aber wie transportieren wir sie am besten? Wir können doch nicht mit fünfzig MGs unterm Arm in ein Taxi steigen!«
Da fiel ihnen auf einmal der alte Schiebekarren mit den Fahrradreifen ein, der damals im Keller herumgestanden hatte, als sie das Haus zum ersten Mal besichtigt hatten. Sie zogen die eisernen Kellertüren hoch und stöberten hinten im rückwärtigen Teil des Gangs im Schutt und Dreck herum, bis sie ihn gefunden hatten. Und schon ging’s los. So schnell wie möglich trabten sie mit dem Karren rauf zur Kreuzung Dreiundzwanzigste und Siebte Avenue, wo sie den Laster bald entdeckt hatten. Er war auf der linken Straßenseite abgestellt und leer bis auf die Kiste mit dem Hongkong-Stempel. John brach das rückwärtige Fenster auf und öffnete die Tür.
»Guck mal nach, ob vorn ein Werkzeugkasten steht.«
»Yeah, hier liegt einer.«
»Okay, dann reich mir mal ein Brecheisen rüber.«
Sie brachen den Deckel der Kiste weit genug auf, um sich zu vergewissern, dass auch wirklich Gewehre drin waren, aber das Ding war so schwer, dass sie es keinen Zentimeter von Fleck brachten. John stand Schmiere und passte auf, dass die Heinis vom Thunder nicht plötzlich vor ihnen standen, während Paul den Deckel ganz löste und anfing, die ölverschmierten Waffen herauszuzerren.
»Was machen wir jetzt bloß damit?«
Zum Glück entdeckte John plötzlich einen Kanaldeckel direkt neben dem Anhänger. Er stemmte den Deckel hoch und sagte: »Los, rein damit! Wir schmeißen welche hier rein und karren den Rest runter zum Fluss, soviel wir schleppen können.«
Paul reichte die Guns stapelweise hinunter zu John, der sie vorsichtig in den Schacht gleiten ließ. »Pass ja auf, dass sie nicht gespannt sind. Schließlich wollen wir nichts riskieren. Nachher erschrecken sich die Kanalarbeiter noch zu Tode und haben Angst, dass die Dinger vor ihrer Nase losgehen.«
Als sie so viele im Schacht versteckt hatten, dass sie die Kiste bewegen konnten, hievten sie sie vom Lastwagen herunter und ließen sie auf ihren Karren fallen. Dann nagelten sie den Deckel wieder drauf und stürzten in panischer Flucht Richtung East Side. Sie rasten die Dreiundzwanzigste Straße entlang bis zur Avenue C, dann abwärts bis zur Vierzehnten, weiter zur Zehnten, bogen hier links ab und stießen in vollem Galopp auf die Avenue D. O je: genau vor ihnen lag der East Side Highway. Zzzzzzzzzzz! Schnarchende und besoffene Penner flogen vorbei. Sie packten die Kiste und wuchteten die Gewehre in Schweiß gebadet über die Fahrbahnen. Auf der anderen Seite des Highways setzten sie sie ab, sprinteten zurück zu ihrer Karre, trugen sie hinüber und luden die Kiste wieder auf. Dann begann eine verzweifelte Suche nach einem Eingang in den Park, der zwischen dem Highway und dem Fluss lag. Sie spurteten weiter Richtung Süden und fanden schließlich einen schmalen Pfad — hoppla — war bloß eine Sackgasse, die auf ein Handballfeld führte. »Wir hätten wirklich ’ne Taschenlampe einstecken sollen«, stöhnte Paul und versuchte die Karre zu stoppen, ehe sie mit voller Wucht gegen die Mauer krachte.
Endlich fanden sie eine halb versteckte Öffnung, die auf ein Spielfeld zu führen schien. Und dahinter, nur ein paar hundert Meter weiter, wälzte sich der Fluss entlang. Vor Angst schwitzend schoben sie den Karren über das Mittelfeld in Richtung Zweite Avenue, Heimat, Unterschlupf und aha! — da war ja auch endlich ein Tor! Es führte zum Wasser. Bündelweise schleuderten sie die Gewehre in den stinkigen East River und brachen anschließend halb ohnmächtig auf dem Spielfeld zusammen. Erst nach einer geschlagenen Stunde konnten sie sich wieder einigermaßen bewegen.
Wir sangen und schrien bis tief in die Nacht hinein, knallten uns zur Feier des Tages eine Wasserpfeife nach der anderen in den Kopf und triumphierten über die schwachsinnigen Schmuggler der Operation Thunder.
Es dauerte noch gut ein Jahr, ehe die Total Assault Cantina endgültig dichtmachte. Die beiden Manager hatten einfach keine Lust mehr, sich dauernd mit irgendwelchen Scherereien herumzuschlagen. Paul hat die Stadt verlassen und lebt zurzeit in Arroya Aeternitas, New Mexico. Wenn man seinen Worten Glauben schenken darf, erwartet er in Kürze seine Wiedergeburt als Föhre.
John ist immer noch voll dabei, wenn auch grenzenlos enttäuscht von der Tatsache, dass die Russen ihre Dichter ins Gefängnis stecken. »Ich weiß, ich würde es nie schaffen, in meiner eigenen Revolution zu überleben«, schrieb er mir vor ein paar Tagen.
Ich selbst bin in den Keller gezogen, ein paar Jahre nachdem der Mafia das kleine Missgeschick mit dem Feuer passiert war. Ich stolperte sozusagen mitten rein. Zu der Zeit arbeitete ich grade aushilfsweise als Zeitungsreporter bei einem schnieken uptown-Nachrichtenmagazin — Stringer nennen sie solche Typen. Ich kassierte hundert Dollar für jeden Bericht, den ich ablieferte, und damals war das noch mehr als genug, um genügend Zeit zu haben, meinen »neuen Roman« fertig zu schreiben. Schließlich hatten die Kritiker mir in ihren Rezensionen ja mehr als einmal versichert, dass sie ganz wild darauf waren, ihn zu lesen. Na ja, jedenfalls war ich eines Nachts unterwegs und streunte in der Post-Hippie-Desaster-Gegend der Lower East Side herum — für eine dieser »Wo-sind-all-die-Blumen-hin«-Stories, ihr wisst schon. Tja, ich war also schon ganz schön wacklig auf den Beinen von meinen ausgiebigen Recherchen in der Pee Wee’s Bar und stolperte um zwei Uhr morgens die Avenue A entlang und auch an der alten Total Assault Cantina vorbei. John hatte mir erst kürzlich erzählt, dass im Keller immer noch ein paar Heuballen von dem Gras-Deal herumliegen müssten; also liftete ich die Metalldeckel, zündete ein Streichholz an und wankte die Treppe hinunter. Und das war’s dann auch schon. Nachdem ich erst mal die ganzen Wanzen und Ratten erledigt hatte, liebte ich diesen anheimelnden Keller gradezu. Ich beschwatzte den Vermieter, der mich für total übergeschnappt hielt und mir das Loch für neunundvierzig Dollar pro Monat überließ.
Und ich wohne immer noch hier, möglicherweise sogar jetzt noch, wenn ihr die Story lest. Ich schreibe sie auf meiner uralten Schreibmaschine, die auf einem der vergangenheitsträchtigen Heuballen balanciert. Aber allmählich wird es Zeit für mein Abendessen. Und ich zieh los, drücke den scheppernden Eisendeckel auf und klettere hinaus auf die Straße. Dann geht’s rüber zur Pizzeria am St. Marks Place, und die Wühlerei in der Quelle aller Quellen beginnt: Es ist eine weiße Mülltonne aus Metall, mit einem runden Deckel obendrauf und einer glänzenden Aluminiumklappe. DRÜCKEN steht da drauf. Die Tonne steckt immer bis zum Rand voll mit vergammelten Resten von Pizzavierteln, die drüben in der Pizzeria in viereckige Fetzen Wachspapier eingeschlagen werden. Nicht zu vergessen ein gelegentlicher Schluck Traubensaft, der in einem zerquetschten Plastikbecher übriggeblieben ist.
Im Allgemeinen ist es so, dass ich jeden Abend gegen sechs an der Pizza-Tonne zu Abend esse — falls es unter euch einen gibt, der früher auch in der Total Assault Cantina rumgehangen hat und vielleicht Lust drauf hat, mal vorbeizuschauen und in der Vergangenheit zu wühlen.