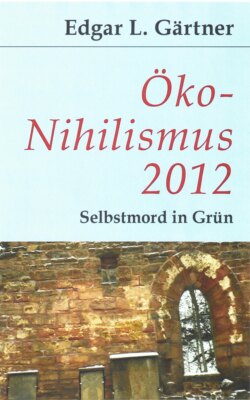Читать книгу Öko-Nihilismus 2012 - Edgar L Gärtner - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1
Windmühlen im Krieg der Köpfe
WENN nicht alles täuscht, sind bei uns in Deutschland und auch in einigen westeuropäischen Nachbarländern bald alle grün: die einen, weil sie überzeugte Anhänger grüner Parteien beziehungsweise schwarzer und roter Parteien mit grünen Ambitionen oder gläubige Muslime sind, die andern, weil sie sich darüber grün ärgern.
Sichtbarstes Symbol der Ergrünung Deutschlands und dem damit zusammenhängenden Ärger ist die Verunstaltung des Landes durch Zigtausende von riesigen Windrädern. Die internationale Konferenz Renewables 2004 Anfang Juni 2004 in Bonn wurde nicht nur vom grünen Bundesumweltminister Jürgen Trittin, sondern auch vom damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder und seiner Parteigenossin Heidemarie Wieczorek-Zeul als Durchbruch im Kampf gegen Armut und Klimawandel durch die Erschließung sogenannter erneuerbarer Energien gefeiert. „Das Zeitalter der Erneuerbaren beginnt jetzt!“, erklärte Trittin großspurig. Und Bundesentwicklungsministerin Wieczorek-Zeul fügte mit Blick auf den Irak-Krieg hinzu: „Es wird niemals Krieg um den Zugang zur Sonne geben.“ Man glaubt ihr gerne, dass man deutsche Windräder und Solaranlagen wie die vielfältigen kartellähnlichen Verflechtungen in Parteien, Verbänden und Aufsichtsräten der Deutschland AG nicht am Hindukusch verteidigen braucht.
Seither haben alle im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien die Prophezeiung eines kommenden Zeitalters der Erneuerbaren kritiklos übernommen und jeden vorgeblichen Schritt der Verwirklichung dieser Utopie bejubelt. Aber zumindest Juden und Christen sollten sich daran erinnern, dass die echten Propheten nicht gefeiert, sondern verfolgt wurden. Der Versuch, einer zutiefst verunsicherten Bevölkerung durch gutes Zureden von oben herab ein Gefühl des Aufbruchs in eine neue Ära von Frieden und Wohlstand zu vermitteln, könnte mit einem jähen Erwachen enden. Denn physikalisch gesehen gibt es keine „erneuerbare“ Energie. Bei den Energiequellen Wind und Sonnenschein, die euphorisch als „erneuerbar“ bezeichnet werden, handelt es sich bekanntermaßen um witterungsabhängige Zufallsenergien. Nur ein Orwellsches Neusprech-Programm kann daraus „Erneuerbare“ machen.
Warum die rot-grüne Regierungskoalition unter Gerhard Schröder und Jürgen Trittin schon im Frühjahr 2005 nicht mehr weiter wusste, ist bis heute ein Geheimnis. Jedenfalls war die grüne Gefahr mit der Ablösung der Schröder-Trittin-Regierung durch eine Große Koalition unter der DDR-Physikerin Dr. Angela Merkel noch lange nicht gebannt. Die Wind- und Solar-Euphorie erhielt nur für kurze Zeit einen Dämpfer. Angela Merkel ließ als Spitzenkandidatin der Opposition schon vor der vorgezogenen Bundestagswahl vom 18. September 2005 durchblicken, dass es unter ihrer Kanzlerschaft nicht nur eine Fortschreibung der umstrittenen Ökosteuer, sondern auch einen „Vertrauensschutz“ für die Wind- und Solarbranche, das heißt keine Abstriche von der als „Anschubfinanzierung“ getarnten Dauersubventionierung „erneuerbarer“ Energien über künstlich erhöhte Strompreise geben wird.
In dem nach dem vagen Ausgang der Bundestagswahl von 2005 zustande gekommenen Koalitionsvertrag zwischen Unionschristen und Sozialdemokraten wurde denn auch die ideologiegetriebene und ruinöse Energiepolitik der rot-grünen Regierung ausdrücklich fortgeschrieben. Eine Gesetzesänderung, die den Stromverbrauchern die Kosten für teure Unterwasserkabel auferlegt, machte inzwischen den Weg frei für die Errichtung riesiger Windradparks in Nord- und Ostsee. Nach der Veröffentlichung der Politischen Zusammenfassung des 4. Sachstandsberichts des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Anfang Februar 2007 in Paris erlebten die Aktien der Solarbranche einen Boom, der unwillkürlich an die „Blase“ der New Economy um die Jahrtausendwende erinnert. Anders als die dotcom-Blase geht die Blase der Erneuerbaren aber auf ein fest etabliertes staatsmonopolistisches Kartell, den ökologisch-industriellen Komplex zurück.
Der ökologisch-industrielle Komplex
SCHON IN DEN ANFÄNGEN der um 1970 gestarteten systematischen Umweltpolitik galt für den auf den Bau von Filtern aller Art spezialisierten neuen Zweig des Anlagenbaus der Satz „Gesetze bestimmen die Umsätze“. So der Titel eines Beitrages in einem der damals eigens gegründeten Fachmagazine für Umwelttechnik. Das bedeutet, je schärfer die Grenzwerte für Schadstoffe in Abwasser und Abluft, desto besser die Geschäftschancen der Umweltbranche.
Das wurde bereits auf der ersten deutschen auf Umwelttechnik spezialisierten Messe, der ENVITEC 1973 in Düsseldorf, thematisiert. Bei dieser vom damaligen Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) eröffneten Ausstellungs- und Kongressveranstaltung wurde auch deutlich, dass die Branche stark von Konzernen des MilitärischIndustriellen Komplexes dominiert wird. Deren Manager waren es seit der nazistischen Kriegswirtschaft (insbesondere in deren Endphase unter Albert Speer) gewohnt, in einer korporatistischen, aber hoch effizienten Form von Vetternwirtschaft auf politisch-bürokratisch bestimmten Märkten zu arbeiten.
Der Begriff „militärisch-industrieller Komplex“ (MIK) wurde vom US-General und späteren US-Präsidenten Dwight D. Eisenhauer geprägt. Dieser warnte seine Landsleute am Ende seiner Amtszeit vor der Eigendynamik der in der Kriegswirtschaft des Zweiten Weltkriegs aufgebauten kartellartigen Wirtschaftsstrukturen. Der Begriff „Öko-Industrie-Komplex“ (ÖIK) wurde bereits im Jahre 1970 vom linksliberalen amerikanischen Publizisten Martin Gellen eingeführt. Dieser sah schon damals deutlich, dass die von US-Präsident Richard Nixon in großem Stil aus der Taufe gehobene Umweltpolitik als relativ eigenständiger Politikbereich zu dem MIK vergleichbaren parasitären Wirtschaftsstrukturen führen muss. Durchaus nicht zufällig ging übrigens der Start der Umweltpolitik einher mit der Abkehr der NixonRegierung vom wenigstens noch formalen Gold-Bezug des 1944 in Bretton Woods begründeten internationalen Währungssystems. Seither manifestiert sich die von der wachsenden Staatsverschuldung erzeugte Geldentwertung weniger in einer kontinuierlichen Verteuerung von Waren des täglichen Bedarfs als vielmehr in Form des periodischen Platzens politisch erzeugter Spekulationsblasen.
Einer der Vordenker des ÖIK in Deutschland war Ludwig Bölkow, Vorstandsvorsitzender des Rüstungskonzerns Messerschmidt-Bölkow-Blohm (MBB). Schon 1970 forderte er, um angesichts der sich abzeichnenden Ost-West-Entspannung diversen Nachteilen der einseitig militärischen Ausrichtung seines Geschäfts zu begegnen, eine Ausweitung des zivilen Anteils der Fertigung seines Konzerns auf 50 Prozent. Dabei dachte er hauptsächlich daran, Umweltschutztechniken zum zweiten Standbein des durchwegs politisch bestimmten Geschäfts seines Konzerns zu machen.
Neben Bölkow gehörte auch der ehemalige MBB-Manager und spätere „Atomminister“ Prof. Dr. Siegfried Balke zu den Vordenkern des ÖIK. Die Technologieberatungsfirma MBB Systemtechnik in Ottobrunn hat bis heute einen beträchtlichen Einfluss auf die deutsche und zum Teil auch europäische Forschungs- und Technologiepolitik im Bereich Energie und Umwelt – etwa in Form von Gutachten für Bundesministerien und Enquête-Kommissionen des Deutschen Bundestages. Gleichzeitig fördert die Bölkow-Stiftung, in deren Stiftungsrat Grüne den Ton angeben, gezielt Pioniere „grüner“ Energietechnik.
Zu den Firmen, die das erste Umweltprogramm der deutschen Bundesregierung von 1971 und die darin enthaltenen (und von ihnen direkt beeinflussten!) Emissionsgrenzwerte in Form diverser Filter- und Reinigungstechniken umsetzten, gehörten dann auch fast durchwegs Töchter von Rüstungskonzernen wie Flick (insbesondere Krauss-Maffei), Quandt, Klöckner, Krupp, Haniel, MBB, Rheinstahl und Siemens. Hinzu kamen Töchter von Metallgesellschaft, Degussa und Hoechst-Uhde sowie des Energiekonzerns RWE, die (wie auch die meisten der Vorgenannten) in der Nuklearindustrie eine große Rolle spielten.
Begleitet wurde diese Neuausrichtung des MIK durch die allmähliche Transformation von Massenmedien in eine Angstindustrie. Eine große Gelegenheit dafür bot die Veröffentlichung der Studie Die Grenzen des Wachstums durch den Club of Rome. Das Thema „CO2 und Klima“ spielte dabei in Deutschland jedoch zunächst kaum eine Rolle. Stattdessen griffen skandinavische Länder die alte, im Grunde längst widerlegte Hypothese des schwedischen Chemikers Svante Arrhenius von 1896 auf, der wachsende Ausstoß des Verbrennungsabgases CO2 führe zu einer Verstärkung des „Treibhauseffekts“.
Vor allem die schwedischen Sozialdemokraten unter Olof Palme erwogen schon im Umkreis der ersten UN-Umweltkonferenz 1972 in Stockholm und des neu gegründeten internationalen UmweltFachmagazins Ambio die Einführung von CO2-Steuern, stießen damit jedoch zunächst in Kontinentaleuropa auf wenig Resonanz. Erst als der Preis des Nordsee-Öls in den 80er Jahren unter 10 Dollar je Barrel absackte und die Erdgasförderung in der Nordsee infolge der Koppelung des Gaspreises an den Ölpreis unrentabel geworden war und es deshalb in Europa nahe lag, in der Wärme- und Stromproduktion massiv zur reichlich vorhandenen billigen Kohle zurückzukehren, starteten die skandinavischen Sozialdemokraten unter der damaligen norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland, später Vorsitzende der nach ihr benannten UN-Kommission für Umwelt und Entwicklung, mit Hilfe der Sozialistischen Internationale eine europaweite Kampagne für CO2-Steuern, um den Kohle- und Öleinsatz künstlich zu verteuern und die Erdgasförderung in der Nordsee wie später auch in Russland wieder rentabel zu machen.
Das CO2-Thema war aber auch einigen Persönlichkeiten der damals in Bonn regierenden Großen Koalition von CDU/CSU und SPD und der sie ablösenden sozial-liberalen Koalition unter Willy Brandt von Anfang an bekannt. Zu diesen Persönlichkeiten zählte der spätere Lord Ralf Dahrendorf. Der bekannte liberale Soziologe beteiligte sich als Staatssekretär im Auswärtigen Amt aktiv an Debatten über die Ausgestaltung der „Dritten Dimension“ der NATO, wo das Klimathema im Wissenschaftsausschuss über den Klimatologen Prof. Herrmann Flohn (Bonn) schon zu einer Zeit, als die Wissenschaftlergemeinde noch beinahe einhellig vom Herannahen der nächsten Eiszeit überzeugt war, mit anthropogenen CO2-Emissionen in Zusammenhang gebracht wurde.
Wichtige Anstöße gingen auch von den US-Wissenschaftlern Roger Revelle und Charles Keeling sowie von dem später zum wichtigsten Kritiker der Klimahysterie gewandelten österreichisch-amerikanischen Atmosphärenphysiker Fred Singer aus. Im Prinzip war auch Günter Hartkopf (FDP), Staatssekretär in dem damals noch für den Umweltschutz zuständigen Bundesinnenministerium, darüber informiert, hat aber dazu nichts verlauten lassen. Da der Umweltschutz damals Angelegenheit der FDP war, haben sich die deutschen Sozialdemokraten um das Thema „Klima“ zunächst wenig gekümmert. Wegen ihrer engen Verzahnung mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) standen bei ihnen stattdessen Probleme der Arbeitswelt im Vordergrund.
In Deutschland war die Zeit nach der Ölkrise von 1973 geprägt von einer wachsenden Konfrontation zwischen der sozial-liberalen Regierung und der erstarkenden Anti-Atom-Bewegung. Beim Abwehrkampf des zuständigen sozialdemokratischen Forschungs- und Technologieministers Hans Matthöfer spielte das Klimathema aber so gut wie keine Rolle. Erst nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl wurde es auf Betreiben der deutschen Nuklearindustrie und ihr nahe stehender Naturwissenschaftler wie den Bonner Physiker Prof. Klaus Heinloth in Form einer „Warnung vor einer drohenden Klimakatastrophe“ durch die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) offensiv in die Medien gebracht. Das Cover des Spiegel Nr. 33/1986 mit dem Kölner Dom unter Wasser ging um die Welt und diente auch als Anlass zur Gründung des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
Diese Kampagne mündete in der Einsetzung der EnquêteKommission „Schutz der Erdatmosphäre“ durch den 11. und 12. Deutschen Bundestag. Ihr Vorsitzender war der als Lobbyist der Hanauer Nuklearindustrie (NUKEM) bekannte CDU-Abgeordnete Klaus Lippold. Die Kommission forderte schon vor der UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung (UNCED) 1992 in Rio de Janeiro eine Reduktion der CO2-Emissionen der Mitglieder der Europäischen Gemeinschaft (EG) um 20 bis 25 Prozent bis zum Jahre 2005 sowie eine Förderung „erneuerbarer“ Energien. Dem kam der Bundestag erstmals 1991 in Form des „Stromeinspeisegesetzes“ nach, das die Betreiber öffentlicher Stromnetze verpflichtet, jederzeit Strom aus Wasser-, Wind-, Sonnen- und Biomassekraftwerken abzunehmen.
Hinter dem Gesetz standen u.a. die Abgeordneten Peter Ramsauer (CSU) und Peter Paziorek (CDU), die beide als Betreiber von Mühlen mit Wasserkraftwerken beziehungsweise als Teilhaber von Windparks ein unmittelbares finanzielles Interesse an der Förderung „erneuerbarer“ Energien hatten. Das Gesetz erregte damals wenig Aufsehen, da es zunächst nur kleine Strommengen betraf. Als der Widerstand gegen die „Verspargelung“ der Landschaft durch riesige Windräder wuchs, hat der Bundestag 1996 noch unter Bundeskanzler Helmut Kohl und quer durch alle Fraktionen einen kleinen Zusatz zum Paragraphen 35 des Baugesetzbuches (BauGB) beschlossen. Dieser macht es möglich, Windräder, die höher sind als der Kölner Dom, schneller genehmigt zu bekommen als eine Frittenbude.
Schon im Vorfeld der Rio-Konferenz gab es Versuche, neben Sozialdemokraten auch die Grünen in den ÖIK einzubinden. Das geschah unter anderem auf einer Serie großzügig gesponserter Konferenzen, an denen neben Wirtschaftsvertretern des In- und Auslandes auch Spitzenpolitiker und bekannte Medienvertreter teilnahmen. 1998 gründete der Grüne Frank Asbeck die SolarWorld AG, die er 1999 erfolgreich an die Börse brachte. In die Zeit zwischen dem TschernobylUnglück und der Rio-Konferenz fällt auch die Gründung des Verbandes EUROSOLAR durch den inzwischen verstorbenen SPD-Abgeordneten Hermann Scheer und den Grünen-Abgeordneten Hans-Josef Fell. Das Ziel von EUROSOLAR: Die völlige Umstellung der Energieversorgung auf „Erneuerbare“ bis zum Jahre 2050, wenn nicht schon früher. Verschiedene Strömungen verbanden sich im Bundesverband Erneuerbare Energien (BEE) mit CDU/CSU-Politikern zu einer starken Lobby für den Ausbau des „Einspeisegesetzes“ zu einem „Gesetz für den Vorrang Erneuerbarerer Energien“ (EEG), das für 20 Jahre großzügige Einspeisevergütungen für Solar-, Wind- und Biomasse-Strom garantiert. Dessen erste Fassung wurde im März 2000 unter der ersten rot-grünen Regierung verabschiedet.
Das EEG ist alles andere als „zukunftsfähig“
ALS Rot-Grün 1998 die Regierungsverantwortung übernahm, hatte sich rund um die „erneuerbaren“ Energien längst ein dichtes politökonomisches Geflecht ausgebildet, in dem gelten soll: Nicht Angebot und Nachfrage, sondern maßgeschneiderte Gesetze und Paragraphen bestimmen Umsatz- und Gewinnchancen. Die niedersächsische FDP-Bundestagsabgeordnete Angelika Brunkhorst, selbst EEG-Lobbyistin, nannte die Durchschleusung des EEG durch Bundestag und Vermittlungsausschuss ein „Ganovenstück“, das von der Parlamentariergruppe von EUROSOLAR und vom weitgehend personengleichen Parlamentarischen Beirat des Bundesverbandes Erneuerbare Energien eingefädelt wurde. Vorsitzender dieses Gremiums war wiederum Hermann Scheer. Stellvertretende Vorsitzende war Michaele Hustedt, damals energiepolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag.
Neben den Abgeordneten Dietrich Austermann (CDU) und Hans-Josef Fell (Die Grünen) gehörten dem Gremium unter anderen die SPD-Abgeordneten Axel Berg, Marco Bülow und Christoph Matschie, die Unions-Abgeordneten Peter Harry Carstensen, Thomas Dörflinger, Josef Göppel und Peter Paziorek sowie Reinhard Loske, damals umweltpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag, heute grüner Wirtschaftssenator im Stadtstaat Bremen, an. Loske gehörte gleichzeitig dem Kuratorium der Düsseldorfer Naturstrom AG und dem Umweltrat der Nürnberger Umweltbank an. Dietrich Austermann hatte als Mitglied des Verwaltungsrates der bundeseigenen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) direkten Einfluss auf die Unterstützung von Wind- und Solarprojekten durch zinsgünstige Darlehen.
Im Detail legt das EEG fest, wie hoch die Stromnetzbetreiber und im Endeffekt die Verbraucher die gesetzlich erzwungene Abnahme teuren Wind- und Solarstroms vergüten müssen: Für Strom aus kleinen Wasserkraftwerken und Windrädern zum Beispiel bis zu über neun Eurocent je Kilowattstunde (KWh), das heißt etwa doppelt so viel wie die durchschnittlichen Stromerzeugungskosten in Deutschland, die 2007 bei 4,91 Eurocent lagen. Es kam zu einem Boom von Windkraftfonds, die bei Gutverdienern mit Hilfe des Versprechens einer Steuerersparnis von über 100 Prozent für eine absolut saubere, sichere und profitable Geldanlage innerhalb weniger Jahre sieben bis zehn Milliarden Euro mobilisierten und damit in Deutschland über 20.000 WKA gebaut haben. Einige der genannten Parlamentarier verdienen als Teilhaber von Wind- und Solarparks oder (diskreter) als Zeichner „grüner“ Investmentfonds an dem vom EEG ausgelösten künstlichen Boom der „Erneuerbaren“ mehr oder weniger kräftig mit. Dabei halten sich die Mitglieder der Regierungsparteien aus nahe liegenden Gründen eher diskret zurück, während sich Oppositionspolitiker offen als Windmüller zu erkennen geben, um sich als besonders „klimafreundlich“ zu profilieren.
Auslöser des Solar-Booms war die Anfang Juli 2004 vom Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat verabschiedete Novelle des EEG. Es gäbe sonst keinen Grund, in unseren von der Sonne nicht gerade verwöhnten Breiten massiv in teure Solaranlagen zu investieren. Bis zu 57,4 Eurocent je Kilowattstunde (KWh) kassierten Hausbesitzer, die sich Photovoltaik-Module auf ihr Dach montieren lassen, wenn sie den dort produzierten Strom ins öffentliche Netz einspeisen. Das ist etwa das 20-fache der Kosten von Strom aus Atom- oder Braunkohlekraftwerken, die in Deutschland etwa drei Cent je Kilowattstunde betrugen. Selbst Strom aus großen, von kommerziellen Betreibern auf Freiflächen aufgestellten Photovoltaik-Anlagen mussten die Netzbetreiber für 45,7 Cent je Kilowattstunde abnehmen.
Durch die im Mai 2008 vorgenommene Anpassung der EEG-Fördersätze hat sich an diesem Missverhältnis zwischen Aufwand und Ertrag wenig geändert. Statt die Einspeisevergütung für Solarstrom um mindestens 30 Prozent zu kürzen oder gar zu deckeln, wie das in anderen EU-Ländern geschehen ist, sah das novellierte EEG für die folgenden zwei Jahre nur eine Kürzung um acht Prozent vor. Deshalb war schon zwei Jahre darauf eine erneute Anpassung der Vergütungssätze, dieses Mal um 15 Prozent ab Juli 2011, erforderlich. Doch jede Ankündigung einer Kürzung der Förderung verleitete Investoren und Hausbesitzern nur zu noch größerer Eile bei der Installation von Solarpanelen. Die Solarlobby hat sich wieder einmal durchgesetzt – und zwar vor allem mit dem Argument, sie schaffe Zigtausende von Arbeitsplätzen in den östlichen Bundesländern.
Man braucht keine höhere Mathematik, um die Fadenscheinigkeit dieser Begründung zu erkennen. Nach Berechnungen des Bonner Volkswirtes Dieter Damian, die vom Wirtschaftsingenieur Manuel Frondel vom Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) bestätigt wurden, werden die kumulierten Kosten des subventionierten Ausbaus der Fotovoltaik in Deutschland schon im Jahre 2015 deutlich die Schwelle von 100 Milliarden Euro überschritten haben, obwohl die blau schimmernden Siliziumscheiben bis dahin höchstens drei Prozent zur Stromproduktion beitragen werden. Es käme billiger, jedem Arbeitslosen einfach ein Paket 500-Euro-Scheine in die Hand zu geben. Für das Jahr 2011 werden bereits Photovoltaik-Kosten von sage und schreibe 13 Milliarden Euro veranschlagt. Der Beitrag der Solarenergie zur deutschen Stromversorgung erreicht aber im Schnitt nicht einmal ein Prozent. Kein Wunder in einem Land, das normalerweise nicht von der Sonne verwöhnt wird.
Die Netzbetreiber und die vier großen Energieerzeugungsunternehmen E.ON, RWE, Vattenfall und EnBW sowie die mehr als 1.500 örtlichen Versorger, können diese Zusatzkosten bis jetzt wegen des geringen Wettbewerbs auf dem deutschen Strommarkt problemlos an die Endverbraucher weitergeben und dabei (wie die Kartellbehörden vermuten) sogar noch einiges aufschlagen. Die Stromverbraucher jedoch haben kaum Möglichkeiten, der staatlich verordneten Abzocke zu entgehen. Und die allgemeine Verteuerung des Stroms wird, ganz im Gegensatz zu der Behauptung Jürgen Trittins und Sigmar Gabriels, längerfristig unterm Strich höchstwahrscheinlich viel mehr Arbeitsplätze zerstören als neu schaffen. Neue Arbeitsplätze entstehen durch das EEG hauptsächlich in China, wo die meisten Solarzellen gefertigt werden.
Im volkswirtschaftlich parasitären ökologisch-industriellen Komplex bestimmen eben wie im militärisch-industriellen Komplex nicht Angebot und Nachfrage die Produktpalette und die Preise, sondern die Wünsche und Vorgaben von Berufspolitikern und Spitzenbürokraten in Form maßgeschneiderter Gesetze und Verordnungen. Diese fanden im Kalten Krieg ihre Begründung in der Bedrohung der freien Welt durch den Kommunismus. Seit den 70er Jahren muss nun die Angst vor einer Klimakatastrophe und der Erschöpfung begrenzter natürlicher Ressourcenvorräte als Rechtfertigung für massive politische Eingriffe in den Markt herhalten.
Das dahinter stehende statische Denken wurzelt in der europäischen Romantik und im Malthusianismus. Es unterstellt eine geschlossene Welt mit einem ein für allemal gegebenen Vorrat nicht erneuerbarer Ressourcen. Mit anderen Worten: Der Kuchen, von dem alle leben, kann nach dieser Sicht lediglich „sozial gerecht“ umverteilt, aber nicht vergrößert werden. Von daher die eigentlich absurde Idee, die heute lebenden Generationen in Form der Ökosteuer und der massiven Förderung „erneuerbarer“ Energien über Zwangsabgaben für die Lösung hypothetischer Probleme unserer Enkel und Urenkel zur Kasse zu bitten.
Anhänger des Freihandels in einer im wörtlichen wie im übertragenen Sinne offenen Welt gehen demgegenüber selbstverständlich davon aus, dass es künftigen Generationen infolge rascher Fortschritte der Technik wahrscheinlich erheblich besser gehen wird als heutigen. Und sie sind sich gewiss, dass sie das in den Stand versetzen würde, ihre Ressourcenprobleme viel eleganter und kostengünstiger zu lösen als wir. Daraus folgt: Es ist vernünftiger, in die Erforschung „sauberer“ Techniken der Nutzung fossiler Energieträger zu investieren als in die Rationierung des Ressourceneinsatzes und in die Förderung nicht marktfähiger Techniken der Nutzung „erneuerbarer“ Energien.
Das heißt noch nicht, der Staat solle sich unter keinen Umständen an der Markteinführung viel versprechender neuer Techniken durch „Anschubfinanzierung“ beteiligen. Denn immerhin hat auch unsere bislang kostengünstigste Primärenergie, die Atomenergie, in ihren Anfängen erheblich von Vorleistungen öffentlicher Hände profitiert. Von einer solchen sinnvollen „Anschubfinanzierung“ kann aber bei Techniken wie der Photovoltaik gar nicht die Rede sein. Es handelt sich bei der teuren, kostendeckenden Einspeisevergütung für Solarstrom vielmehr um die Dauersubventionierung einer nicht Verbraucherwünschen, sondern ausschließlich politischen Zielen dienenden Branche.
Diesen Fremdkörper in der Marktwirtschaft werden wir wohl so leicht nicht wieder loswerden. Denn sein Aufbau wurde von nationalen und internationalen Techno-Bürokratien mit Hilfe renommierter Denkfabriken schon in der zweiten Hälfte der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts geschickt und umsichtig in die Wege geleitet, um im Fall eines „Ausbruchs des Friedens“ bei einer eventuellen vorzeitigen Beendigung des Kalten Krieges nicht als ratlos und überflüssig dazustehen.
Zwar bleibt es nach wie vor unwahrscheinlich, dass es auch in Deutschland zu der bislang hauptsächlich von den Grünen verhinderten Renaissance der Atomenergie kommt. Zumindest eine Verlängerung der Laufzeiten der noch am Netz hängenden 17 deutschen Atomkraftwerke wurde aber von CDU und FDP mittelfristig als kaum vermeidbar dargestellt. Doch wurde die Rehabilitierung der friedlichen Nutzung der Kernenergie in den allermeisten politischen Verlautbarungen nicht wirtschaftlich, also mit den konkurrenzlos niedrigen Stromerzeugungskosten der Atommeiler von etwa 2,5 Eurocent je Kilowattstunde begründet, sondern nahezu ausschließlich ökologisch bzw. ökologistisch mit der Möglichkeit, dadurch CO2-Emissionen einzusparen und die Vorgaben des Kioto-Vertrags erfüllen zu können.
Die Atomwirtschaft sollte also wieder zum wichtigen Bestandteil des ökologisch-industriellen Komplexes werden, was – wie wir sehen werden – letztlich auch der Hauptzweck der seit den 70er Jahren in die Welt gesetzten dramatischen Warnungen vor einem drohenden „Klimakollaps“ war. In den USA unterstützten große, in der Atomenergie engagierte Konzerne wie General Electric, Duke Energies oder Exelon ganz offen Initiativen im Senat, fossile Energien durch eine Deckelung der CO2-Emissionen und/oder eine CO2-Steuer (Carbon Tax) gegenüber der Atomenergie künstlich zu verteuern.
Das „Energiekonzept“ der schwarz-gelben Bundesregierung unter Angela Merkel strebte folgenden Kompromiss zwischen der Atomwirtschaft und der Wind- und Solarbranche an: Als „Gegenleistung“ für die Verlängerung der Laufzeit der bereits abgeschriebenen Atomkraftwerke sollte die weitere Erforschung und Entwicklung „erneuerbarer“ Energiequellen durch die teilweise Abschöpfung der Extragewinne der Stromwirtschaft aus abgeschriebenen Atommeilern über einen Öko-Fonds großzügig gefördert werden. Überdies wollte der Staat durch die neu eingeführte Brennelementabgabe weitere Milliarden eintreiben. So wäre dafür gesorgt gewesen, dass die Energie teuer bleibt und politische Wunschkinder Chancen auf dem Markt behalten.
Allem Anschein nach war weniger die Entflechtung, sondern das Ergrünen der Deutschland AG angesagt. Statt sich für den Schutz des Eigentums, der Vertragsfreiheit und des Freihandels stark zu machen, bemühen sich auch Firmen anderer Wirtschaftszweige nach Kräften, in das Öko-Kartell aufgenommen zu werden. Die „Klimapolitik“ und ihre wichtigsten Instrumente wie die massive Subventionierung unsteter und unausgereifter alternativer Energiequellen sowie der europäische Emissionshandel, so kostspielig und nutzlos sie auch sein mögen, werden also den angekündigten Sparmaßnahmen im Berliner Bundeshaushalt und im Brüsseler EU-Haushalt vermutlich nicht zum Opfer fallen. Im Gegenteil: Nach dem Schuss vor den Bug, den die Politik der politischen Integration Europas „von oben“ in Form der Ablehnung des EU-Verfassungsvertrags von Lissabon durch die Mehrheit der französischen und niederländischen Wähler bekommen hat, musste die „Klimapolitik“ der gesamten Politiker-Kaste mehr denn je als Rettungsanker erscheinen. Der Emissionshandel und die hektischen Bemühungen zur Rettung des durch die Schuldenkrise angeschlagenen Euro werden zum Ersatz für die fehlende Bestimmung der europäischen Identität.
Das Klimapaket der EU und das deutsche Energiekonzept
NACH DEM AM 23. Januar 2008 beschlossenen Energie-Klimapaket der EU soll die EU bis zum Jahre 2020 ihre Emissionen von „Treibhausgasen“ um 20 und bis 2050 um 80 Prozent senken. Bis dahin soll die Stromversorgung fast zu 100 Prozent auf „treibhausgasarme“ Energiequellen – das heißt auf „erneuerbare“ Energien und/oder die Atomenergie – umgestellt sein. Wichtigster Hebel zur Ansteuerung dieses Ziels soll die Rationierung des CO2-Ausstoßes durch Quoten und den Handel mit Emissionsrechten sein.
Zwischenetappe soll eine zwanzigprozentige Reduktion des Energieverbrauchs bis 2020 sein, und zwar hauptsächlich durch massive Investitionen in die Wärmedämmung von Gebäuden. Bis 2050 soll der Energieaufwand für die Gebäudeheizung um 90 Prozent reduziert werden. Ursprünglich hatte die EU in den internationalen Verhandlungen über ein Folgeabkommen zum 2012 auslaufenden KiotoAbkommen über die Reduktion von „Treibhausgasen“ sogar eine dreißigprozentige Senkung ihres CO2-Ausstoßes bis 2030 angeboten – allerdings nur unter der Bedingung, dass andere Unterzeichner des Kioto-Abkommens nachziehen.
Wegen der ungelösten Frage einer Laufzeitverlängerung für Kernkraftwerke ließ sich die deutsche Bundesregierung mit der Umsetzung der EU-Beschlüsse Zeit. Am 6. September 2010 haben das Bundeswirtschafts- und das Bundesumweltministerium schließlich den Entwurf ihres seit langem angekündigten Energiekonzepts vorgelegt. Das knapp vierzigseitige Schriftstück sollte vorgeblich den Weg in eine „umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung“ weisen. Als ein wichtiges Mittel, diesem Ziel näher zu kommen, galt die nach hartem Ringen beschlossene Verlängerung der Laufzeit der 17 deutschen Kernkraftwerke um durchschnittlich 12 Jahre. Einige Wirtschaftsverbände zeigten sich darob mehr als befriedigt.
Doch ging es der Bundesregierung unter Bundeskanzlerin Angela Merkel tatsächlich um etwas anderes: „Beim Energiemix der Zukunft sollen die erneuerbaren Energien den Hauptanteil übernehmen.“ Der Löwenanteil soll dabei riesigen Windrädern auf dem Land und auf hoher See zukommen. Auch der Beitrag der Photovoltaik soll kräftig wachsen. Hier enthält das Papier allerdings keine konkreten Zahlenangaben, sondern lediglich Anregungen für eine Senkung der Kosten der teuersten aller „alternativen“ Stromerzeugungsmethoden.
Das tatsächliche Leitbild der deutschen Energiepolitik ist also nicht die kostengünstige und sichere Bereitstellung von Energie, sondern die Verwirklichung des grünen Traums von einem paradiesischen „Solarzeitalter“. Auf dem Weg dorthin spiele die Kernenergie lediglich die Rolle einer „Brückentechnologie“. Und selbst diese Rolle hat Bundeskanzlerin Angela Merkel im März 2011 nach der durch einen beispiellosen Tsunami ausgelösten Reaktorhavarie im japanischen Kernkraftwerk Fukushima sofort zur Disposition gestellt.
Die Leistung von Windkraftanlagen auf hoher See (Offshore) soll bis zum Jahre 2030 mit Hilfe von Investitionen in der Größenordnung von 75 Milliarden Euro auf 25 Gigawatt (Milliarden Watt) ausgebaut werden. An Land soll die WKA-Kapazität vornehmlich durch „Repowering“, also den Ersatz bestehender WKA durch weitaus größere erweitert werden. Zu diesem Zweck sollen dem Schutz des Privateigentums dienende bau- und planungsrechtliche Hürden beseitigt werden. Das legt folgende Fragen nahe:
Wieso gelten WKA, die höher sind als der Kölner Dom, als „umweltschonend“, obwohl sie wie keine andere Technik zuvor die gewachsene Kulturlandschaft nachhaltig zerstören, vom Aussterben bedrohte Greifvögel und Fledermäuse töten, die Gesundheit der Anwohner durch Infraschallemissionen und Schattenwurf gefährden sowie Immobilien in Sichtweite der Monster unverkäuflich machen?
Wieso gelten größere Windräder als effizienter, obwohl ihr Gewicht mit der Dreierpotenz des Flügelradius zunimmt?
Wie kann der von Offshore-Windparks erzeugte Strom zu den energieintensiven Industrien im Süden der Republik transportiert werden, ohne die letzten Naherholungsgebiete in triste Industrielandschaften zu verwandeln?
Wieso gelten Windparks als ausbaufähig und zukunftsträchtig, obwohl sie wegen ihrer unsteten Arbeitsweise bislang nachweislich kein einziges konventionelles Kraftwerk überflüssig machen konnten?
Und nicht zuletzt: Warum braucht Deutschland überhaupt ein Konzept für einen kostspieligen Totalumbau der Energieversorgung?
Dazu muss man wissen, dass Deutschland Jahrzehnte lang über das zuverlässigste Stromversorgungsnetz der Welt verfügte. Stromausfallzeiten überstiegen im Schnitt übers Jahr keine Viertelstunde.
Genügte es also nicht, den vorhandenen Mix verschiedener Energieträger vorsichtig veränderten Marktbedingungen anzupassen?
Die offizielle Antwort: Alle Unannehmlichkeiten und Widersprüche müssen in Kauf genommen werden, um „klimaschädliche“ CO2-Emissionen zu vermeiden. Bis zum Jahr 2020 sollen im Vergleich zu 1990 um 40 und bis 2050 mindestens 80 Prozent der so genannten Treibhausgasemissionen eingespart werden. Die Merkel-Regierung hält also stur an der von Sektierern in die Welt gesetzten Fiktion fest, die Entwicklung der (nicht messbaren!) Durchschnittstemperatur der Erde hänge in erster Linie mit dem CO2-Gehalt der Luft zusammen. Dabei stört es Frau Merkel und ihre Minister offenbar nicht, dass Windräder unterm Strich keine einzige Tonne CO2 einsparen helfen, weil sie „Schattenkraftwerke“ für windarme Zeiten benötigen.
Deutschland scheint Dank weitgehend gelungener Selbstgleichschaltung seiner Mainstream-Medien auch das einzige Land der Welt zu sein, dessen politische Klasse nicht zur Kenntnis nehmen möchte, dass den Warnungen vor einer drohenden „Klimakatastrophe“ seit der skandalträchtigen Aufdeckung von Datenmanipulationen im Umkreis des „Weltklimarates“ IPCC jegliche wissenschaftliche Begründung fehlt.
Aber um das Klima, was immer auch darunter zu verstehen sein mag, geht es beim Energiekonzept der Bundesregierung ohnehin nur vordergründig. Es lässt sich leicht zeigen, dass es in Wirklichkeit darum geht, die Vorstellungen jener Gruppierungen umzusetzen, die zwanzig Jahre nach dem Zusammenbruch des „Ostblocks“ noch immer von der Überlegenheit der Planwirtschaft überzeugt sind. So soll der Primärenergieverbrauch in Deutschland gegenüber dem Jahr 2008 um 20 und bis 2050 gar um 50 Prozent sinken. Das erfordert eine jährliche Steigerung der Energieproduktivität von durchschnittlich über zwei Prozent. Solche Steigerungsraten hat es selbst zu Zeiten des deutschen „Wirtschaftswunders“ niemals gegeben.
Kein Problem, mögen sich die Autoren des Energiekonzepts gesagt haben, man muss so etwas nur richtig wollen. Das ist allerdings schwierig, weil die Möglichkeiten zur Steigerung der Energieproduktivität gerade in energieintensiven Industriezweigen wie der Chemie weitgehend ausgereizt sind.
Die größten Energieeinsparpotenziale liegen im Wohngebäudebestand, auf den 40 Prozent des Energiebedarfs entfallen. Drei Viertel des Bestandes von 17 Millionen Wohngebäuden seien vor dem Erlass der ersten Wärmeschutzverordnung im Jahre 1979 errichtet worden, stellen die Verfasser des Energiekonzepts fest. Um der politischen Vorgabe eines nahezu „klimaneutralen“ Gebäudebestandes im Jahre 2050 näher zu kommen, müsse die Rate der energetischen Gebäudesanierung von jährlich ein auf zwei Prozent verdoppelt werden.
Das aber ist offenbar leichter gesagt als getan. Die Wärmedämmung eines einzigen Ein- oder Zweifamilienhauses gemäß der geltenden Energieeinsparverordnung (EnEV) kann leicht über 100.000 Euro verschlingen. Die dadurch erzielten Energieeinsparungen rechnen sich aber erst nach zwanzig bis fünfzig Jahren. Kein privater Unternehmer einmal abgesehen von adeligen Waldbesitzern, würde freiwillig Investitionen mit einer so langen Amortisationszeit tätigen. Insbesondere älteren Hausbesitzern in ländlichen Gebieten, die wegen der demografischen Entwicklung immer öfter keine Nachnutzer finden und bei potenziellen Geldgebern ohnehin nur selten als kreditwürdig gelten dürften, sind solche Vorgaben nicht zumutbar. Sie hätten wohl auch vor Gericht (noch!) gute Karten, denn nach dem im MaastrichtVertrag der EU verankerten Prinzip der Verhältnismäßigkeit kann niemand zu Investitionen gezwungen werden, die sich nicht rechnen. Nach der staatsstreichartigen Außerkraftsetzung wichtiger Bestimmungen des Maastricht-Vertrages bei der Einrichtung des europäischen Schutzschirms für überschuldete EU-Mitgliedsstaaten am 9. Mai 2010 ist aber gerade das nicht mehr sicher.
Das Gebot der Verhältnismäßigkeit würde also fanatische „Klimaretter“ auf längere Sicht kaum von Zwangsmaßnahmen bis zur entschädigungslosen Enteignung abhalten, um ihrem Ziel der „Nullemission“, auf Deutsch: dem Nichts, näher zu kommen. Der in der hessischen Universitätsstadt Marburg von einem grünen Bürgermeister verordnete Solarzwang für Hausbesitzer hat gezeigt, wie „Klimaretter“ ticken. Dieser wurde lediglich wegen des Einspruchs des zuständigen Gießener Regierungspräsidiums nicht in Kraft gesetzt. Wie lange werden deutsche Richter und Regionalregierungen privaten Eigentumsrechten noch Vorrang vor Öko-Utopien einräumen?
Zu tiefen Konflikten mit privaten Eigentumstiteln dürfte vor allem der Bau von „Stromautobahnen“ zwischen den in Norddeutschland beziehungsweise in der Nordsee bereits bestehenden und noch geplanten Windparks und großen industriellen Stromverbrauchern beziehungsweise alpinen Pumpspeicher-Kraftwerken im Süden führen. Das gesamte deutsche Stromnetz muss mit Milliarden-Aufwand um- und ausgebaut werden, um die sehr unregelmäßige Stromeinspeisung durch Wind- und Solarparks ausgleichen zu können. Um die Vorgaben der „Klimapolitik“ umzusetzen beziehungsweise den Energieverbrauch an das naturgemäß stark schwankende Angebot „erneuerbarer“ Energien anzupassen, soll das Verhalten der Energieverbraucher mit Hilfe „intelligenter“ Stromnetze („smart grids“) ferngesteuert werden. Das heißt: Sie sollen ihre Heizungen, Geschirrspüler, Waschmaschinen oder Elektroherde nicht mehr dann anschalten, wenn sie sie brauchen, sondern wenn gerade einmal genügend Wind weht.
Angela Merkels Konzept einer achtzigprozentigen Reduktion des CO2-Ausstoßes entpuppt sich bei näherem Hinsehen als Selbstmordprogramm. Würde der am 6. September veröffentlichte Entwurf des „Energiekonzepts“ umgesetzt, dann ginge nicht nur der Aluminiumindustrie, die Deutschland bereits weitgehend verlassen hat, sondern auch der Stahlindustrie und einer Reihe weiterer wichtiger Grundstoffindustrien wie der Kupferindustrie und der Chlorchemie buchstäblich die Luft aus. Die für ein Industrieland lebenswichtige Stahlindustrie hätte in Deutschland buchstäblich keine Geschäftsgrundlage mehr. Bei der Herstellung von einer Tonne Rohstahl aus Eisenerz nach dem modernsten Verfahren mit einem Wirkungsgrad von 97 Prozent entstehen nun einmal unweigerlich 1,8 Tonnen Kohlenstoffdioxid. Daran kann niemand etwas ändern, weil die Hochöfen dazu dienen, dem Eisenoxid des Erzes seinen Sauerstoff zu entziehen, um diesen mit dem Kohlenstoff der Kokskohle zu verbinden und als CO2 auszuscheiden. Um die Vorgaben der Politik umzusetzen, bleiben den Stahlerzeugern nur zwei Wege: Entweder ihre Produktion um 80 Prozent zu drosseln und sich dadurch selbst abzuschaffen oder sich im Rahmen des Europäischen Emissionshandelssystems ETS gegen teures Geld CO2-Emissionslizenzen (Zertifikate) zu besorgen.
Bislang hat die Stahlindustrie, ähnlich wie andere energieintensive Industriezweige, diese Sackgasse nur durch Ausnahmeregelungen beim Emissionshandel und bei der Umlage der Kosten der „Erneuerbaren“ vermeiden können. Doch dadurch wird die „Energiewende“ für Normalverbraucher und nicht begünstigte Wirtschaftszweige umso teurer. Der ehemalige Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, Prof. Dr. Dieter Ameling, zeigt deshalb großes Verständnis für den letzten größeren deutschen Stahlkonzern Thyssen-Krupp, der gerade begonnen hat, sich mittelfristig von Deutschland zu verabschieden.
Die sich abzeichnende Desindustrialisierung Deutschlands, so Dieter Ameling weiter, sei kein unbeabsichtigter Kollateralschaden der „Klimapolitik“, sondern gewollt. Schon im Jahre 2001 hat der vom Bundesumweltministerium eingesetzte Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (SRU) in einem Gutachten gefordert, die Abwanderung energieintensiver Industrien und die Ausweitung von Stromimporten als unvermeidliche Begleiterscheinung der „ökologischen Modernisierung“ zu betrachten. In den Eckpunkten zum Energiekonzept wird überdies wie selbstverständlich auf Biomasse bzw. Biosprit-Importe aus Südasien und Brasilien sowie auf die Nutzung ausländischer (meist österreichischer) Pumpspeicher-Kraftwerke für den Ausgleich der stark schwankenden Windstromproduktion verwiesen. Das bedeutet: Ähnlich wie die Autarkie-Vorstellungen der Nazis (in denen übrigens Windräder auch schon eine Rolle spielten) können die Deutschen also auch ihre Träume von einem paradiesischen „Öko-Zeitalter“ nur auf Kosten der übrigen Welt verwirklichen. Nur hat sich inzwischen das Kräfteverhältnis verändert. Die asiatische und amerikanische Konkurrenz grinst über diese Pläne und denkt selbstverständlich nicht daran, dem Selbstmordkurs der deutschen „Elite“ zu folgen.
Dummheit ist gefährlicher als Bosheit
HAT DIE TATSACHE, dass die Deutschen sich unangefochten als Weltmeister beim Bau von Windkraftwerken feiern können, nicht etwas mit dem schlechten Abschneiden unseres Landes bei der PISA-Studie zu tun? Die Beobachtung legt es nahe, zumindest diese Frage zu verneinen: Auch Menschen mit einem hohen Intelligenzquotienten und guter Schulbildung werden von dem in Deutschland und anderen Teilen Westeuropas um sich greifenden dümmlichen Gutmenschentum erfasst.
Dummheit oder Klugheit werden nicht allein durch den IQ bestimmt. Seit jeher gilt: Führungskraft hängt nicht unbedingt vom IQ einer Person ab, sondern vielmehr davon, ob sie weiß, was und wohin sie will, und vom Mut, von der Zähigkeit und der Unbeirrtheit, mit der sie zustimmungsfähige Ziele verfolgt. Als einer der führungsstärksten US-Präsidenten ging der ehemalige B-Rollen-Schauspieler Ronald Reagan in die Geschichte ein. Reagan galt vor dem Ausbruch seiner Alzheimer-Erkrankung als begnadeter Kommunikator. Er beeindruckte selbst jene, die ihm nicht freundliche gesonnen waren, durch die mobilisierende Kraft seiner Reden und seine entschlossene Politik gegenüber klar definierten Gegnern und Hindernissen, selbst wenn er sich dabei gelegentlich irrte.
In der Tat: Mutiges Handeln steckt an und schafft Vertrauen. Auf der anderen Seite können aber Angst, Verzagtheit, Misstrauen und politische Dummheit offenbar ebenso ansteckend sein wie Mut und Klugheit. Auch sie können Menschen aller Intelligenz- und Erziehungsniveaus mitreißen. Die unterschiedliche Begeisterung, mit der die Präsidenten Putin und Bush in Berlin, Mainz und anderen westeuropäischen Hauptstädten empfangen wurden, sprechen Bände.
Das zeigt, wie der Konformitätsdruck der political correctness selbst intelligente Menschen dazu bringt, den eigentlich durchsichtigen Argumenten politischer Rattenfänger auf den Leim zu gehen. Amerikanische Kommentatoren sprechen bereits von einem intellectual gap zwischen den USA und Europa (so Fred Kempe im Wall Street Journal Europe vom 1. April 2003). Überspitzt ausgedrückt, könnte man sagen: die bequem und tumb an der (geschenkten) Konsens- und Parteienkartelldemokratie klebenden Europäer verstehen nicht mehr, warum ihnen gewisse US-amerikanische think tanks mit ihren Analysen der gegenwärtigen heiklen Weltlage intellektuell weit überlegen sind.
Ein Beispiel dafür ist die Analyse der buchstäblich explosiven Konsequenzen des youth bulge, der riesigen Zahl ehrgeiziger, aber beschäftigungs- und perspektivloser junger Männer und für ihre Sklavenrolle überqualifizierter junger Frauen in den despotisch regierten, wirtschaftlich und sozial stagnierenden islamischen Ländern, die einen beinahe um die ganze Alte Welt reichenden Gürtel des Elends bilden, der sich vor den Segnungen von Individualisierung und Globalisierung verschließt (vgl. Heinsohn, 2003). Der riesige Überschuss junger Männer in den islamischen Ländern führt zu wachsenden Migrationsströmen in Richtung Westeuropa, wo die demografische Lage genau umgekehrt ist. Westeuropa ist wegen seines Defizits von Männern im wehrfähigen Alter praktisch nicht mehr in der Lage, sich militärisch zu verteidigen.
Aber auch für die intellektuelle Selbstbehauptung fehlen dem alten Europa zunehmend die Waffen, seit es von seinem christlichen Erbe Abstand nimmt. Wo der Glaube schwindet, macht sich Dummheit breit. Denn vor der Dummheit schützt uns weder die Anhäufung von immer mehr Wissen noch die Züchtung superintelligenter Menschen, sondern letzten Endes nur die Gottesfurcht. Darauf hat der wegen seines Widerstands gegen den Nazismus hingerichtete evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer in seinen im Gefängnis geschriebenen Briefen hingewiesen: „Dummheit ist ein gefährlicherer Feind des Guten als Bosheit. Gegen das Böse läßt sich protestieren, es läßt sich bloßstellen, es läßt sich notfalls mit Gewalt verhindern, das Böse trägt immer den Keim der Selbstzersetzung in sich, indem es mindestens ein Unbehagen im Menschen zurückläßt. Gegen die Dummheit sind wir wehrlos.(…)Es gibt intellektuell außerordentlich bewegliche Menschen, die dumm sind, und intellektuell sehr Schwerfällige, die alles andere als dumm sind. (…) Dabei gewinnt man weniger den Eindruck, daß die Dummheit ein angeborener Defekt ist, als daß unter bestimmten Umständen die Menschen dumm gemacht werden, bzw. sich dumm machen lassen.(…) Das Wort der Bibel, daß die Furcht Gottes der Anfang der Weisheit sei, sagt, daß die innere Befreiung des Menschen zum verantwortlichen Leben vor Gott die einzige wirkliche Überwindung der Dummheit ist.“ (1951, 2002, S. 14ff.)
Bonhoeffer hat auch darauf hingewiesen, dass Dumme gemeinhin nicht unglücklich sind. Im Unterschied zum Bösen sei der Dumme „restlos mit sich selbst zufrieden; ja, er wird sogar gefährlich, indem er leicht gereizt zum Angriff übergeht.“ Erst in Verbindung mit der Dummheit wird also das jedem Menschen innewohnende Böse gefährlich. Das lässt sich gut am Vordringen misanthropischer grüner Ideen in der Energiepolitik beobachten. Die inzwischen weit fortgeschrittene brutale Verschandelung unserer Kulturlandschaft durch immer größere und zahlreichere Windräder ist das sichtbarste Zeichen der an die Macht gelangten Dummheit. Die frühere grüne nordrhein-westfälische Umweltministerin Bärbel Höhn hat das schon vor Jahren mit dem ebenso dummdreisten wie verräterischen Spruch Windräder sind unsere Kathedralen! dokumentiert.
Wie konnte es nur so weit kommen? Die Beantwortung dieser Frage hängt selbstverständlich vom jeweiligen politischen Blickwinkel ab. Naheliegend erscheint der Standpunkt des „Mannes auf der Straße“, der davon ausgeht, dass Politik ohnehin ein schmutziges Geschäft ist und den Charakter verdirbt. Dass Berufspolitiker sich nach etlichen lautstarken Redeschlachten und stillschweigenden Kuhhändeln am Ende zu einem Konsens gefunden haben, dessen Umsetzung einige betuchte Anleger reicher macht, das Volk als ganzes aber ins Verderben führt, verwundert sie nicht weiter. Intellektuell sehr viel anspruchsvoller (und daher weniger mediengängig) ist die Position der Radikal-Liberalen oder Libertären, die den Berufspolitikern ebenfalls vorwerfen, sich in der Tendenz nur noch mit Problemen zu beschäftigen, die sie durch Wissensanmaßung selbst erzeugt oder (wie den angeblich drohenden „Klimakollaps“) frei erfunden haben, um nicht als überflüssig zu erscheinen und um neue Geldquellen für ihren Gestaltungsdrang (und ihre Beamtenpensionen) aufzutun.
Gegenüber der zeitgeistigen außerparlamentarischen Bewegung ATTAC, die bei aller Kritik am verkommenen Ränkespiel der Parteiendemokratie gedankenlos davon ausgeht, die „große“ Politik und der Wohlfahrtsstaat seien etwas ganz natürliches und die Privatwirtschaft müsse zum Anhängsel der Politik werden, haben die Libertären sicher recht, wenn sie davon ausgehen, dass dem Markt sowohl die logische als auch die historische Priorität vor dem Staat zukommt und dass die Existenz des Staates, wie schon Ludwig Erhards akademischer Lehrer Franz Oppenheimer erkannte, auf gewaltsame Machtergreifung und Eroberung zurückgeht.
Ein Lehrbuchbeispiel dafür ist die Unterwerfung der Gallier zunächst durch Julius Caesar und später durch die Franken unter Chlodwig. In der Tat dürfte es bei unvoreingenommener Betrachtung schwierig sein, in Friedenszeiten einen einzigen triftigen Grund für eine politische Organisation der Gesellschaft oberhalb des kommunalen und kantonalen Niveaus zu finden. Dass die Menschen überhaupt je begonnen haben, „große“ Politik zu machen, könnte nur auf Einflüsterungen des Teufels zurückgeführt werden, gäbe es nicht Oppenheimers historische Erklärung.
Aber wie kommt man wieder zur Priorität des Marktes zurück, wenn das in Europa in den Religionskriegen des 17. Jahrhunderts geschaffene Monopol der Politik (zunächst in der milderen Form der absoluten Monarchie und später in Form ihres tendenziell totalitären Gegenstücks, der zentralisierten Republik) erst einmal fest etabliert ist? Wird Politik nicht zum Schicksal, dem sich auch jene unterwerfen müssen, die ihre logische Priorität abstreiten? Machen sich die wenigen in Deutschland noch verbliebenen standhaften Verteidiger der individuellen Freiheit also die Antwort zu leicht, wenn sie einfach davon ausgehen, als „nachhaltig“ deklarierte Kapitalvernichtungsanlagen wie Windräder bewiesen, dass Deutschland ein besetztes Land ist, okkupiert von einer Ausbeuterklasse aus Berufspolitikern, wohlversorgten Beamten, Staatskapitalisten, politisch korrekten Verbandsfunktionären und Medien-Lackaffen? Verdankt denn die rot-grüne Bundesregierung in Berlin ihre Macht nicht allgemeinen, freien, unmittelbaren und geheimen Wahlen? Waren die Kreise, die diese Regierung repräsentiert, 1968 nicht mit der Parole „Die Phantasie an die Macht!“ auf die Straße gegangen? Und entspricht die daraus hervorgegangene industriemäßige Umgestaltung unserer Kulturlandschaft – Ästhetik hin, Ästhetik her – etwa nicht dem Volkswillen?
Wen und was legitimieren Wahlen?
WER SO FRAGT, geht freilich – im Einklang mit dem Zeitgeist und der verordneten Staatsräson – davon aus, Wahlen zwischen politischen Parteien machten das Wesen einer demokratischen Republik aus. Die Erfinder der Demokratie im alten Athen sahen das allerdings anders. Denn Wahlen gab es dort nur in Kriegszeiten, wenn besondere Führungsqualitäten verlangt wurden, die nur Profis des politischen Geschäfts mitbringen konnten. Wahlen assoziierten die Athener deshalb spontan nicht mit der Demokratie, der Volksherrschaft, sondern mit Aristokratie beziehungsweise Oligarchie, der exklusiven Herrschaft weniger, die ihre Legitimation aus einer durch Wahlen bekräftigten Feindbildbestimmung herleiteten. Bedeutet doch politisches Wählen im Wortsinne gerade nicht die möglichst breite Einbeziehung der Bürger in die öffentlichen Angelegenheiten, sondern Auswählen, wenn nicht Auserwählen mit dem Gegenstück: Ausgrenzen, Diskriminieren.
Mit dem Begriff der Demokratie hingegen verbanden die alten Athener die zeitlich streng befristete Besetzung öffentlicher Ämter nach dem Zufallsprinzip. Die Verlosung der Sitze im Rat der 500 und anderer Gremien, die Begrenzung der Amtszeit der Magistrate auf höchstens ein Jahr und das Verbot, die gleiche Funktion zweimal hintereinander auszuüben, gab zumindest den etwa 30.000 Vollbürgern Athens reale Chancen, wenigstens einmal in ihrem Leben öffentliche Verantwortung ausüben zu können. Dabei sahen die Athener beim jeweiligen Ergebnis des Losens mit schwarzen und weißen Bohnen das Wirken der Götter im Spiel. Die durch den Zufall bestimmten politischen Funktionsträger erhielten dadurch eine höhere Weihe, eine besondere Legitimität (und Autorität) gegenüber von Menschen gewählten Amtspersonen.
Solche Losverfahren gab es nur im demokratischen Athen, während es im oligarchisch regierten Sparta ausschließlich Wahlen gab. Ausnahmen vom Losverfahren und dem damit verbundenen raschen Wechsel der politischen Verantwortungsträger gab es in Athen nur in Kriegszeiten. So konnte Perikles vierzehnmal in Folge als Stratege wiedergewählt werden. Aber selbst in Kriegszeiten verließen sich die Athener nur zum Teil auf das Urteil der Wähler, sondern befragten das Orakel von Delphi, dessen zweideutige Sprüche, wie wir heute wissen, allerdings nicht selten durch hinterlistige Eingriffe der Priesterschaft verfälscht wurden.
Noch Aristoteles, der zur Zeit des demografischen und politischmilitärischen Niedergangs Athens wirkte, sah in Wahlen wie selbstverständlich eine Begleiterscheinung, wenn nicht die Grundlage von Oligarchien, während er die Demokratie mit Losverfahren assoziierte. Grundsätzlich hielt er die Demokratie gegenüber der Monarchie für eine Form der Dekadenz, wobei er vermutlich richtig lag. Was die tieferen religiösen Voraussetzungen der Idee von Demokratie sind, ist umstritten. Mein befreundeter Kollege Hannes Stein von der Tageszeitung Die Welt vermutet den Ursprung der Demokratie nicht im Polytheismus der Griechen, sondern schon bei den Israeliten. Er sieht also im Monotheismus sowohl jüdischer als auch christlicher Prägung kein grundsätzliches Hindernis für das Aufkommen der Demokratie. Der Katholizismus hat jedenfalls nicht die Entwicklung der parlamentarischen Demokratie begünstigt, sondern eher die konstitutionelle Monarchie. Gerade die Monarchie habsburgischen Typs hat sich in der Geschichte als zuverlässigerer Garant individueller Freiheit erwiesen als die meisten Formen parlamentarischer Demokratie.
Dahinter steht das Problem, wieweit das Mehrheitsprinzip Toleranz gegenüber den Anliegen gesellschaftlicher Minderheiten gewährleisten kann. Bedürfen Toleranz und gesellschaftlicher Dialog der Anerkennung einer Vielfalt von „Wahrheiten“ oder setzen sie nicht im Gegenteil die vom Monotheismus geforderte Anerkennung des Alleinanspruchs der Wahrheit gegenüber Mythen voraus? Nur Katholiken und Muslime haben auf diese Fragen klare Antworten, die allerdings weit auseinander liegen.
Zumindest hilft der Ursprung der Demokratie in Losverfahren bei der Klärung der Frage, warum die Entwicklung freier Märkte, die die mehr oder weniger rationalen Entscheidungen einer Vielzahl von Personen widerspiegeln, heute spontan oft als demokratischer erscheint als die immer schwerer nachvollziehbaren Entscheidungen von Parlamenten, Regierungen oder Gremien von „Sachverständigen“. Niemand sollte sich darüber wundern, dass auch Wähler der Grünen mit Vorliebe bei Discountern wie ALDI oder Lidl einkaufen. Die Bürger entscheiden als Kunden eben anders als die von ihnen als Wähler formal legitimierten Gremien. Nur als Kunden können sie ihrem persönlichen Willen und Geschmack beziehungsweise ihrer KostenNutzen- oder Übelabwägung Geltung verschaffen.
Mit anderen Worten: Wirklich wählen können die Menschen in unseren „reifen“ Demokratien nur im Supermarkt. Bei politischen Wahlen hingegen bekommen sie selten, was sie eigentlich wollen. Sie müssen eine Katze im Sack kaufen, weil sie Parteiführungen einen Freibrief ausstellen, Koalitionsvereinbarungen auszuhandeln, in denen ihre Wahlprogramme, sofern sie überhaupt gelesen wurden, kaum noch wieder zu erkennen sind. Und das, um entweder, wie gehabt, weiter zu wursteln oder sich und ihr Land in ideologisch begründete Energie- oder Agrarwende-, Emissionshandels- und andere Öko-Umbau-Revolutions-Abenteuer zu stürzen, um damit ihre Herrschaft längerfristig abzusichern.
Freilich hängt der überragende Einfluss von Berufspolitikern und politischen Parteien in Deutschland eindeutig mit dem Modus der Verhältniswahl zusammen. Schon mit einem Mehrheitswahlsystem würde es im Prinzip leichter, politische Blockadesituationen zu vermeiden, die Bürger vor die Entscheidung zwischen klarer konturierte Alternativen zu stellen und rascher Machtwechsel herbeizuführen. Noch besser als Wahlen könnten Losverfahren in Friedenszeiten als Brücke zwischen Demokratie und Marktwirtschaft dienen. Verfassungsrechtlich gäbe es dafür keine unüberwindbaren Hindernisse, denn bei einem nach einer Art Lotterie zusammengesetzten Parlament handelte es sich noch immer eindeutig um eine Form repräsentativer Demokratie, wie sie im deutschen Grundgesetz und im Europäischen Verfassungsvertrag vorgesehen ist. Demgegenüber ist dort die Rolle politischer Parteien längst nicht so klar bestimmt. Es ist auch mittelfristig durchaus vorstellbar, dass das schwammig begründete „Parteienprivileg“ im deutschen Grundgesetz am Ende geopfert wird, wenn sich der rasch fortschreitende „Politikverdruss“ braver Bürger einmal zur offenen politischen Krise des Parteienstaates auswächst.
Durch die Einführung von Losverfahren, wie sie die linksliberale britische Politikwissenschaftlerin Barbara Goodwin 1993 in ihrem utopischen Buch Justice by Lottery (Gerechtigkeit durch Loseziehen) skizziert hat, ließe sich wohl am wirksamsten vermeiden, dass die Demokratie für die bei Wahlen unterlegenen zur Diktatur wird, weil 51 Prozent der Wähler die restlichen 49 Prozent der Stimmbürger und die rasch wachsende Zahl bewusster Nichtwähler zwingen könnten, gegen ihre eigenen Werte und Interessen zu handeln. Es muss gewährleistet bleiben, dass die Wahrung individueller Freiheit und Verantwortung in Zweifelsfall als höher bewertet wird als die Einhaltung formaldemokratischer Spielregeln, die ohnehin von Zeit zu Zeit und von Land zu Land unterschiedlich ausfallen können. Wahlen und selbst die Demokratie als solche können nicht als Dogma gelten. Das sollte nach der formaldemokratisch völlig legalen und legitimen Machtergreifung Hitlers in Deutschland ohnehin klar sein. Sehr lesenswert ist in diesem Zusammenhang das zuerst 2003 erschienene Buch Das Ende der Freiheit? des in Bombay geborenen Chefredakteurs von Newsweek International (Zakaria, 2007).
In bestimmten historischen Situationen können Wahlen möglicherweise eine politische Dynamik im Sinne des Aufbrechens überkommener repressiver, patriarchalischer Clan-Strukturen und der sukzessiven Anerkennung individueller Freiheitsansprüche in Gang setzen. In „reifen“ Demokratien jedoch ist die Frage der Begrenzung des politischen Einflusses auf Wirtschaft und Gesellschaft schon deshalb wichtiger, weil es unwahrscheinlich ist, dass sich jemals demokratische Mehrheiten klar für die freie Marktwirtschaft beziehungsweise die kapitalistische Wirtschaftsform aussprechen werden, obwohl diese nachweislich das einzige „System“ ist, das halbwegs funktioniert. Selbst in den USA würde die Mehrheit vermutlich für Planwirtschaft bei freier Konsumwahl stimmen, wobei den Wählern die Schizophrenie ihrer Entscheidung nicht einmal auffiele.
Es sei nicht ausgemacht, ob die Demokratie die Staatsform der Zukunft ist, betont auch Robert Nef, Herausgeber der liberalen Schweizer Monatshefte, Ende 2003 in seiner Zeitschrift: „Die Antwort auf die Frage, ob die Demokratie tatsächlich die Staatsform der Zukunft sei, hängt eng damit zusammen, ob es gelingt, jenen notwendigen Bereich kollektiver Entscheidungsfindung so eng und so präzis wie möglich zu definieren. Er ist von allen übrigen Bereichen abzukoppeln, bei denen andere Formen der Entscheidungsfindung befriedigender, vernünftiger, effizienter und anpassungsfähiger sind. Demokratie braucht Grenzen […] und da das Mehrheitsprinzip notgedrungen Minderheiten schafft, darf nie vergessen werden, dass die über das Ausmaß von Freiheit entscheidende Minderheit das Individuum ist, von dessen Phantasie und kreativer Dissidenz das Überleben und der Fortschritt in der Zivilgesellschaft mehr abhängt als von der Mehrheit aller Opportunisten.“
Man dürfe schließlich nicht vergessen, mahnt Nef an anderer Stelle – wie übrigens auch Fareed Zakaria – dass der ursprünglich in Spanien aufgekommene Begriff liberalos die Gegner der königstreuen servilos bezeichnete. Wenn dagegen heute (wie im Nachbarland Frankreich gang und gäbe) der Begriff liberal beziehungsweise ultraliberal als Schimpfwort gebraucht wird, zeigt dass nur, dass die „Servilen“ unter dem Mäntelchen des „Sozialen“ sich ihres Einflusses inzwischen so sicher sind, dass sie glauben, die Idee der individuellen Freiheit im Namen eines jakobinischen Staatsverständnisses ohne Scham auf geradezu rassistische Weise verunglimpfen zu können. (Eine andere Bedeutung hat liberal bekanntlich in den USA, wo es den Gegensatz zu „konservativ“ bezeichnet und im politischen Alltag meist schlicht mit „links“ gleichgesetzt wird.)
Sobald Realitätsverlust mehrheitsfähig wird, sobald die Diskursbeziehungsweise Konsensdemokratie zur Legitimation von Kapitulantentum führt, liegt es jedenfalls nahe, das Selbstverständnis und die Rechtfertigung der Institutionen unseres Gemeinwesens auf den Prüfstand zu stellen. Bei der Infragestellung der Demokratie muss man allerdings nicht so weit gehen wie der in den USA lehrende konservativ-libertäre Ökonom Hans Hermann Hoppe, der in seinem heimlichen Bestseller Demokratie. Der Gott, der keiner ist (2001) die zentralisierte demokratische Republik als generellen Rückschritt gegenüber der (habsburgischen) Monarchie hinstellt.
Recht hat Hoppe insofern, als der zentralisierten Republik, die nach der französischen Revolution die absolute Monarchie abgelöst hat, ein Hang zur Tyrannei innewohnt. Die Voraussetzung dafür wurde in Europa aber schon vor der französischen Revolution durch den Ausgang des 30-jährigen Krieges geschaffen, als die spannungsreiche, aber freiheitsförderliche Arbeitsteilung zwischen kleinstaatlich zersplitterten weltlichen Mächten und der geistigen Macht der Katholischen Kirche im Westfälischen Frieden durch eine Stärkung zentralstaatlicher Machtbefugnisse beendet wurde. Seither gilt der Staat im alten Europa in allen mit Lebenssinn, Gewissheit, Sicherheit und Vorsorge zusammenhängen Fragen als kompetenter als Religionen beziehungsweise Kirchen. Dem Staat wurden damit Funktionen zugeschrieben, die früher bei den Gläubigen durch das Vertrauen in die Güte Gottes ausgefüllt wurden. Dass er damit überfordert ist, zeigt nicht zuletzt die „Klimapolitik“.
Politik ohne Feindbild?
DIE HISTORISCHE ERFAHRUNG zeigt: Lässt man die Menschen in unüberschaubaren Großräumen und Situationen an die Wahlurnen gehen, sprechen sie sich in der Regel mehrheitlich für die (meist trügerische) Sicherheit und gegen die Freiheit aus – oft auch gegen die Freiheit des Glaubens. Gewählt wurde auch im Nachkriegsdeutschland immer die Partei beziehungsweise der Kanzlerkandidat, der es am besten verstand, den Wählern trügerische Hoffnungen zu machen und klaren Entscheidungen auszuweichen.
Das Musterbeispiel dafür ist das auf Betreiben Konrad Adenauers Ende Januar 1957 vom Deutschen Bundestag verabschiedete Rentenneuregelungsgesetz, das die von Bismarck eingeführte kapitalgedeckte durch die nur kurzfristig lukrativere umlagefinanzierte Altersversorgung ablöste. Dieses Gesetz, das den Sozialstaat inzwischen in eine Sackgasse geführt hat, bescherte der CDU bei der folgenden Bundestagswahl am 15. September 1957 das einzige Mal in der Nachkriegsgeschichte die absolute Mehrheit. Der Wahlkampfslogan „Keine Experimente!“ deckte ein Experiment, dessen unglücklichen Ausgang wir inzwischen klar absehen können.
Nicht von ungefähr wurden die klügsten und mutigsten Entscheidungen seit 1945 (wie vor allem die völlige Aufhebung der Preiskontrollen und Rationierungen von Gütern des täglichen Bedarfs im Juni 1948 durch Ludwig Erhard) von Leuten getroffen, die nicht gewählt, sondern von den Besatzungsorganen ernannt worden waren. Hätte Ludwig Erhard über die Einführung der Marktwirtschaft abstimmen lassen, hätte er in Deutschland nicht die geringste Chance gehabt. Eine um diese Zeit durchgeführte, aber mit Bedacht nicht veröffentlichte Umfrage des amerikanischen Gallup-Instituts wies aus, dass die Mehrheit der Deutschen einer geläuterten Form von Nationalsozialismus den Vorzug gegeben hätte. Daran dürfte sich, wie der Historiker und Publizist Götz Aly vermutet, in der Zwischenzeit nicht allzu viel geändert haben, denn die Deutschen hängen nach wie vor an „Errungenschaften“ der Nazi-Diktatur wie großzügigen Urlaubsregelungen, preiswertem Massentourismus, Kündigungs- und Mieterschutz, kostenloses Universitätsstudium, Ehegattensplitting, Kindergeld, Entfernungspauschale und Steuerbefreiung der Nacht- und Wochenendarbeit bei der Besteuerung und so weiter.
In seinem Aufsehen erregenden Buch Hitlers Volksstaat (2005) zeigt Aly an Hand der bislang von der historischen Forschung vernachlässigten Finanzstatistik auf, dass Hitler-Deutschland der „Umverteilungsstaat par excellence“ war. Die sozialen Wohltaten für die deutschen Arbeiter- und Angestelltenfamilien wurden im wesentlichen durch den Raub des Eigentums der Juden und durch die Ausplünderung der im Krieg eroberten Länder, zum Teil aber auch durch eine stark progressive Besteuerung von Einkommen und Unternehmensgewinnen finanziert.
Das „europäische Sozialmodell“, das nach Ansicht der Verfasser des europäischen Verfassungsvertrags die europäische Identität ausmachen soll, geht in seiner konkreten Ausgestaltung weniger auf Bismarck oder auf Napoléon III. als auf Hitler, Mussolini und Pétain zurück. Zwar wurde in Frankreich der bezahlte Urlaub von der Volksfrontregierung eingeführt. Doch das französische Nationalheiligtum Sécurité Sociale, das deutschen Sozialdemokraten als Vorbild für die von ihnen geforderte allgemeine „Bürgerversicherung“ dient, wurde von Pétains Kollaborationsregierung eingeführt (vgl. Simonnot, 2004). Dabei tun die roten Nachfolger der braunen Gefälligkeitspolitik so, als könne man dieses „Sozialmodell“ von dem rassistisch begründeten Feindbild lösen, dem es einmal diente. Klassische Feindbilder scheinen nach dem Ende des Kalten Krieges überhaupt überflüssig geworden zu sein.
An die Stelle einer nachvollziehbaren politischen Feindbildbestimmung scheint bei etlichen westeuropäischen Regierungen und ihren Wählern die Angst vor einer offenen Zukunft, verbrämt als Sorge um die Abwendung von „Sozialdumping“ durch die Globalisierung der Märkte sowie einer drohenden globalen Klimakatastrophe infolge eines übermäßigen Ausstoßes von „Treibhausgasen“, getreten zu sein. Oder, wie es in der 1992 in Rio verabschiedeten Agenda 21 offiziell heißt, der Multi-Stakeholder-Prozess des diskursiven Aushandelns eines Konsenses über die Gestaltung der „einen Welt“, die in naturalistischer Manier bereits als gegeben angenommenen wird.
Im Klartext: Die Promotoren der Agenda 21 wollen den ganzen Planeten mit einem Dickicht bürokratischer Regelungen überziehen, weil ihnen schlicht das Gottvertrauen fehlt. Gibt es aber in Wirklichkeit, abgesehen von der physischen Einheit des Planeten Erde, schon so etwas wie die „eine Welt“? Oder bleibt diese nicht vielmehr ein Ideal, eine „regulative Idee“, der man lediglich in Form der Schaffung globalisierter Märkte und der Ausbreitung einer Kultur der individuellen Selbstverantwortung näher kommen könnte? Ist es überhaupt möglich, die für die Formulierung politischer Ziele bislang unabdingbare Feindbildbestimmung durch „herrschaftsfreie Diskurse“ zu ersetzen? Wenn nicht, müssen dann nicht all jene als Feinde betrachtet werden, die sich Freihandel und Globalisierung mehr oder weniger gewalttätig widersetzen?
Dass „große“ Politik unbedingt einer Feindbildbestimmung bedarf, ist selbst den weitsichtigsten Vertretern der politischen Ökologie, die sich auf den für die Grünen engagierten französischen Wissenschaftsforscher Bruno Latour berufen, durchaus bewusst. Denn ohne Feindbild lässt sich gar nicht begründen, warum Probleme des menschlichen Zusammenlebens überhaupt oberhalb des mehr oder weniger überschaubaren kommunalen Niveaus angegangen werden sollten. Auch die im Gewande des Pazifismus auftretende politische Ökologie, die in Europa inzwischen zur tendenziell totalitären politischen Religion erhoben wurde, kommt deshalb nur scheinbar ohne Feindbild aus. Darauf hat der französische Öko-Philosoph Latour mit einer Klarheit hingewiesen, die nichts zu wünschen übrig lässt – in einem in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 12. Mai 2002 veröffentlichten Gespräch mit dem Autor dieser Zeilen. Latour beruft sich dort ausgerechnet auf den wegen seiner anfänglichen Nähe zum Nationalsozialismus umstrittenen deutschen Staatsrechtler Carl Schmitt und dessen Begriff des Politischen. Nur im deutschen rot-grünen Milieu scheint er damit wenig Anhänger gefunden zu haben. Dort gilt die letztlich theologisch inspirierte Diskurstheorie von Jürgen Habermas (Theorie des kommunikativen Handelns, 1981) weiterhin unangefochten als Begründung jeglicher politischer Sinn- und Friedensstiftung. Über die Bestimmung von Feindbildern möchte man in dieser „Religion des Konsenses“ (Norbert Bolz) nicht reden.
Solange es überhaupt noch Gründe für die Staatenbildung gibt, kann es nach Carl Schmitt keinen die ganze Erde und die ganze Menschheit umfassenden Weltstaat geben. „Die politische Welt ist ein Pluriversum, kein Universum“, erklärte Schmitt apodiktisch. Ein Weltfriede ist nur als idyllischer Endzustand der allgemeinen Entpolitisierung vorstellbar. Wer sich auf die „Menschheit“ beruft, bemäntelt damit nur imperialistische Expansionsgelüste, vermutete er daher. Und er zögerte nicht, in diesem Zusammenhang, dabei sich auf den französischen Frühsozialisten Pierre-Joseph Proudhon berufend, zu behaupten: „Wer Menschheit sagt, will betrügen.“
Denn die Rechtfertigung einer Politik durch angebliche Menschheitsprobleme führt zur fatalen Konsequenz, dass deren Gegnern die Qualität des Menschseins abgesprochen werden muss. „Der Gegner heißt nicht mehr Feind, aber dafür wird er als Friedensbrecher und Friedensstörer hors-la-loi und hors de l’humanité gesetzt, und ein zur Wahrung und Erweiterung ökonomischer Machtpositionen geführter Krieg muss mit einem Aufgebot von Propaganda zum ‚Kreuzzug’ und zum ‚letzten Krieg der Menschheit’ gemacht werden“, schrieb Schmitt (S. 77).
Latour behauptet dagegen, die Politische Ökologie – die man besser als Ökologismus, das heißt als naturwissenschaftlich verbrämte Ersatzreligion bezeichnen sollte – verfolge mit ihrem neuen, nicht gegen Menschen als solche, sondern nur gegen eine bestimmte Verbindung von Menschen und Dingen gerichteten Feindbild ausschließlich friedliche Ziele. Das erscheint vor dem Hintergrund der auf insgesamt 500 Millionen geschätzten Zahl von Malaria-Opfern, die allein das ökologisch beziehungsweise ökologistisch begründete DDT-Verbot von 1972 forderte, als völlig unhaltbar. Tatsache ist hingegen: Am Ökologismus starben in den vergangenen vier Jahrzehnten weltweit mindestens ebenso viele Menschen wie durch Kriege. In jüngerer Zeit haben vor allem die Boykott- und SabotageAktionen des Moralkonzerns Greenpeace gegen die „grüne“ Gentechnik dazu geführt, dass der Kampf gegen den Hunger in der Welt langsamer vorankam.
Kein Zweifel: Die zu einer faktenresistenten Heilslehre ausgebaute Politische Ökologie trägt alle Merkmale einer totalitären, menschenverachtenden Herrschaftsideologie, wie sie Friedrich August von Hayek in seiner erstmals 1944 erschienenen Schrift The Road to Serfdom (Der Weg in die Knechtschaft) analysiert hat.
So verwundert es nicht, dass inzwischen sogar Habermas selbst seine Diskurstheorie ganz offen um eine Feindbildbestimmung ergänzt hat (vgl. FAZ, 31. Mai 2003). Logischerweise erscheinen dort nun die Freunde von einst, die mit ihrem Umerziehungsprogramm nach der Kapitulation von 1945 erst den Boden für Diskurse bereitet haben, in der Rolle, die vormals der kommunistische Ostblock innehatte. Darauf hat der Berliner Philosoph Volker Gerhardt in einem im Focus 24/2003 erschienenen bissigen Kommentar hingewiesen. Die von Habermas geforderte Durchsetzung einer (ökologistischen) „Weltinnenpolitik“ gegen den „Unilateralismus“ der US-Regierung unter George Bush läuft nicht nur auf einen Krieg der Köpfe hinaus, sondern liefert auch die Rechtfertigung für einen aufkommenden Handelskrieg unter dem Deckmantel des „Vorsorgeprinzips“. Die harten Auseinandersetzungen zwischen der EU und den USA um die Vermarktung gentechnisch veränderter Futter- und Nahrungsmittel wie Soja, Raps oder Mais vermitteln einen Vorgeschmack davon.
In der Tat geht es längst nicht mehr um die Alternative Krieg oder Frieden, sondern um die Frage, wessen Feindbild und wessen Kriegsziele die klügeren sind. Die EU hat sich offenbar für die dumme Variante entschieden, weil ihre Bemühungen um die Einbindung aller Industrieländer in ein stationäres, wachstumshemmendes System der bürokratischen Rationierung handelbarer „Treibhausgas-Emissionslizenzen“ auf der Basis des Kioto-Abkommens vom Dezember 1997 zu nachhaltiger Verarmung und damit in die politische Bedeutungslosigkeit führen müssen. Sie wird deshalb den von ihr angezettelten Krieg der Köpfe ohnehin nicht gewinnen können.
Der italienische Philosophieprofessor und Politiker Marcello Pera, der von 2001 bis 2006 als Präsident des Senats das zweithöchste Staatsamt Italiens innehatte, sieht als stark von Immanuel Kant und Karl R. Popper beeinflusster Liberaler den europäischen Liberalismus in Beliebigkeit abgleiten, sobald diesem seine christlichen Wurzeln abhanden kommen: „Relativismus, Säkularismus, Szientismus und all das, was heutzutage an die Stelle des Glaubens gesetzt wird, sind das Gift, nicht das Gegengift, sie sind die Viren, die den schon erkrankten Körper befallen, nicht die Antikörper, die ihn schützen“, warnt er in einem 2008 erschienen Buch (S. 11), zu dem kein Geringerer als Papst Benedikt XVI. das Vorwort schrieb. Europa sei dabei, zur am meisten entchristlichten Region des Westens zu werden, und entferne sich dadurch von Amerika. Dort gilt noch immer die von John Locke, Thomas Jefferson und Immanuel Kant inspirierte Maxime, so zu leben „als ob es Gott gäbe.“ Der Versuch, zu leben, „als ob kein Gott existierte“, müsse dagegen schiefgehen, da er in totalitären Allmachtsphantasien münde. Ohne klares Bekenntnis zu seinen christlichen Wurzeln, bleibe Europa ohne Identität, erklärt Pera.
Nur wenn die Menschenrechte als „Geschenk Gottes“ und nicht als Gestaltungsaufgabe des Staates gesehen werden, bleiben sie nicht verhandelbar. „Ohne einen Glauben an die Gleichheit der Menschen, an ihre gleiche Würde, an ihre Freiheit und Verantwortlichkeit, mit einem Wort: ohne eine Religion des Menschen als Kind und Bild Gottes […] kann der Liberalismus die fundamentalen und universalen Rechte der Menschen nicht aufrechterhalten“, mahnt Pera (S. 54). Er sieht in dem mit der Euro-Einführung und dem Vertrag von Lissabon gewählten Weg der europäischen Einigung den Willen, „die christliche Geschichte Europas durchzustreichen.“ Das Christentum werde vom arroganten Säkularismus allenfalls noch als „Trost für die Dummen“ akzeptiert. Der „Verfassungspatriotismus“ nach John Rawls und Jürgen Habermas lasse eine „ethische Lücke“, die ohne eine Lehre vom Guten nicht ausgefüllt werden könne, denn sie definiere die europäische Identität kosmopolitisch, das heißt durch Abstraktion von allem spezifisch Europäischen.
Pera demonstriert den Niedergang der liberalen öffentlichen Ethik durch den Vergleich der Positionen Kants und John Stuart Mills. Bei Kant stehen die universale Vernunft und der Respekt vor der (christlich definierten) Person im Mittelpunkt, bei Mills hingegen die utilitaristische Nutzenmaximierung und der Respekt vor der individuellen Freiheit. Das heutige Europa gehe noch einen Schritt weiter, indem es die Existenz jeglicher universalen moralischer Gesetze abstreitet und Respekt vor der freien Wertewahl der Individuen fordert. Es gebe in der heutigen Gesellschaft weder einen Begriff von Wahrheit noch eine Vorstellung vom Guten und der Sünde. Über das Gute entscheidet die Wahlurne und über die Vereinbarkeit von Ansprüchen mit dem Gemeinwohl entscheiden Gerichte. Das führe letzten Endes zum „Justizimperialismus“, zur moralischen Enteignung der Personen durch eine Konsensdemokratie mit totalitären Zügen.
Der so legitimierte paternalistische Staat stelle das moralische Erbe des Christentums zur Disposition. Er zeige viel Verständnis gegenüber der Kultur islamischer Fundamentalisten, wende sich aber aggressiv gegen Christen, die nach den Zehn Geboten leben. Die Liberalen könnten den Fallen der utilitaristischen Ethik nur entgehen, wenn sie zum christlich inspirierten Rationalismus Lockes und Jeffersons zurückfinden. Das wäre auch eine Voraussetzung für weitere Wohlstandsmehrung in Europa, würde ich hinzufügen. Denn diese hängt auch von religiösen Voraussetzungen ab.
Auf dem Wege zur nachhaltigen Verarmung
DAS IST ABER der überwiegenden Zahl derer, die die „Klimapolitik“ sympathisch finden und die teuren Vorkehrungen gegen eine angeblich drohende Klimakatastrophe nicht als Geldverschwendung und Ablenkung vor dringenderen Herausforderungen ansehen, nicht klar. Befragte man die Menschen, ob sie lieber reich oder arm wären, erhielte man rund um den Erdball wohl eine überwältigende Mehrheit für die erstgenannte Alternative. Nur die wenigen, die geistiger Interessen wegen die freiwillige materielle Armut gewählt haben (was ihr gutes Recht ist), würden die Frage verneinen.
Dennoch stimmen gerade in Europa immer mehr Wähler für eine sozialistisch oder ökologistisch begründete Umverteilungspolitik oder beides, was letztlich alle ärmer machen muss. Selbst in den USA gibt es keine Mehrheit für Kapitalismus und Freihandel – zumal nach den berüchtigten Bilanzskandalen und Zusammenbrüchen einiger Großkonzerne und Banken in den letzten Jahren, wobei Hunderttausende von US-Bürgern ihre Altersversorgung in Gestalt von Aktien- und Pensionsfonds einbüßten. Da hilft der Hinweis nicht, dass gerade die spektakuläre Enron-Pleite darauf zurückging, dass der Energiekonzern politisch korrekt auf den Handel mit CO2-Zertifikaten und somit auf eine Form von Planwirtschaft gesetzt hatte. Und es tröstet wenig, einzusehen, dass die Marktwirtschaft heute die einzige Wirtschaftsform ist, die trotz aller Unzulänglichkeit und Zwiespältigkeit überhaupt einigermaßen funktioniert.
Dass demgegenüber der Sozialismus nicht die „Quellen des gesellschaftlichen Reichtums“ sprudeln lässt, wie Karl Marx im 19. Jahrhundert prophezeite, sondern geradewegs in die allgemeine Armut führt, der sich nur Angehörige einer Nomenklatura, solange sie noch nicht Säuberungen zum Opfer gefallen sind, zeitweise entziehen können, braucht heute nicht mehr theoretisch bewiesen zu werden, denn es gab und gibt auf der Welt kein einziges Land, das selbst bei wohlwollender Interpretation auch nur in Ansätzen als Beispiel für das Gegenteil dienen könnte. Dennoch hat der Sozialismus zu Beginn des 21. Jahrhunderts wieder allenthalben Konjunktur, auch wenn seine Verfechter heute größtenteils unter der Fahne der „Klimapolitik“ und der „Weltinnenpolitik einer nachhaltigen Entwicklung“ als Ausweg aus der angeblichen „Globalisierungsfalle“ antreten.
Planwirtschaft und Marktwirtschaft haben gemeinsam, dass bei beiden so gut wie immer etwas herauskommt, das so niemand gewollt hat. Während diese unerwarteten Resultate aber bei der Planwirtschaft die Hoffnungen der Planer und ihrer Auftraggeber in der Regel bitter enttäuschen, kommt bei der Marktwirtschaft am Ende meistens mehr heraus, als sich die einzelnen Marktteilnehmer in ihren kühnsten Träumen je ausgemalt hatten.
Es fällt den heutigen Menschen aber schwer, sich damit abzufinden, dass sie grundsätzlich im Dunkeln tappen und dass sie in einer undurchschaubaren Welt nur überleben können, wenn sie sich Institutionen schaffen, die ihnen zumindest eine Zeit lang Gewissheit vermitteln. Das heißt, wenn sie sich dabei an allgemeine Regeln halten, die nichts über die Beschaffenheit der äußeren Welt aussagen müssen, sich aber dennoch im Laufe der natürlichen und sozialen Evolution bewährt haben. Ob diese Regeln wie die Zehn Gebote auf göttliche Offenbarung zurückgehen oder sich in einem Selektionsprozess von Versuch und Irrtum herausgebildet haben, tut hier nichts zur Sache.
Prozesse, die wir nicht begreifen, aber auch solche, die wir grundsätzlich verstehen, aber wegen unserer schwachen Einwirkungsmöglichkeiten nicht gezielt zu beeinflussen vermögen, können wir nun einmal nicht steuern. Was für die Evolution unserer Galaxis und unseres Sonnensystems, aber auch für die irdische Plattentektonik und für die Entwicklung der Biosphäre zutrifft, gilt umso mehr für das statistische Konstrukt „Weltklima“. Das Klima wird von der in Genf ansässigen World Meteorological Organization (WMO) als Mittelwert verschiedener Wetterdaten eines Ortes oder einer Region (Jahresgang von Temperatur und Niederschlagsmenge, Häufigkeit, Geschwindigkeit und Richtung von Winden) in den vergangenen 30 Jahren definiert, wobei nichts darüber ausgesagt wird, ob dieser 30-jährige Durchschnitt als „extrem“ oder „normal“ eingestuft werden muss.
Es handelt sich hier also um eine Größe, die man rückwirkend verändern können müsste. Die Unmöglichkeit, das zu tun, hat Berufspolitiker wie den damaligen ex- (oder vielleicht immer noch) maoistischen Bundesumweltminister Jürgen Trittin nicht davon abgehalten, seinen Landsleuten im Sommer 2002 unter dem Eindruck der Flutkatastrophe an der Elbe allen Ernstes nahe zu legen, höhere Ökosteuern zu zahlen und mehr Windmühlen zu bauen, damit es weniger regnet.
Sofern man glaubt, das „Ökosystem Erde“ werde im wesentlichen vom Kohlenstoffkreislauf, dessen Störung durch die Industrie und den dadurch verstärkten Treibhauseffekt geprägt und davon überzeugt ist, darin die zentrale, allen anderen Problemen übergeordnete Herausforderung unserer Zeit erkannt zu haben, erscheint das allerdings konsequent.
In einem Land, dessen Grundgesetz formell die individuelle Glaubensfreiheit anerkennt, darf man so etwas auch glauben. Doch wenn Berufspolitiker meinen, den Glauben an die Steuerbarkeit globaler Stoffkreisläufe den Menschen als alleinseligmachend verordnen und damit aus freien Bürgern Untertanen machen zu können, sollten die Alarmglocken läuten. Diesen Schritt hat das EU-Parlament mit dem 2003 beschlossenen EU-weiten System der „Luftbewirtschaftung“ durch die obrigkeitsstaatliche Zuteilung handelbarer TreibhausgasEmissionslizenzen getan. Diese Politik könnte bei der Ausgabe von Brotkarten enden, weil sie die Weichen in Richtung auf eine nachhaltige Verarmung stellt. Mit ergebnisoffener Marktwirtschaft als Suchprozess hat der inzwischen qua EU-Richtlinie verordnete Emissionshandel nichts zu tun. Vielmehr bietet die Obrigkeit den Marktteilnehmern einen umzäunten Bolzplatz an, auf dem sie sich austoben können. Was dabei am Ende herauskommen soll, steht jedoch von vornherein fest.
Eine Politik, die darauf abzielt, die Menschen durch die Einführung von Zwangsabgaben ärmer zu machen und die Bürger durch den Aufbau neuer Umverteilungs-Bürokratien im Namen des „Vorsorgeprinzips“ und der „sozialen Gerechtigkeit“ daran hindert, ihr Leben eigenverantwortlich zu gestalten und reale Vorsorge für ihre Zukunft zu betreiben, führt zum Gegenteil der seit der Rio-Konferenz 1992 beschworenen Nachhaltigkeit. Jede Form sozialistischer beziehungsweise wohlfahrtsstaatlicher Umverteilung stellt die Weichen in Richtung Verarmung, weil sie individuelle Anstrengungen als überflüssig, wenn nicht schädlich erscheinen lässt.
Ein aktuelles Lehrstück dafür bietet die Eingliederung der ehemaligen DDR in die BRD. Hans-Werner Sinn, der Präsident des Münchner Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, hat in der Tageszeitung Die Welt vom 21. Oktober 2004 vorgerechnet, dass in den neuen Bundesländern schon 47 Prozent der Wahlberechtigten von staatlichen Sozialtransfers leben (Hinzu kommen die Angehörigen des öffentlichen Dienstes.). Jeder dritte Euro, der dort ausgegeben werde, komme aus dem Westen. Davon seien 75 Cent geschenkt und 25 Cent geliehen. Jahr für Jahr fließen 85 Milliarden Euro über öffentliche Kassen in den Osten. Bis Ende 2004 haben sich die Nettotransfers auf den astronomischen Betrag von bereits über einer Billion Euro aufsummiert.
Nicht trotz, sondern gerade wegen dieser massiven Umverteilung sank im Osten das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen zwischen 1996 und 2004 von 61 Prozent des Westniveaus auf 59 Prozent. In eindringlichen Worten warnte Sinn deshalb vor einer Fortsetzung dieser Abwärtsspirale. Die Erfahrungen aus dem „Aufbau Ost“ zeigen überdeutlich, dass Freiheit eine wichtigere Ressource der „Entwicklungshilfe“ ist als Geld. Finanzielle Transfers, allein genommen, führen eher zur Zementierung von Abhängigkeitsverhältnissen als zur Geburt einer Dynamik der Erzeugung wirtschaftlicher Reichtümer.
Zum guten Leben gehören vor allen Dingen persönliche Freiheit sowie Selbst- und Gottvertrauen, Prinzipientreue und Anstand, aber auch eine Portion Unbekümmertheit, das heißt die Bereitschaft der Menschen, ihr Leben dem Suchprozess von Angebot und Nachfrage auf dem Markt anzuvertrauen, der hinter ihrem Rücken zu mehr Wohlstand für alle führen kann. Die Bejahung der Freiheit setzt also gewissermaßen einen Glauben an Wunder voraus. Die rasche Erholung der westdeutschen Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg gilt zu Recht als „Wirtschaftswunder“, obwohl sich dessen „Vater“ Ludwig Erhard selbst immer dagegen gewehrt hat, seine Leistung so zu sehen. Doch wie soll man die Tatsache anders benennen, dass die Freigabe fast aller Verbraucherpreise durch Erhard mitten in der Notzeit des Jahres 1948 genügte, um in kurzer Zeit die Schaufenster mit Waren aller Art zu füllen und eine bis dahin beispiellose wirtschaftliche Wachstumsdynamik auszulösen? Heute hingegen gelangt man zum Eindruck, Berufspolitiker verschiedener Couleur bemühten sich mit vereinten Kräften, Wunder zu verhindern, indem sie die Wirtschaft einem immer dichter werdenden Netz von Regulierungen unterwerfen.
Noch immer sind wirtschaftliches Wachstum und akkumulierter materieller Reichtum die beste Vorsorge gegenüber Wirbelstürmen, Überflutungen und anderen Naturkatastrophen wie vor allem Erdbeben. Bei einem Vergleich zwischen Florida und Haiti oder Bangladesch, zwischen Kalifornien oder Japan und dem Iran oder Kaschmir sollte das jedem ins Auge springen: Bei gleicher Erdbebenstärke unterscheidet sich die Zahl der Opfer zwischen reichen und armen Ländern um zwei bis vier Größenordnungen. Die freiwillige Hilfsbereitschaft gegenüber unverschuldet in Not geratenen Mitbürgern wird übrigens im Wohlstand nicht geringer. Das zeigt die Bedeutung privater Hilfsorganisationen und Stiftungen in den USA und das zeigte auch die große Spendenbereitschaft der Deutschen angesichts der Flutkatastrophen an Oder und Elbe oder der Tsunami-Katastrophen vor Sumatra Ende 2004 wie in Japan im März 2011.
Beunruhigend ist deshalb folgendes: Die Deutschen und die meisten ihrer europäischen Nachbarn möchten gerne die Früchte der Freiheit genießen. Von Freiheit und Eigenverantwortung selbst aber halten sie offenbar selbst nicht sehr viel. Die erste Nachkriegsgeneration, die eine Trümmerwüste in weniger als zwei Jahrzehnten durch harte Arbeit in ein blühendes Land verwandelte, wusste noch einigermaßen, worauf es ankommt. Heute aber scheinen mehr und mehr Deutsche nicht mehr zu verstehen, warum es ihnen besser geht als den meisten Afrikanern. Sie begegnen dem Wohlstand, den eine Generation erarbeitet hat, die sich jetzt im wohlverdienten Ruhestand befindet, mit einem schlechten Gewissen und zeigen sich deshalb wild entschlossen, ihn aufs Spiel zu setzen, ja ihre Kultur und individuelle Freiheit aufzugeben. Es scheint sie nicht zu stören, dass sie sich damit zu nützlichen Idioten derer machen, die sich in den Kopf gesetzt haben, Europa aus der „Koalition der Willigen“ zu bomben und mittelfristig zu übernehmen.
Ein neuer Kalter Krieg?
SELBST CARL SCHMITT hat bei aller völkisch-etatistischer Verblendung mit Nachdruck gefordert, der Feind müsse in der großen Politik so bestimmt werden, dass er unter anderen Umständen auch zum Alliierten taugt. Ausdrücklich warnte er davor, in den Feinden unsympathische Friedensstörer und Spielverderber, wenn nicht gar Untermenschen zu sehen, die es einfach zu eliminieren gilt. Dazu verführe aber gerade die mit dem Briand-Kellogg-Pakt von 1928 ins Völkerrecht eingeführte moralische Ächtung von Angriffskriegen mit dem Ziel der Landnahme. Die ursprünglich vor allem von den USA betriebene Moralisierung des Völkerrechts und die damit verbundene Verschiebung der Anstrengungen von der militärischen auf die ökonomische Expansion führten zur Rehabilitation der überwunden geglaubten mittelalterlichen Theorie des „gerechten Krieges“, das heißt zur Entgrenzung des Krieges in Form von Kreuzzügen gegen (vermeintliche) Friedensstörer, fürchtete er nicht zu unrecht.
Demgegenüber betonte er: „Der politische Feind braucht nicht moralisch böse, er braucht nicht ästhetisch hässlich zu sein; er muss nicht als wirtschaftlicher Konkurrent auftreten, und es kann vielleicht sogar vorteilhaft erscheinen, mit ihm Geschäfte zu machen.“ (C. Schmitt: Der Begriff des Politischen, S. 27 der Ausgabe von 1963).
Dieser Forderung entsprach die neue Feindbildbestimmung, wie sie US-Präsident Harry Truman nach dem gewonnenen Weltkrieg gegen das Hitler-Regime traf, auf beinahe ideale Weise (obwohl Truman und seine Berater sich hüteten, den durch seine anfängliche Unterstützung Hitlers kompromittierten Carl Schmitt zu zitieren). Insofern kann der Kalte Krieg zwischen dem individualistischen Westen und dem kollektivistischen Osten als insgesamt glückliche Zeit für die „große“ Politik gelten. Man brauchte den „Ostblock“ nicht verteufeln, konnte sogar einräumen, dass der Kommunismus wie der Liberalismus letztlich im abendländischen Rationalismus wurzelt, ihn also mit einer gewissen Nachsicht wie einen (vorübergehend) vom rechten Weg abgekommenen Blutsbruder behandeln. Deshalb konnte man mit Kommunisten, außerhalb eines eng definierten Bereichs militärisch sensibler Güter, durchaus Handel treiben, ohne sich zu kompromittieren. Der vom US-Diplomaten George F. Kennan aus der Taufe gehobenen Doktrin des containment, der materiellen und intellektuellen Eindämmung des Kommunismus, lief das nicht zuwider.
Allerdings wurde der feinsinnige und ironische Ansatz Kennans schon von Eisenhowers Außenminister John Foster Dulles im Sinne einer religiösen Konfrontation zwischen christlicher Spiritualität und kommunistischem Materialismus missverstanden. Kennan hingegen wusste, dass es in Glaubenskriegen keine Sieger geben kann. Er warnte deshalb davor, den Dogmatismus der Kommunisten mit einer ebenso fundamentalistischen Ideologie des Westens und mit selbstgerechtem Messianismus zu beantworten, sondern forderte eine nüchterne Interessenpolitik, die weltanschaulichen Pluralismus nicht nur zulässt, sondern geradezu voraussetzt, sich moralischer Urteile weitgehend enthält und sich stattdessen darauf konzentriert, dem totalitären Weltbild durch sichtbare militärische und wirtschaftliche Überlegenheit den Boden unter den Füßen wegzuziehen.
Die Strategie des containment war vermutlich gerade deshalb so überaus erfolgreich, weil dieses sich nicht in einer starren Konfrontation erschöpfte, sondern vielfältige Formen „intersystemarer“ Kooperation zuließ. Das gilt insbesondere für eine spätere Phase des Kalten Krieges, die mit Schlagworten wie „Brückenschlag“ und „Entspannung“ umschrieben wird. Dass die Entspannungspolitik, trotz aller damit verbundener Zugeständnisse, dem Westen letztlich erheblich mehr nützte als den kommunistischen Regimes im Osten, bedarf heute keines Beweises mehr. Vergessen wird aber von vielen Westeuropäern, dass der Entspannungsphase eine unvergleichlich härtere Gangart des Kalten Krieges vorausging. Die in dieser Phase erreichte Verschiebung des Kräfteverhältnisses zugunsten des Westens machte die späteren Kompromisse überhaupt erst möglich. Und am Ende waren es nicht gute Worte, sondern die Aufstellung von Pershing-II-Raketen und die massive Erhöhung des gesamten US-Rüstungsetats auf 7,5 Prozent des Bruttosozialprodukts (BSP) unter Präsident Ronald Reagan als Antwort auf die Bedrohung durch sowjetische SS-20-Raketen, die die UdSSR zwangen, ihrerseits den Wehretat auf weit über 20 Prozent ihres BSP zu erhöhen, um materiell mit den USA gleichzuziehen. Der Zusammenbruch der sozialistischen Wirtschaften war dann nur noch eine Frage der Zeit.
Eine besondere Rolle spielte die Atomenergie im ökonomischen Wettlauf zwischen Marktwirtschaft und Sozialismus. Zum einen machte die Herstellung und Anhäufung eines Arsenals nuklearer Sprengköpfe den Kern der Politik des Wettrüstens und des „Gleichgewichts des Schreckens“ aus, was Europa eine der längsten Friedensperioden seiner Geschichte und einen beispiellosen wirtschaftlichen Aufschwung bescherte. Zum andern lieferten entsprechend umfunktionierte Atomreaktoren billigen Strom, der auf beiden Seiten des „Eisernen Vorhangs“ als Schmiermittel der Wirtschaft diente. In einer freien, nicht durch den Kommunismus bedrohten Marktwirtschaft hätten große Kernreaktoren vermutlich über längere Zeit kaum Chancen gehabt, zu einer wichtigen Komponente der energetischen Basis etlicher westeuropäischer Volkswirtschaften zu werden. Es ist bekannt, dass die Energieversorger von der Politik zunächst zum Einstieg in die Atomenergie gedrängt werden mussten. Erst als sich abzeichnete, dass bestimmte Kernreaktortypen Strom günstiger erzeugen konnten als Kohlekraftwerke, gaben große (halböffentliche) Energiekonzerne wie Veba (heute E.ON) und RWE ihr Zögern auf.
Zu Unrecht beruft sich heute die Windkraft- und Solar-Lobby auf die Erfolge der Atomlobby in den 50er und 60er Jahren, um die Zwangssubventionierung „erneuerbarer“ Energien über hohe Stromeinspeisungspreise zu rechtfertigen. Denn die Subventionierung der Erschließung der Atomenergie hatte eine wichtige Funktion im Kalten Krieg. Gegen welchen Feind sollen aber Windräder helfen? Eine pikante Antwort auf diese Frage hat der ehemalige sozialdemokratische Hamburger Umweltsenator Fritz Vahrenholt, heute Manager einer RWE-Tochter, gefunden: Große Windräder sollen Atomkraftwerke vor Terroranschlägen schützen (vgl. Der Spiegel, 14/2004).
Gewiss hatte der Kalte Krieg auch hässliche Seiten. Das steht außer Frage. So führte die Bündnispolitik nach dem Motto „Der Feind meines Feindes ist mein Freund“ zur Unterstützung menschenverachtender Diktaturen und zur Schürung heißer Stellvertreterkriege auf regionaler Ebene, was den Werten, die es zu verteidigen galt, in den Augen der Betroffenen Hohn sprach. Als verhängnisvoll erwies sich dabei der Versuch, die kommunistisch beherrschten Länder mit einem „Grüngürtel“ aus islamistischen Staaten zu umschließen. Besonders tragische Folgen hatte die Unterstützung der gegen die sowjetische Besatzung Afghanistans kämpfenden islamistischen Taliban unter Ronald Reagan, der ansonsten als einer der friedlichsten US-Präsidenten in die Geschichte hätte eingehen können.
Dennoch lieferte der Kalte Krieg nicht nur der Politik, sondern auch der Wirtschaft für Jahrzehnte einen einigermaßen klaren und verlässlichen Orientierungsrahmen für technische Innovationen und soziale Zugeständnisse. Wie gut die Klammerfunktion war, die das Feindbild ausübte, lässt sich an der Geschwindigkeit des Auseinanderdriftens der Interessen beiderseits des Atlantik nach dem Zusammenbruch des „Ostblocks“ ermessen. Bis heute haben die US-Regierung und die Regierungen des „alten Europa“ sich nicht ansatzweise über ein gemeinsames neues Feindbild verständigen können.
Das hängt vermutlich damit zusammen, dass der Terrorismus als solcher sich nicht ohne weiteres als Feindbild eignet. „Wenn man wie jetzt im Kampf gegen den Terrorismus nur das Irrationale, Archaische als Feinde ausmacht, hat man noch kein legitimes Feindbild, weil man die Feinde außerhalb der gemeinsamen Welt stellt“, mahnte Bruno Latour (FAS, 12. 5. 2002). So ein schönes Feindbild wie den Kommunismus bekommt man in der Tat so leicht nicht wieder. Wie schwierig es ist, ein ebenbürtiges Bedrohungsszenario zu finden, zeigte sich schon in der Endphase des Kalten Krieges, als die NATO zu Beginn der 70er Jahre im Rahmen ihres Umweltausschusses CCMS versuchte, die angeblich drohende „Klimakatastrophe“ als Ersatzfeindbild für die nachlassende kommunistische Bedrohung aufzubauen – dazu später.
Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus hielt der spätere US-Vizepräsident Al Gore die Zeit für gekommen, im Rahmen der Vorbereitungen der Rio-Konferenz mit der neuen Feindbildbestimmung ernst zu machen, indem er in seinem zum Bestseller avancierten Buch Earth in Balance forderte, die Abwendung einer „Klimakatastrophe“ zum Dreh- und Angelpunkt der gesamten Politik des Westens zu machen. Aber schon unter der Präsidentschaft Bill Clintons fand sich nicht nur im US-Senat, sondern im Grunde in der gesamten politischen Klasse der USA keine Mehrheit für eine Ratifizierung des dieser Weltsicht entsprechenden Kioto-Abkommens vom Dezember 1997.
Stattdessen setzte sich das von Clintons Nachfolger George W. Bush schwammig definierte Feindbild des internationalen Terrorismus zumindest in den USA zunächst durch, ohne außerhalb der pazifistischen Bewegung auf nennenswerten Widerstand zu stoßen. Erst als der Präventivkrieg gegen Saddam Husseins Diktatur im Irak wegen mangelnder Vorbereitung der Besatzungszeit zusehends zu Rückschlägen führte, drängte sich die Frage auf, ob der „Krieg gegen den Terror“ militärisch überhaupt zu gewinnen ist und wie man einen Sieg in diesem Kampf definieren und feststellen könnte.
Eine neue Spaltung der Welt
MAN KANN ES DREHEN und wenden, wie man will: Das Schema des Kalten Krieges eignet sich nur im übertragenen Sinne für die Analyse der aktuellen Konfliktlage. Denn der Islam ist nicht (wie der Kommunismus) der feindliche Bruder des Christentums und der europäischen Aufklärung. Beide Seiten berufen sich nicht auf den gleichen Gott. Als Feind können weder der Islam als Religion noch der Islamismus als politische Ideologie gelten. Dann landete man unwillkürlich in der Sackgasse eines Religionskrieges. Vielmehr muss das Feindbild Totalitarismus, das zumindest die weitsichtigsten Theoretiker der Eindämmung des Kommunismus wie George F. Kennan oder Isaiah Berlin bereits im Auge hatten, näher bestimmt, das heißt bis zu seinen romantischen Wurzeln zurückverfolgt werden.
Es geht also nicht mehr nur, wie so oft im 1990 zu Ende gegangenen Kalten Krieg, um einen Kampf zwischen zwei Abarten von Romantik, sondern um den Kampf gegen die nihilistische Dimension der Romantik als solche (einschließlich der Sozialromantik). Diese kann man nach Isaiah Berlin kurz charakterisieren durch den Vorrang, den sie „überpersönlichen Wesenheiten“ wie einer Gemeinschaft, einer Kirche, einer religiös definierten „Rasse“, einer gesellschaftlichen Klasse oder einem Staat gegenüber den Individuen und ihrem gesunden Menschenverstand bei der Identitäts- und Willensbestimmung gibt. Der Kampf gegen den Totalitarismus sollte, wie Paul Berman schön herausgearbeitet hat, in erster Linie ein „umfassender Krieg der Ideen“ sein. Dabei stehen Skeptizismus und Ironie gegen das Ideal der Unterwerfung unter einen (vermeintlichen) Kollektivwillen.
Das entspricht durchaus der Forderung, die Carl Schmitt an die politische Feindbildbestimmung stellte. Wir führen nicht Krieg gegen irgendwelche nicht zu unserer Welt gehörenden Untermenschen, sondern gewissermaßen gegen uns selbst. Denn in jedem Europäer steckt ein Romantiker. Romantische Gefühle können, politisch entschärft durch Ironie, unter bestimmten Umständen aber auch zu Verbündeten im „Krieg der Ideen“ werden, weil sie Leidenschaften und Schaffenskraft freisetzen, ohne die keine Anstrengung längere Zeit durchgehalten werden kann. Immerhin hat die in den USA noch heute verehrte amerikanische Schriftstellerin Ayn Rand (geboren in St. Petersburg als Alissa Rosenbaum) in ihrem Dauer-Bestseller Atlas Shrugged (1957, deutsch: Wer ist John Galt?) gezeigt, dass man sogar das Lob des reinen Kapitalismus mit Romantik verbinden kann. Das über 1.200 Seiten starke Buch handelt von einem Streik der Unternehmer.
Das bedeutet: Die Frontlinien zwischen den bislang nur vorläufig definier- und kaum lokalisierbaren gegnerischen Lagern verlaufen mitten durch den ehemaligen westlichen Block. Zur Debatte stehen im Westen zwei miteinander unvereinbare Auffassungen von Politik. Es geht dabei nicht nur um das Verhältnis zwischen großer Politik und Moral im Allgemeinen, sondern, wie schon angedeutet, auch um die Frage nach dem Nutzen der UNO und multilateraler Abkommen in der heutigen Welt.
In Europa herrscht die Meinung vor, die Welt sei mit dem Aufbau der UNO und dem Ende des Kalten Krieges der Utopie einer Verschmelzung von Recht und Moral näher gekommen. Die UNO und ihre Unterorganisationen, so heißt es, ermöglichten die Herstellung und Wahrung des Friedens auf rein diplomatischen Wegen des multilateralen Interessenausgleichs, durch eine Art „Weltinnenpolitik“, was voraussetzt, dass die „eine Welt“ bereits Realität ist. Das bisherige Politikverständnis, das es durchaus zuließ, dass der Friede, wenn nötig, auch durch Krieg herbeigeführt wird, sei nun überholt. Nur humanitäre Aktionen und allenfalls von der Staatengemeinschaft einvernehmlich beschlossene, ausschließlich moralisch und nicht machtpolitisch begründete Strafaktionen gegen Störenfriede seien noch legitim.
Die US-Politik unter George W. Bush misstraute hingegen einer Institution, die sich zwar die Verwirklichung der Menschenrechte auf die Fahne geschrieben hat, aber in ihren Reihen viele Mitgliedsstaaten duldet, die diese Rechte tagtäglich mit Füßen treten. Kritiker der UNO, auch in Europa, verweisen zu Recht auf Beispiele unheilvoller Verstrickung humanitärer Aktionen mit der Logik einer Machtpolitik neuen Stils. Deren in die Millionen gehende Zahl von Opfern werden der UNO aber nicht zugerechnet, weil diese sozusagen für einen „guten Zweck“ gestorben sind.
So haben die Embargomaßnahmen der Vereinten Nationen gegen den Irak, die erst nach dem vom US-Militär herbeigeführten Sturz des Diktators Saddam Hussein aufgehoben wurden, vermutlich weit mehr Todesopfer gefordert (wahrscheinlich Hunderttausende) als die beiden Irak-Kriege der USA zusammen genommen, vermutete Henning Ritter in der FAZ vom 9. Januar 2004. Zu einer üblen Vermischung von humanitärer Mission und Machtinteressen sei es auch beim UNO-Einsatz im ehemaligen Jugoslawien gekommen. In der Tageszeitung Die Welt vom 15. April 2004 wies der ehemalige stellvertretende schwedische Premierminister Per Ahlmark darauf hin, dass das Massaker in der bosnischen Stadt Srebrenica im Juli 1995 eindeutig von der UNO verschuldet wurde. Noch schlimmer hatte die UNO ein Jahr zuvor in Ruanda versagt. Für das Massaker an 800.000 Tutsi und gemäßigten Hutu im Jahre 1994 sei der spätere UNO-Generalsekretär Kofi Annan in seiner damaligen Funktion direkt verantwortlich gewesen, unterstrich Ahlmark. In die lange Liste des Versagens der UNO als Soft Power wird man wohl auch den Völkermord an Schwarzen im Westsudan durch muslimische Reiterhorden einreihen müssen.
Der von US-Präsident Bush sen. in leitende Funktionen der UNO entsandte Pedro A. Sanjuan berichtet in seinem 2006 erschienenen Buch Die UN-Gang zwar eher heiter über die ebenso chaotischen wie skandalösen Verhältnisse in der New Yorker UN-Zentrale. Doch er schildert auch skandalöse Machenschaften bei der Verwaltung des UNO-Programms Öl für Lebensmittel im Irak, der in Europa lange vertuscht wurde – und das aus „gutem“ Grund: Nach dem im Herbst 2004 veröffentlichten glaubwürdigen, weil ansonsten durchaus Bushkritischen Duelfer Report befinden sich unter denen, die beträchtliche Summen der irakischen Ölgelder in die eigene Tasche, in die Kasse ihrer Partei sowie nicht zuletzt in die Kriegskasse Saddam Husseins umleiteten und damit hungernden irakischen Kindern vorenthielten, neben dem Sohn von UN-Generalsekretär Kofi Annan engste Freunde des damaligen französischen Staatspräsidenten Jacques Chirac. Dieser wusste also, warum er alles daran setzen musste, die Entmachtung Saddam Husseins zu sabotieren. Das hohe Ansehen, das die UNO und ihr Generalsekretär in Europa genießen, müsse daher als Aberglaube betrachtet werden, meint Per Ahlmark. Die meisten europäischen Massenmedien verschwiegen auch die Tatsache, dass die UNO im Irak bei allen kämpfenden Fraktionen aus verständlichen Gründen ein extrem schlechtes Ansehen genießt, was die von den UNO-Freunden beschworenen „multilateralen“ Versuche zur Lösung der Irak-Krise nicht aussichtsreicher macht als den schlecht vorbereiteten Feldzug George Bushs.
Man sieht daran, wie der Versuch einer postmodernen Moralisierung der großen Politik nicht nur zu Doppelmoral und Heuchelei, sondern geradewegs zum Realitätsverlust führt, weil die politischen Akteure längst nicht alle so abgebrüht sind, dass sie ihren eigenen Mythen nicht glaubten. Die „Eliten“ der Europäischen Union bewegen sich daher überwiegend guten Glaubens in einer virtuellen Welt, die man getrost der Kategorie „Aberglaube“ zuordnen könnte.