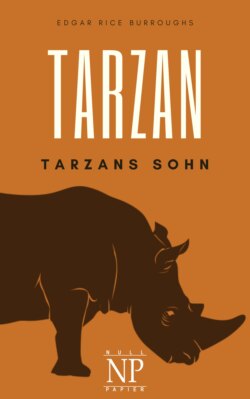Читать книгу Tarzan – Band 4 – Tarzans Sohn - Edgar Rice Burroughs - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die kleine braune Meriem
ОглавлениеDer Hauptmann Armand Jacot von der Fremdenlegion saß auf seiner Satteldecke, die er unter einer kümmerlichen Palme ausgebreitet hatte. Mit seinen breiten Schultern und dem fast glattrasierten Kopfe hatte er sich bequem an den Stamm der Palme gelehnt, seine langen Beine über die viel zu kurze Decke hinaus weit von sich gestreckt, die Sporen im Sandboden der kleinen weltentlegenen Oase halb vergraben. Kein Wunder, dass er es sich jetzt so gemütlich wie möglich machte, denn er hatte einen langen anstrengenden Ritt durch die Sandwogen der Wüste hinter sich.
Bedächtig und mit sichtlichem Behagen rauchte er seine Zigarette; er erwartete jeden Augenblick seine Ordonnanz, die ihm jetzt die Abendmahlzeit fertig machte. Hauptmann Armand Jacot war heute mit sich selbst und der Welt sehr zufrieden. Ein wenig rechts von ihm herrschte reges Leben und Treiben. Seine Leute, lauter sonnenverbrannte kampferprobte Soldaten, fühlten sich einmal frei von den oft drückenden Fesseln der strengen Disziplin, ihre müden Muskeln entspannten sich, man lachte, scherzte und rauchte, während man sich nach zwölfstündigem Fasten auch endlich wieder einmal etwas für den hungrigen Magen zubereiten konnte. Dort hockten außerdem völlig schweigsam und in sich versunken fünf Araber in weißen Gewändern. Sie waren stark gefesselt und ständig unter scharfer Bewachung.
So oft Hauptmann Armand Jacot zu diesen seinen Gefangenen hinüberblickte, überkam ihn vor allem das wohlige Gefühl voll erfüllter Pflicht. Einen ganzen langen Monat hatte er mit seinem kleinen Trupp in furchtbarer Glut und unter großen Entbehrungen die weiten öden Wüstenflächen durchstreift, und endlich war ihnen nun die Räuber- und Mörderbande ins Garn gegangen. Unzählige Kamele, Pferde und Ziegen hatte die Marodeure auf dem Gewissen und obendrein schändliche Mordtaten, die allein schon genügt hätten, um über die ganze unangenehme Gesellschaft den Stab zu brechen.
Vor einer Woche war man ihnen auf die Spur gekommen. Wohl hatte er im Kampf mit den Banditen zwei seiner Leute verloren, aber die Strafe hatte nicht lange auf sich warten lassen und die ganze Gesellschaft nahezu aufgerieben. Nur ein halbes Dutzend mochte seinem rächenden Arm entronnen sein, die anderen – mit Ausnahme der fünf Gefangenen – hatten ihre Taten mit dem Tode büßen müssen. Dafür hatten die Legionäre mit den kleinen Stahlgeschossen im Nickelmantel schon gesorgt. Und das Allerbeste: Der Rädelsführer Achmet ben Haudin war gefangen.
Von den Gefangenen schweiften die Gedanken des Hauptmanns Jacot in die Ferne. Er überlegte, über wie viele Meilen der Ritt durch den Wüstensand noch gehen musste, bis er wieder in dem kleinen vorgeschobenen Standort anlangte. Morgen würde es soweit sein, morgen würden ihm seine Frau und das kleine Töchterchen freudestrahlend aus dem Hause entgegenkommen und ihn willkommen heißen. In seine Augen trat ein feuchter Schimmer wie stets, wenn er an die Seinen dachte; und er sah es jetzt sogar schon ganz deutlich, wie sich das schöne Antlitz der Mutter in den noch kindlichen Zügen der kleinen Jeanne widerspiegelte, und wie beide ihm strahlend zulächeln würden, wenn er sich morgen spät am Nachmittag von seinem müden Reitpferd herabschwänge. Er fühlte schon die weichen zarten Wangen, die sich an die seinen schmiegen würden, hier die Gattin und da die kleine Jeanne – – wie Sammet auf Leder.
Plötzlich wurde er aus seinen Träumen aufgescheucht. Ein Posten hatte dem Unteroffizier etwas laut zugerufen. Hauptmann Jacot blickte hinüber. Die Sonne war noch nicht untergegangen, aber die Schatten der paar Bäume drängten sich gleichsam schon in den Wassertümpel der Oase hinein, während die seiner Leute samt denen der Opfer sich weit hinaus über die jetzt goldüberglänzte Sandfläche dehnten. Der Posten deutete nach dieser Richtung. Hauptmann Jacot stand auf. Er war nicht der Mann danach, dass es ihm genügt hätte, mit den Augen anderer zu sehen. Er musste alles selber gesehen haben, ja für gewöhnlich entdeckte er alles, lange bevor die anderen überhaupt merkten, dass etwas zu sehen war. Diese außerordentliche Fähigkeit hatte ihm übrigens den Spitznamen der »Falke« eingetragen. Jetzt sah er – weit, weit hinaus über die langen Schatten – etwa ein Dutzend Pünktchen, die sich über den Sandflächen hoben und senkten. Sie verschwanden und tauchten wieder auf, wurden aber immer größer. Jacot erfasste sofort, um was es sich da handelte: Reiter waren das, richtige Wüstenreiter.
Schon kam ein Sergeant zu Jacot herbeigeeilt. Die Leute blickten alle angestrengt nach dem fernen Horizont. Jacot gab ein paar knappe Befehle, der Sergeant grüßte, machte kehrt und ging rasch zu den Leuten zurück. Sogleich sattelten die zwölf Mann, die er bestimmt hatte, ihre Pferde, schwangen sich hinauf und ritten den nahenden Fremdlingen entgegen. Der Rest des Trupps machte sich fertig, um gegebenenfalls sofort in den Kampf eingreifen zu können. Denn es war ja keineswegs ausgeschlossen, dass die Reiter, die in rasendem Tempo auf das Lager zuhielten, Freunde der Gefangenen waren und die ihre Blutsverwandten durch einen plötzlichen Angriff befreien wollten. Jacot bezweifelte dies indessen, da die Fremdlinge offenbar gar nicht erst den Versuch machten, unbemerkt heranzukommen. Im Gegenteil, sie ritten in vollem Galopp und so, dass sie von jedem deutlich gesehen werden konnten, unmittelbar auf das Lager zu. Mochte sein, dass trotzdem oder gerade deshalb Verrat und Tücke hinter diesem Herannahen in anscheinend freundlicher Absicht lauerten. Wer indessen den »Falken« richtig kannte, würde sich nie der etwas fatalen Hoffnung hingegeben haben, dass Jacot sich je in solch eine Falle locken lassen könnte.
Der Sergeant war mit seinen Reitern etwa zweihundert Meter vom Lager entfernt, als er auf die Araber stieß. Jacot konnte deutlich verfolgen, wie er mit einem großen Mann in weißem Gewande, offenbar dem Führer der Schar, verhandelte. Beide ritten schließlich Seite an Seite auf den Lagerplatz zu, wo Jacot sie erwartete. Sie zogen die Zügel straff und stiegen vom Pferde.
Scheich Amor ben Khatur, meldete der Sergeant kurz und trat ab.
Hauptmann Jacot blickte dem Ankömmling scharf in die Augen. Ihm war so ziemlich jeder einigermaßen einflussreiche Araber im Umkreis von ein paar hundert Meilen bekannt, doch den da hatte er noch nie gesehen. Es war ein stattlicher, wettergebräunter Mann mit finster-mürrischem Blick; er mochte sechzig Jahre oder älter sein. Seine zusammengekniffenen Augen schienen nichts Gutes zu verheißen; Hauptmann Jacot hatte wenigstens sofort diesen Eindruck.
Nun? fragte er. Was ist los?
Der Araber machte keine langen Umschweife. Achmet ben Haudin ist der Sohn meiner Schwester, begann er. Wenn Sie ihn mir herausgeben, will ich ihn unter meine Obhut nehmen und dafür sorgen, dass er nie wieder gegen die Gesetze der Franken verstößt.
Jacot schüttelte den Kopf. Unmöglich, erwiderte er. Ich muss ihn nach meinem Standort schaffen. Ein besonderes Zivilgericht wird über die ganze Sache zu befinden haben. Ist er unschuldig, wird man ihn freilassen. Und wenn er es nicht ist? unterbrach ihn der Araber. Ihm werden allerdings mehrere Mordtaten zur Last gelegt. Wird ihm eine Schuld oder Mitschuld auch nur an einem derartigen Verbrechen einwandfrei nachgewiesen, muss er dies mit dem Tode büßen.
Die Linke des Arabers hatte im Burnus gesteckt. Er zog sie jetzt heraus und brachte zugleich einen schweren, mit Münzen bis obenan gefüllten Geldbeutel aus Ziegenleder hervor, den er ohne Verzug öffnete. Klingend rollte eine Handvoll Münzen in seine Rechte: Es waren lauter gute Goldstücke. Hauptmann Jacot schloss aus dem immer noch prallen stattlichen Beutel, dass er ein ganz hübsches kleines Vermögen enthalten mochte. Scheich Amor ben Khatur ließ ein Goldstück nach dem anderen langsam wieder in den Beutel zurückfallen und zog die Schlinge oben wieder zu. Die ganze Zeit über hatte er geschwiegen, während Jacot jede seiner Bewegungen aufmerksam verfolgte.
Die beiden waren jetzt allein. Der Sergeant, der den Fremdling begleitet hatte, stand ein wenig abseits und drehte ihnen gerade den Rücken zu. Der Scheich hatte eben wieder alle Goldstücke in seinen dicken Beutel zurückgleiten lassen, stellte ihn auf die geöffnete Hand und wandte sich mit unmissverständlicher Gebärde jetzt an den Hauptmann Jacot.
Achmet ben Haudin, der Sohn meiner Schwester, wird diese Nacht auf unerklärliche Weise entfliehen …? Nicht wahr? flüsterte er.
Hauptmann Armand Jacot schoss das Blut in den Kopf, dass er bis unter die Haarwurzeln errötete. Dann wurde er leichenblass. Seine Fäuste ballten sich, und er rückte einen halben Schritt an den Araber heran. Doch plötzlich kam ihm ein anderer Gedanke, und der war entschieden besser.
Sergeant! rief er mit lauter Stimme. Der Unteroffizier stürzte sofort herzu. Er schlug die Hacken zusammen und stand grüßend vor seinem Vorgesetzten.
Bringen Sie diesen braunen Hund wieder zu seiner Bande zurück! befahl er. Und sehen Sie zu, dass die Gesellschaft auf der Stelle verschwindet. Auf jeden – ganz gleich wer – der sich bei Nacht in der Nähe des Lagers herumtreibt, wird einfach geschossen.
Scheich Amor ben Khatur richtete sich zu seiner ganzen Größe auf, seine glühenden Augen kniffen sich zusammen, und er folgte mit dem verlockenden Geldbeutel den Augen des Offiziers, der ihn von oben bis unten maß.
Mehr als dies da werden Sie für das Leben Achmet ben Haudins, der meiner Schwester Sohn ist, zahlen müssen! Und, fuhr er fort, noch einmal so viel für den netten Namen, den Sie mir eben zulegten, und das Hundertfache an Sorgen und Qualen obendrein!
Scheren Sie sich fort, ehe ich Sie mit einem Fußtritt hinausbefördere! stieß Hauptmann Armand Jacot hervor …
*
All dies geschah etwa drei Jahre vor der Zeit, in der unsere Erzählung beginnt. Die gerichtliche Untersuchung in Sachen Achmet ben Haudins und seiner Spießgesellen brachte Unerhörtes an den Tag. Wen es interessiert, der mag die offiziellen Berichte nachlesen. Achmet erhielt die verdiente Strafe und ging mit der ganzen stoischen Ruhe eines Arabers in den Tod. Einen Monat später war die kleine Jeanne Jacot, das siebenjährige Töchterchen des Hauptmanns Armand Jacot, mit einem Male auf rätselhafte Weise verschwunden. Weder das Vermögen von Vater und Mutter, noch die unerschöpflichen Hilfsquellen und Maßnahmen der Regierung schienen auszureichen, um irgendwie Licht in das Dunkel zu bringen. Das Rätsel war und blieb unergründlich, kein Mensch konnte irgendetwas über das Wo und Wohin des Mädchens und seines Räubers erfahren oder entdecken. Es war gleichsam, als habe die Wüste sie verschlungen.
Unerhörte Belohnungen hatte man ausgesetzt, und viele abenteuerlustige Männer waren der Lockung dieser Jagd nach dem Glück gefolgt.
Zwei Schweden, ein gewisser Carl Jenssen und Sven Malbihn, waren drei volle Jahre immer auf der falschen Spur gewesen. Sie befanden sich schließlich weit unten im Süden der Sahara und kamen zu dem Entschluss, die Nachforschungen aufzugeben und sich dafür ganz der bedeutend einträglicheren Jagd auf Elfenbein zuzuwenden. Man kannte die beiden übrigens schon zur Genüge im weiten Umkreis als rücksichtslose und schier unersättliche Ausbeuter der »Elfenbeinquellen«. Die Eingeborenen hassten und fürchteten diese Sorte von Fremdlingen, nach denen auch die Regierungen der betroffenen europäischen Kolonien unablässig fahndeten. Sie hatten jedoch während ihrer anfänglichen Streifzüge durch Nordafrika im »Niemandsland« südlich der Sahara mancherlei gelernt, was ihnen späterhin zunutze kam; denn sie kannten nur zu genau die vielen Schliche und Pfade, auf denen sie sich der Gefangennahme und ihren geschickten Verfolgern jederzeit leicht entziehen konnten. Plötzlich und mit unglaublicher Schnelligkeit stürmten sie auf ihre Beute, holten sich das Elfenbein und verschwanden ebenso rasch wieder in dem unwegsamen öden Norden, noch ehe die Polizei der heimgesuchten Gebiete sie überhaupt zu Gesicht bekommen hatte. Es gab keinen Pardon, sie schlachteten rücksichtslos ab, was ihnen an Elefanten in den Weg lief, oder plünderten auch wohl die Elfenbeinvorräte der Eingeborenen. Hundert oder mehr abtrünnige Araber und Negersklaven schlimmster Sorte waren ihre Handlanger.
Der Leser wolle sich das, was eben von diesen beiden blondbärtigen schwedischen Hünengestalten Karl Jenssen und Sven Malbihn angedeutet wurde, gut merken, denn wir werden ihnen später wieder begegnen.
*
Im Herzen des Dschungels und etwas abseits vom Ufer eines kleinen unerforschten Flusses, dessen Wasser sich bald mit den Fluten eines großen Stromes vereinen und sich mit ihnen unweit vom Äquator in den Atlantischen Ozean ergießen, lag im Wald versteckt ein kleines, ringsum mit starken Palisaden umzäuntes Dorf. Die zwanzig Hütten, die fast wie große Bienenstöcke aussahen, waren mit Palmenblättern gedeckt und boten der schwarzen Bevölkerung seit langem Schutz und Obdach, während in der Mitte auf freiem Dorfplatze ein Trupp Araber seine Zelte aus Ziegenleder aufgeschlagen hatte, die ihm für die Dauer der Streifzüge als Standquartier dienten. Die Araber gingen in diesen Gebieten ihren mehr oder weniger reellen Handelsgelüsten nach, das heißt sie kauften oder kauften auch nicht, was sie dann zweimal im Jahr mit ihren »Wüstenschiffen« nordwärts auf den Markt nach Timbuktu abschoben. Vor einem der Araberzelte spielte ein kleines, etwa zehnjähriges Mädchen; wer das schöne schwarze Haar und die tiefschwarzen Augen, die nussbraune Haut und die anmutig-schmiegsame Gestalt der Kleinen betrachtete, musste sie ohne weiteres für eine echte Tochter der Wüste mit den dieser Rasse eigenen Merkmalen halten. Ihre kleinen Finger waren gerade geschäftig dabei, ein Grashemd für die schon arg mitgenommene Puppe zu flechten, die ihr ein kinderlieber Sklave vor ein oder zwei Jahren in einer freundlichen Anwandlung angefertigt hatte. Der Kopf der Puppe war etwas unförmig, aber aus Elfenbein geschnitzt, der Rumpf bestand aus einem mit Gras ausgestopften Rattenfell, die Arme und Beine aus Holzstückchen, die er an den entsprechenden Enden durchbohrt und an den Rattenfellleib angenäht hatte. Im ganzen war die Puppe zweifellos unschön, zumal sie alles andere als sauber geblieben war. Doch für die kleine Meriem war sie das Schönste und Liebenswerteste auf der ganzen weiten Welt, und das ist auch nicht verwunderlich, weil sie das einzige »Wesen« war, dem Meriem rückhaltlos trauen mochte. Alle anderen, mit denen Meriem in Berührung kam, kümmerten sich entweder überhaupt nicht um sie – oder sie waren ihr gegenüber grausam und ungerecht. Da war zum Beispiel diese alte schwarze Hexe Mabunu, der man sie übergeben hatte: die hatte keine Zähne mehr, lief immer nur schmutzig herum und verstand sich wie selten jemand auf Keifen. Sie versäumte keine Gelegenheit, das kleine Mädchen zu schlagen und – wenn es mit der ewigen Quälerei gnädiger abging – zu zwicken. Und dann der Vater erst, der Scheich, den sie mehr noch als Mabunu fürchtete. Er schalt sie oft für nichts und wieder nichts, und das Ende der fast endlosen Schimpferei war allemal, dass er sie rücksichtslos schlug, bis ihr kleiner Körper mit blauen und schwarzen Flecken wie übersät war.
Nur wenn sie für sich allein gelassen wurde, war sie glücklich. Sie spielte dann mit Geeka, schmückte ihr Haar mit Blumen der Wildnis oder flocht sich aus Gras Bänder und Schnüre. O, sie war immer lebhaft und aufgeweckt und trällerte ein Liedchen vor sich hin – so oft man sie nur mal in Ruhe ließ; denn mochte man noch so grausam und lieblos mit ihr umgehen: in ihrem kleinen Herzen blieb im Grunde die ganze große Fülle von Anmut und Heiterkeit, die sie mit auf die Welt gebracht; und die konnte man nicht ersticken! –
War der Scheich in der Nähe, so schwieg Meriem sofort und spielte lieber nicht weiter; denn sie hatte vor diesem Manne immer Angst, manchmal sogar so, dass man hätte annehmen können, sie sei dem Wahnsinn nahe. Und dann fürchtete sie sich auch vor dem dunklen, unheimlichen Dschungel, diesem grausamen Dschungel, der überall bis zum Dorfe ihre Arme ausstreckte, am Tage vor den Affen, die dort schnatterten, und den kreischenden Vögeln, und dann erst in der Nacht, wenn das Brüllen und Knurren und Stöhnen der Urwaldbestien herüberhallte. Ja, ihr bangte wohl vor dem Dschungel, aber noch viel, viel mehr vor diesem Scheich, und nicht bloß einmal war sie – das kleine ahnungslose Geschöpf, das doch die Folgenschwere seiner kindlichen Entschlüsse gar nicht ermessen konnte – nahe daran gewesen, einfach für immer in den schrecklichen Dschungel davonzulaufen, statt länger bei diesem ewig drohenden und bösen Gespenst von einem Vater leben zu müssen. –
Wie sie jetzt vor dem Lederzelt des Scheichs saß und der Geeka ein Grashemd flocht, merkte sie mit einem Male, dass der Scheich sich näherte, und sofort war das sonnige Lachen, das um ihren Kindermund gespielt, dahin. Sie sprang zur Seite, wohl in der Hoffnung, dass sie vielleicht doch noch unbemerkt dem alten Araber mit seinem lederfarbigen Gesicht entwischen könne. Allein das Kind war nicht schnell genug. Mit einem harten Fußtritt stieß er die Kleine nieder, dass sie der Länge nach aufs Gesicht fiel. Still und ohne Tränen zu vergießen blieb sie liegen; ein leises Zittern rann durch ihren Körper. Ein Fluch, eine grässliche Verwünschung – und der Mann trat in das Zelt. Die alte schwarze Hexe schüttelte sich vor Lachen und gab dabei wohl ihren einzigen Zahn zum Besten, der wahrscheinlich selber nicht wusste, wie er zu der Ehre kam, noch zu existieren.
Als das kleine Mädchen sicher war, dass der Scheich sich ins Zelt verfügt hatte, kroch es hinter das Zelt in den Schatten und blieb dort mäuschenstill liegen. Sie drückte Geeka fest an ihr Herz und meinte es gut mit der lieben kleinen Puppe, doch ab und zu war es, als wollte der ganze Jammer von Neuem über sie hereinbrechen: Sie reckte und streckte dann ihren kleinen gequälten Körper, nur um das Schluchzen zu unterdrücken. Laut weinen – nein, das durfte sie nicht wagen, denn dann würde der Scheich von Neuem seine Wut an ihr ausgelassen haben. Was ihr kleines Herz so bekümmerte, war überdies nicht etwa nur der Nachhall jener neuen Misshandlung. Unendlich tiefere innere Nöte bedrängten sie: Man versagte ihr hier jegliche Liebe, und jedes Kinderherz lechzt doch geradezu nach allem, was Liebe atmet!
Die kleine Meriem konnte es sich kaum mehr anders denken, als dass sie immer nur unter der strengen, grausamen Hand des Scheichs und Mabunus gelebt hatte. Ganz dunkel schwebte freilich beinahe wie ein Traum in den Tiefen ihrer kindlichen Seele ein Bild undeutlich und verschwommen. Dann war es ihr, als habe sie einmal eine gute sanfte, freundliche Mutter gehabt. Aber Meriem meinte, dies sei wohl mehr ein frommer Wunsch, vielleicht auch bloß der Ausdruck ihrer großen Sehnsucht nach den Liebkosungen, die sie nie selber gekostet, aber dafür der herzigen Geeka-Puppe in Hülle und Fülle schenkte. Kein Kind wurde so verwöhnt, wie Geeka, deren kleine Mutter – ganz im Gegensatz dazu wie sie von ihren eigenen »Eltern« behandelt wurde – die Nachsicht und Milde selber war. Geeka bekam tausend Küsse an einem Tag, und selbst wenn sie beim Spiel oder sonst recht unartig gewesen, gab es statt der verdienten Strafe immer neue Liebkosungen. Alles, was die kleine Meriem ihrem Puppenkinde an Zärtlichkeiten angedeihen ließ, war eben nur ein deutlicher Beweis dafür, wie sehr sie selbst nach einem wahrhaft liebenden, hegenden Mutterherzen verlangte.
Und als sie jetzt Geeka fest an sich drückte, fühlte sie, dass das Schluchzen und Zittern langsam nachließ. Nicht lange mehr und sie hatte auch ihre Stimme wieder in der Gewalt und konnte nun wenigstens der einzigen Vertrauten ihr Herz ausschütten.
Geeka liebt Meriem, flüsterte sie der Puppe in ihr Elfenbeinohr. Warum liebt mich mein Vater, der Scheich, nicht auch? Bin ich denn so ungezogen? Ich versuche ja immer, brav zu sein; doch ich weiß gar nicht, warum er mich so schlägt, und da kann ich auch nicht sagen, was ich getan haben soll oder was ihm nicht gefällt. Gerade vorhin gab er mir einen Fußtritt. O, das hat mir sehr, sehr wehgetan! Und ich saß doch bloß vor dem Zelt und flocht ein Hemdchen für dich! Das muss etwas Böses sein, denn sonst hätte er mir doch nicht dafür einen Fußtritt gegeben. Aber warum ist das etwas Böses, Geeka? Liebe Geeka, ich weiß es nicht, weiß es nicht …
Geeka schien gerade etwas einwenden zu wollen, doch sie wurde sofort unterbrochen, denn draußen vor den Toren des Dorfes hatte sich ein heftiger Streit erhoben. Man hörte lautes Stimmengewirr. Meriem spitzte die Ohren, und – neugierig wie Kinder nun einmal sind – wäre sie zu gern hingerannt und hätte sich selbst davon überzeugt, warum man sich so entsetzlich anschrie. Die anderen Dorfbewohner waren schon größtenteils auf den Beinen und stürzten in der Richtung davon, aus der der Lärm kam, aber Meriem getraute sich doch nicht mit. Der Scheich würde sicher auch dort sein und, wenn er sie sah, nur wieder die Gelegenheit benutzen, sie von Neuem zu schlagen oder zu stoßen. Meriem blieb also still liegen und horchte.
Sie hörte bald, dass die Menge sich die Dorfstraße herauf dem Zelt des Scheichs näherte, und so konnte sie der Versuchung nicht widerstehen und guckte ganz vorsichtig um die Zeltecke. Zwei Fremde sah sie mitkommen. Es waren Weiße und sie waren allein. Aber als man weiter herankam, entnahm sie aus den Gesprächen der Eingeborenen, die sich um die Fremdlinge herumdrängten, dass das stattliche Gefolge der beiden sich außerhalb des Dorfes gelagert hatte und dort das Ergebnis der Verhandlungen mit dem Scheich abwartete.
Der alte Araber empfing die Fremden am Eingang zu seinem Zelt. Er kniff seine Augen zusammen und musterte die beiden während der üblichen Begrüßung mehr als geringschätzig.
Sie seien gekommen, um Elfenbein aufzukaufen, erklärten sie. Der Scheich brummte erst etwas vor sich hin und entgegnete dann, er habe überhaupt kein Elfenbein. Meriem musste den Atem an sich halten, um nicht laut dazwischenzurufen und die Wahrheit zu sagen: denn sie wusste, dass in einer Hütte ganz in der Nähe Elefantenzahn an Elefantenzahn bis unter das Dach aufgestapelt war. Sie beugte ihr kleines Köpfchen noch weiter hervor, um die Fremdlinge besser erkennen zu können. Wie weiß war doch deren Haut! Und wie blond die langen Bärte!
Plötzlich bemerkte sie, wie der eine gerade zu ihr herüberblickte. Sie wollte sich noch zurückbeugen, denn sie fürchtete alle Männer; doch er hatte sie sicher schon gesehen, das ließ sich daran erkennen, wie sich mit einem Male Staunen und Überraschung in seinen Zügen spiegelten. Dem Scheich war diese Veränderung seines Gegenüber ebensowenig entgangen, ja er ahnte sogleich den Anlass.
Ich habe kein Elfenbein, sagte er nochmals. Ich will außerdem nichts von Geschäften wissen. Gehen Sie nur, aber gleich! Er trat ein paar Schritte vorwärts und stieß die Fremden halb und halb vor sich her. Sie sollten nur machen, dass sie wieder zum Tor hinauskämen! Als sie noch allerlei Einwände vorbrachten, verlegte sich der Scheich aufs Drohen. Wenn sie nun nicht pariert hätten, wäre das einfach Selbstmord gewesen und so machten die beiden kehrt und begaben sich unmittelbar in ihr eigenes Lager zurück.
Der Scheich trat wieder in sein Zelt zurück, doch bei Leibe nicht, um nun die Hände in den Schoß zu legen. Die kleine Meriem lag schon ganz verängstigt dicht an die Lederwand geschmiegt, als der Alte sich um die Ecke herumschlich. Er bückte sich, packte die Kleine am Arm, schleuderte sie roh zu Boden, zerrte sie vor den Zelteingang und stieß sie hinein. Und damit nicht genug: Er packte sie von Neuem und bleute sie unbarmherzig durch.
Bleib’ mir ja hier! brüllte er sie an. Dass du dich nicht unterstehst, den Fremden noch einmal unter die Augen zu kommen. Passiert es doch, dass du die Fremden dein Gesicht sehen lässt, mache ich dich tot!
Er gab ihr zur Bekräftigung seiner Drohung noch einen gehörigen Puff in die Seite und stieß sie in die äußerste Ecke des Zeltes, wo sie mit halbunterdrücktem Schluchzen und Stöhnen liegen blieb, während der Scheich auf und ab ging und dabei etwas Unverständliches vor sich hinmurmelte. Mabunu saß kichernd am Eingang.
*
Die beiden Fremdlinge waren inzwischen wieder in ihrem Lager angelangt und hatten sich sofort in eine eifrige Debatte gestürzt.
Malbihn, es ist gar kein Zweifel, die Sache stimmt ganz gewiss so. Das einzige, was mir noch Kopfzerbrechen macht: Warum hat sich der alte Schurke nicht schon lange die unerhörte Belohnung gesichert?
Ja, es gibt eben doch Dinge, an denen einem Araber mehr liegt als an Geld, Jenssen! warf der andere ein. Die Rache zum Beispiel!
Mag sein. Aber das sagt doch schließlich noch lange nicht, dass man’s nicht mal auf eine kleine Probe mit Gold ankommen lassen könnte, erwiderte Jenssen. Malbihn zuckte die Achseln. Mit dem Scheich ist nichts anzufangen. Wir versuchen es schließlich mal mit einem seiner Leute; aber er selber? Dem kannst du noch so viel Gold hinwerfen, der lässt nicht von seiner Rache. Und wenn wir zu ihm vor sein Zelt kämen und ihm auch nur mit ein paar Worten etwas von Gold und Ähnlichem sprechen, würde er sicher nur noch mehr Verdacht schöpfen … Und – das sage ich dir – wir müssten verdammt auf der Hut sein. Könnten wahrscheinlich von Glück reden, wenn wir mit dem Leben davonkämen.
Gut also. Versuchen wir es mit Bestechung! pflichtete Jenssen bei. – Aber auch dieser Versuch schlug fehl. Es wurde eine ganz schreckliche Geschichte daraus. Man hatte ein paar Tage im Lager außerhalb des Dorfes verstreichen lassen und glaubte schließlich in einem großen, kräftigen Mann, der schon lange in der Kriegerschar des Scheichs die Rolle eines Unterführers spielte, das geeignete Werkzeug für die Verwirklichung des kühnen Wagnisses gefunden zu haben. Der Mann war natürlich dem verlockenden Funkeln der angebotenen Geldbelohnung erlegen, zumal er früher an der Küste gelebt hatte und die Macht, die im Golde liegt, nur zu genau kannte. Und so versprach er den beiden, ihnen spät in der Nacht das Gewünschte zu bringen.
Unmittelbar nach Eintritt der Dunkelheit trafen die beiden Weißen ihre Anordnungen; es galt, das Lager abzubrechen, um auf alles gerüstet zu sein. Um Mitternacht war man bereit. Die Träger lagen neben ihrem Gepäck. Ein Wink, und der Rückzug konnte beginnen. Die bewaffneten Askaris hatten sich in dem Gelände zwischen dem Lagerplatz der Safari und dem Araberdorf eingenistet und sollten als Nachhut den Abmarsch decken, der in dem Augenblick zu beginnen hatte, in dem der gedungene Eingeborene mit der von den Weißen erwarteten Beute zu ihnen gestoßen war.
Bald hörte man auch Schritte auf dem Weg vom Dorfe her. Die Askaris und die Weißen waren sofort scharf auf ihrem Posten. Doch das klang ja, als käme nicht nur einer allein? Jenssen schlich den Ankömmlingen entgegen und rief sie mit gedämpfter Stimme an.
Wer ist das hier? forschte er. Mbeeda, kam die Antwort.
Mbeeda hieß der Verräter, den die Weißen bestochen, und so gab sich Jenssen zunächst zufrieden, wenn er sich auch darüber verwunderte, dass der Mann noch andere Leute mitbrachte. Dann aber begriff er mit einem Male: Man schleppte sicher das, nach dem sie so sehnlich begehrten, auf einer Tragbahre heran … Jenssen unterdrückte einen Fluch. Sollte dieser Narr ihnen etwa eine Leiche bringen? Dafür hatten sie natürlich nicht diese Belohnung ausgeworfen …
Die Träger blieben vor dem Weißen stehen. Das habt ihr mit eurem Gold erkauft, sagte der eine der beiden Träger. Sie setzten die Bahre auf die Erde, wandten sich und verschwanden in Richtung nach dem Dorfe im Dunkel der Dschungelnacht.
Malbihn blickte mit einem sauersüßen Lächeln auf Jenssen. Die Bahre war mit einem Gewand verhüllt. Nun? fragte Jenssen. Nimm das da weg und sieh, was du gekauft hast? Wir werden schrecklich viel Geld zu sehen bekommen, nicht wahr? Für eine Leiche …! Und vor allem nach den sechs Monaten unter der glühenden Wüstensonne! Denn so lange brauchen wir ja sicher, ehe wir sie ans Ziel gebracht haben.
Der Narr hätte wissen können, dass wir sie nur lebend haben wollen, polterte Malbihn unwillig heraus. Er fasste das Gewand, das über die Bahre gebreitet war, an einem Ende und zog es beiseite.
Beide traten entsetzt einen Schritt zurück …, denn das hatten sie nicht erwartet: Vor ihnen lag tot Mbeeda, der Verräter seines Herrn. Unwillkürlich stießen sie ein paar kräftige Verwünschungen hervor – und schon fünf Minuten später bahnten sich die Safari Jenssens und Malbihns rasch den Weg nach Westen, während die sehnigen Askaris, jeden Augenblick eines Angriffs gewärtig, den Rückzug deckten.