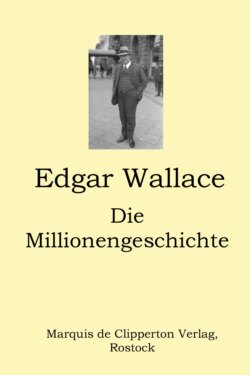Читать книгу Die Millionengeschichte - Edgar Wallace, Edgar Wallace - Страница 4
2
ОглавлениеWährend er die Treppe hinunterging, kam ihm zum Bewußtsein, daß er sich dieses Abenteuer eigentlich ganz anders vorgestellt hatte.
Er hatte nicht ganz die Rolle gespielt, die er hatte spielen wollen: freundlich, mild, überlegen und vor allem Herr der Situation. Bis zu einem gewissen Grad war ihm das allerdings gelungen, aber die Begegnung hatte sich doch reichlich prosaisch abgewickelt und hatte nichts von dem geheimnisvollen, märchenhaften Charakter, von dem er geträumt hatte. Für Margaret mußte er natürlich ein großes Rätsel sein.
John übergab dem Mann von der Garage das Auto. Wieder im Zimmer, zog er einen Vorhang vor, der den großen Raum teilte. Am hinteren Ende war ein Tisch gedeckt; er brauchte nur noch die elektrische Kaffeemaschine einzuschalten.
Nach kurzer Zeit kam Margaret die Treppe herunter. Er hatte erwartet, daß ihr der Schlafanzug und der Bademantel zu groß wären und sie nicht kleiden würden, aber sie sah sogar elegant darin aus. Den großen Schalkragen des Bademantels hatte sie mit einer Sicherheitsnadel im Nacken zusammengesteckt, so daß er ihren schönen Kopf umrahmte. Und irgendwo hatte sie ein seidenes Tuch gefunden, das sie als Gürtel benutzte. Das weite Kleidungsstück wirkte daher gar nicht unförmig, sondern hob im Gegenteil ihre schöne Gestalt noch besonders hervor.
Sie setzte sich vor den elektrischen Heizofen und hielt die Hände dagegen.
»Die sehen nicht gerade sehr schön aus«, sagte sie und lachte ihn freundlich an. »Aber Sie werden wohl begreifen, daß ich bei dem Leben nicht meine Hände pflegen konnte. Kann ich Ihnen helfen, Kaffee zu kochen? Das habe ich schon seit Jahren nicht mehr getan.«
»Nein, danke, das verstehe ich auch ganz gut«, erwiderte John und lächelte ihr zu. »Wärmen Sie sich nur. Übrigens ist der Raum oben, der dem Badezimmer gegenüberliegt, für Sie bestimmt. Ich habe absichtlich die Tür aufgelassen, und ich freue mich, daß Sie es sich bequem gemacht haben.« Er warf einen Blick auf das bunte Seidentuch, das sie so malerisch umgeschlungen hatte.
Plötzlich hob sie den Kopf und lauschte. Der Sturm hatte bedeutend an Heftigkeit zugenommen und trieb die Regenschauer gegen die Fensterscheiben. Sie zitterte ein wenig und zog ihren Stuhl näher an den Heizofen.
»Ein entsetzliches Wetter! Es wäre furchtbar gewesen, wenn ich die Nacht auf dem Hügel im Freien hätte zubringen müssen.«
Sie summte ein kleines Lied und beobachtete ihn dabei.
Er war so merkwürdig weiblich in all seinen Bewegungen und lächelte gern wie eine Frau, der es gutgeht und die sich glücklich fühlt. Seine Hände waren schmal und zart; sie konnte es deutlich sehen, als er an der Kaffeemaschine hantierte. Traurig betrachtete sie ihre eigenen und verzog das Gesicht.
»Ich liebe Komfort und eine schöne Umgebung«, sagte er. »Und ich habe auch große Vorliebe für altes, feines Porzellan, für kunstvoll geschmiedetes Silber, für gute Musik und zarte Lyrik. Spielen Sie eigentlich Klavier?«
»Ja, ein wenig.«
»Dann müssen Sie mir nach dem Essen etwas von Grieg vorspielen.«
Wieder lachte sie.
Es erschien ihr merkwürdig, daß sie sich so schnell in dieser Umgebung zu Hause fühlte. Der Mann kam ihr auch nicht mehr so unheimlich vor; außerdem konnte sie es sich ja auch nicht gestatten, andere Menschen argwöhnisch zu betrachten. Sie mußte mit allem zufrieden sein, was man ihr gab.
»Gute Musik verlangt aber auch einen guten Vortrag. Und ich bin schon lange aus der Übung.«
Während sie sich behaglich wärmte, warf sie doch ab und zu von der Seite einen Blick auf ihn und beobachtete ihn neugierig. Keine seiner Bewegungen entging ihr. Sie sah, daß er etwas aus der Tasche nahm – eine kleine Glasröhre, deren Korken er herauszog. Eine kleine, weiße Tablette fiel in eine der Tassen. Sie war noch nervös von den Erlebnissen des Tages, erschrak nun und sprang auf. Es kamen ihr plötzlich furchtbare Erinnerungen.
»Was haben Sie da eben gemacht?« fragte sie mit ängstlicher Stimme.
Er sah sie erstaunt an.
»Was soll ich denn gemacht haben?«
»Was haben Sie hier hineingetan?«
Sie nahm die Tasse und ließ die Tablette in ihre Hand gleiten.
»Was ist das?«
»Aber beruhigen Sie sich doch. Das ist eine Saccharintablette – ich nehme keinen Zucker.«
»War das denn Ihre Tasse?« fragte sie und errötete. »Ach, es tut mir unendlich leid. Ich bin noch so aufgeregt. Sie können das wohl verstehen.«
»Schon gut«, sagte er beruhigend und klopfte ihr freundlich auf die Hand. »Um Gottes willen, ich wollte Ihnen doch nichts tun! Denken Sie mal, wenn ich das beabsichtigte, hätte ich doch vorher schon viel bessere Gelegenheit dazu gehabt.«
»Es tut mir leid«, wiederholte sie noch einmal leise. »Es war sehr undankbar von mir. Sie müssen sich ein recht schlechtes Urteil über mich bilden.«
»Aber nein, durchaus nicht. Ich kenne ja die besondere Lage, in der Sie sich befinden.«
Trotz all ihrer Entschuldigungen beobachtete sie aber die Tasse genau, bis er sie mit Kaffee und Milch füllte, und sorgsam warf sie einen Blick in ihre eigene, ehe sie sich eingießen ließ. Das Essen schmeckte ihr sonst vorzüglich. Schließlich öffnete er auch noch eine Flasche Wein, achtete aber sorgsam darauf, daß er nicht mehr einschenkte, als sie wünschte. Zum Abschluß des Essens bot er ihr noch verschiedene Liköre an, schob ihr nachher ihren Sessel wieder nahe an den Heizofen und nahm ihr gegenüber Platz.
»Margaret Smith – oder soll ich Sie lieber Margaret nennen? –, ich möchte ganz offen mit Ihnen reden, denn ich bin sicher, daß Sie mir deshalb nicht böse sind. Selbstverständlich ist alles, was ich Ihnen erzähle, vertraulich. Ich weiß auch, daß Sie niemals darüber sprechen werden. Zwei Ereignisse aus Ihrer Vergangenheit sind mir bekannt, sonst nichts. Und ich möchte auch nicht mehr wissen. Erstens habe ich erfahren, daß Sie bis heute morgen im Frauengefängnis von Aylesbury waren, wo Sie eine lebenslängliche Zuchthausstrafe absitzen sollten. In England bedeutet eine solche Verurteilung eine Strafe von zwanzig Jahren, sie kann aber durch gutes Verhalten um einige Jahre gekürzt werden. Welches Verbrechen Sie begangen haben, daß man Sie so schwer bestrafte, habe ich nicht erfahren und mich auch nicht darum gekümmert. Von Ihrer Strafe haben Sie bis jetzt drei Jahre abgesessen, Sie hätten also noch weitere siebzehn Jahre im Zuchthaus bleiben müssen.«
»Nein, zwölf«, verbesserte sie. »Es wären noch zwölf gewesen, wenn ich nicht aus der Anstalt entkommen wäre. Sollten sie mich jetzt allerdings wieder fassen, so muß ich siebzehn Jahre absitzen, dann wird mir nichts geschenkt werden.«
»Nun ja, es bleibt bei den beiden Tatsachen: Sie sind aus der Anstalt geflohen und müßten noch siebzehn Jahre absitzen, wenn Sie wieder gefangen würden. Wenn ich also nicht mit meinem Wagen in die Gegend gekommen wäre und Sie am Fuß von Whitecross Hill getroffen und nach London mitgenommen hätte, dann hätte man Sie wahrscheinlich wieder gefaßt, und Sie säßen in diesem Augenblick wieder in einer Zelle in Aylesbury und warteten auf eine weitere Verurteilung.«
Sie nickte.
»Ich hörte von Ihrer Flucht, als ich in Aylesbury zu Mittag aß. Ich hatte eine kleine Reparatur an meinem Wagen, und der Monteur erzählte mir, daß heute morgen eine Strafgefangene ausgebrochen sei. Ich erfuhr auch, daß Sie zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt worden waren. Wie Sie heißen, welche Tat Sie begangen hatten, wußte der Mann nicht. Wie sollte er das auch erfahren haben? Die Leitung der Anstalt hatte wahrscheinlich keine anderen Nachrichten in die Öffentlichkeit kommen lassen.«
»Ich bin für ein Verbrechen verurteilt worden, an dem ich unschuldig bin«, erwiderte sie leise.
»Es tut mir leid, daß Sie das sagen. Ich hoffte sogar im stillen, daß Sie schuldig wären.«
Sie sah ihn überrascht an, und zu seinem Erstaunen huschte ein leichtes Lächeln um ihre Mundwinkel.
»Und sicher sind Sie auch schuldig«, fuhr John Sands fort. »Alle Leute, die verurteilt werden, sind schuldig. Der Unschuldige kommt eigentlich nur in Kriminalromanen vor. Ich will ganz offen Ihnen gegenüber sein: Ich brauche die Hilfe eines Menschen mit verbrecherischer Veranlagung. Solche Leute sind klug und wissen sich in allen Lagen zu helfen. Verstehen Sie mich recht, ich will nicht, daß Sie noch ein weiteres Verbrechen begehen. Nur sollen Sie den englischen Behörden gegenüber einen anderen Namen gebrauchen als den Ihrigen und weiter unter diesem Namen leben. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, daß Sie unter Ihrem eigenen Namen heiraten würden.«
»Heiraten?« sagte sie und schaute ihn groß an.
»Ja, heiraten«, wiederholte er. »Ich gebe zu, daß die Aussicht nicht gerade sehr anziehend sein mag, aber für Sie bedeutet es ein ruhiges, sorgenfreies Leben, sogar einen gewissen Luxus, interessante Reisen und vieles andere.«
»Wollen Sie mich etwa heiraten?« fragte sie direkt.
John sah ihr voll ins Gesicht und zuckte nicht mit der Wimper.
»Es ist mein Wunsch, daß Sie Harry Leman heiraten.«
»Harry Leman?« entgegnete sie fragend. »Harry Leman? Meinen Sie den bekannten amerikanischen Petroleumkönig?«
Er nickte.
»Ja. Harry Leman ist vielfacher amerikanischer Millionär und hat sein Vermögen in Petroleumaktien angelegt. Das wäre das erste, was ich Ihnen mitzuteilen hätte. Zweitens müssen Sie wissen, daß Harry Leman ein Freund von mir ist – tatsächlich bin ich der einzige Freund, den er in Europa oder in den Vereinigten Staaten hat. Ich mache nun den Vorschlag, daß Sie Harry Leman nächsten Montag in einer Woche auf dem Standesamt in Griddelsea heiraten. Die besondere Genehmigung dazu werde ich beschaffen – vielleicht wird es auch schon Donnerstag sein, aber ich glaube, Montag paßt doch besser.«
Sie legte den Kopf zurück und lachte auf.
»Das ist aber merkwürdig, daß Sie alle die Vorkehrungen schon getroffen haben, ohne vorher im mindesten meine Einwilligung einzuholen.«
»Das stimmt, aber Sie müssen doch selbst zugeben, daß ich keine Gelegenheit hatte, Sie vor heute abend kennenzulernen.«
»Haben Sie denn bei diesem Plan schon immer an mich gedacht?«
»Wenn ich offen sein soll, habe ich das nicht getan. Nein, bis heute morgen lebte die Frau, die mein Freund Harry heiraten soll, nur in meiner Phantasie. Aber nun haben wir uns doch getroffen, und das schreibe ich wieder einmal dem Einfluß meines guten Sterns zu, unter dem ich geboren bin und unter dem ich lebe. Sicherlich kennen Sie Bellatrix, das ist der Stern Gamma im Bild des Orion ... Nein? Dann haben Sie sich bisher noch nicht mit Astronomie und Astrologie beschäftigt. Ich gebe zu, daß ich früher bei meinen Plänen nicht an Sie gedacht habe. Aber heute ist ein Wunder geschehen, auf geradezu märchenhafte Weise sind Sie in mein Leben getreten.«
»Aber nehmen wir einmal an, daß ich mit all Ihren Vorbereitungen nicht einverstanden bin. Wenn ich nun nicht mitmache?«
»Dann müßte ich Sie allerdings bitten, wieder Ihre nassen, schwarzen Kleider anzuziehen. Ich würde Sie ins Auto setzen und Sie wieder an die Stelle zurückbringen, wo ich Sie heute abend gefunden habe. Das klingt sehr unfreundlich, und ich gebe Ihnen die Versicherung, daß ich es gar nicht so böse mit Ihnen meine. Im Gegenteil, ich bin stets für ein friedliches und beschauliches Leben und nicht für große Aufregungen. Ich erkläre Ihnen feierlich, daß ich dieses ganze Abenteuer nicht unternommen hätte, wenn ich nicht so große Sorge um meinen Freund Harry Leman hätte. Er ist ein etwas sonderbarer, älterer Herr.« Sands schüttelte bedächtig den Kopf. »Und ich muß sagen, daß ich ihn wirklich gern habe.«
»Nun, wir brauchen ja nicht darüber zu sprechen, was passieren würde«, erwiderte sie ruhig, »denn ich bin nicht so töricht, Ihr Anerbieten ohne weiteres zurückzuweisen. Aber ich muß Ihnen doch sagen, daß ich nicht so scharf darauf aus bin, noch einmal zu heiraten.«
»Dann waren Sie also schon einmal verheiratet?« fragte John Sands, der plötzlich aus seiner beschaulichen, ruhigen Stimmung in die rauhe Wirklichkeit geschleudert wurde. »Sind Sie wieder frei, so daß Sie heiraten können?«
Sie nickte.
»Es wäre allerdings verteufelt unangenehm gewesen, wenn Sie schon einen Mann gehabt hätten – wirklich höchst unangenehm!«
»Was erwarten Sie denn von mir? Was soll ich tun?« fragte sie sachlich.
»Jetzt sollen Sie sich ins Bett legen und ordentlich ausschlafen. Morgen in aller Frühe kommt eine Frau hierher und bringt das Haus in Ordnung. Ich werde ihr erklären, daß Sie meine Schwester seien, die plötzlich unerwartet zu Besuch kam. Und da Sie Ihren Koffer verloren haben, schicke ich sie in die Stadt, damit sie alles kauft, was Sie brauchen. Seien Sie aber vorsichtig. Sie braucht ja nicht nach oben in Ihr Zimmer zu kommen und Sie sehen, sonst könnte die Sache vielleicht etwas unangenehm werden«, meinte er lächelnd und betrachtete sie wieder. »Sie können ja wohl die Kleider, die Sie vorher trugen, in Ihrem Zimmer trocknen – hoffentlich sind keine Stempel vom Gefängnis darin.«
Sie schüttelte den Kopf.
»Nein, es sind gar nicht meine Kleider. Sie gehören der Gefängnisärztin. Ich habe sie mir heute früh angeeignet und den Sträflingsanzug dortgelassen. Ich habe es nämlich so einrichten können, daß ich durch ihr Haus floh.«
»Das ist allerdings sehr gut, ganz vorzüglich.«
Sie erhob sich.
»Ich fühle aber deutlich, daß Sie mir noch nicht alles gesagt haben. Sie halten mit etwas zurück.«
»Es gibt verschiedenes, was ich Ihnen bis jetzt noch nicht gesagt habe. Aber das hat noch Zeit und kann bis später warten. In Ihrer jetzigen Verfassung sind Sie nicht fähig, alles zu verstehen. Sie müssen erst ruhiger werden. Wenn erst einige Tage vergangen sind, haben Sie den nötigen Überblick und die nötige Sicherheit, dann können wir über das Weitere reden.«
Sie ging die Treppe hinauf, aber als sie etwa auf der Hälfte war, rief er ihr nach: »Ich schlafe heute nacht nicht hier im Haus, aber morgen früh komme ich zeitig wieder her. Unten in der Diele ist ein Telefon; wenn Sie etwas brauchen sollten oder mich anrufen wollen, können Sie mich unter Paddington 1764 erreichen. Hoffentlich fällt es Ihnen nicht ein, während meiner Abwesenheit das Weite zu suchen. Geben Sie mir Ihr Wort darauf.«
Sie lachte.
»Keine Angst. Ich verlasse dieses Haus nicht, wenn ich nicht jemand bei mir habe, der mich in Schutz nehmen kann.«
»Sie sind klug und vorsichtig. Und soweit ich sehe, sind Sie auch unter einem guten Stern geboren. Ich rate Ihnen nur, achten Sie sehr darauf.«
»Auf die Sterne?« rief sie vom obersten Treppenabsatz herunter, und ihre Stimme klang etwas verächtlich.
»Sie mögen jetzt im Augenblick darüber lachen«, entgegnete er überzeugt. »Aber für mich haben sich Astronomie und Astrologie sehr wohl bezahlt gemacht.«
Sie ging ins Schlafzimmer hinauf und setzte sich oben auf die Bettkante. Ihre Gedanken wirbelten durcheinander, während sie hörte, daß er unten umherging. Einmal sang er sogar leise eine einschmeichelnde Melodie. Seine Stimme hatte einen sonderbaren Klang, der ihr zu Herzen ging. Nach einer Weile knipste er das Licht aus, dann schloß er die Haustür von außen. Sie lehnte sich lächelnd in die Kissen zurück. Seit langer Zeit fühlte sie einmal wieder zartes Leinen und weiche Daunenkissen. Sie wußte gar nicht, wie müde sie war. Das kam ihr erst zum Bewußtsein, als sie wieder aufwachte. Sie glaubte, sie hätte nur die Augen geschlossen und wieder aufgemacht, aber merkwürdigerweise war es heller, lichter Morgen.