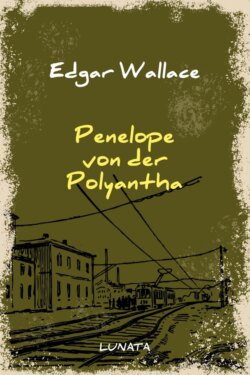Читать книгу Penelope von der Polyantha - Edgar Wallace, Edgar Wallace - Страница 8
3
ОглавлениеDer Decksteward mußte sich geirrt haben. Penelope sagte sich das tausendmal auf der Fahrt zwischen Liverpool und London. Es war doch zu absurd und lächerlich, daß dieser liebenswürdige, nette Herr der Boss einer gemeinen Verbrecherbande sein sollte, die unglückliche Opfer ausplünderte. Mr. Beddle hatte sich ganz bestimmt getäuscht. Mr. Dorbans Gesichtszüge waren nicht besonders charakteristisch, und man konnte ihn leicht verwechseln. Wozu sollte ein Falschspieler auch eine Sekretärin engagieren? Und warum sollte er zurückgezogen in einem Dorf in Devonshire leben? Sie wußte doch, daß Mr. Dorban eine große Erbschaft in Aussicht hatte. Außerdem hatte er so viel zu tun, daß er eine Sekretärin brauchte.
Mr. Dorban und seine Frau hatten sich ziemlich nachlässig und gleichgültig begrüßt. Keiner der beiden schien über das Wiedersehen besondere Freude zu fühlen.
Mr. Dorban hatte in der Bahn ein ganzes Abteil reservieren lassen, so daß sie allein blieben. Penelope wunderte sich, warum sie nicht in den Gang hinausgehen durfte. Sie hätte die beiden gern allein gelassen, damit sie sich nach so langer Trennung ungestört unterhalten konnten, aber sobald sie ihre Absicht andeutete, wurde sie von Cynthia zurückgehalten.
Mr. Dorban war ein interessanter Gesellschafter. Penelope schien es, als ob er die ganze Zeit von Abgang des Zuges bis nach London erzählte. Er sprach mit einer klangvollen, angenehmen Stimme und war sehr unterhaltend.
Er hatte braune Augen, und im allgemeinen liebte Penelope Männer mit braunen Augen nicht. Aber Mr. Arthur Dorban gefiel ihr trotzdem ganz gut. Sie fühlte sich eigentlich mehr zu ihm als zu Cynthia hingezogen. Kanada kannte er freilich nur oberflächlich.
»Ich bin einmal dort gewesen, als ich noch jung war«, sagte er. »Aber ich liebe Seereisen nicht. Ich will lieber freiwillig zehntausend Pfund zahlen als eine Reise über den Atlantischen Ozean machen.«
»Sind Sie früher häufig in Amerika gewesen?« fragte Penelope neugierig.
»Ich habe den Atlantik zweimal überquert«, entgegnete er vergnügt lächelnd. »Ich mußte das zweimal tun, weil ich sonst nicht nach England zurückgekommen wäre, Miss Pitt!«
Die Nacht verbrachten sie in einem kleinen Londoner Hotel, Mrs. Dorban nahm ein Auto und fuhr mit Penelope durch den Hyde Park. Das Mädchen war erstaunt und erfreut. Sie hatte sich London immer als einen Haufen niedriger, schmutziger Ziegelhäuser vorgestellt. Der Park machte einen großen Eindruck auf sie. Hinter dem dunklen Grün der Bäume tauchten die Türme und hohen Gebäude der Stadt auf. Sie war begeistert von dem Anblick der herrlichen Blumenbeete und des silberhellen Wassers.
Am nächsten Morgen fuhren sie mit dem Frühzug nach Torquay und erreichten spät am Mittag Borcombe.
Stone House, der Wohnsitz der Dorbans, lag nach der See zu in einer Talmulde der mit Grün bestandenen Dünen. Das Haus war ziemlich unregelmäßig gebaut. Oben von den roten Steinklippen aus konnte man es nicht sehen, und unten war es nach der Küste zu hinter einer Reihe von Ahornbäumen halb verborgen. Es war Ende des achtzehnten Jahrhunderts von einem Mann errichtet worden, der sich völlig von der Welt zurückgezogen und nur noch seinen Liebhabereien gelebt hatte.
Ein ziemlich steiler, enger Weg führte von den Klippen abwärts zu dem Gebäude. Seine schwere Zugänglichkeit war schon seit Generationen allen Handelsleuten ein Dorn im Auge.
Penelope erschien dieses Anwesen wie ein Paradies. Auf abschüssigem Gelände zog sich der Garten hin, in dem farbenprächtige Blumen wild wuchsen oder vom Gärtner gezogen wurden. Unten bildete eine Ziegelmauer die Grenze. Durch ein altes Tor kam man von hier aus auf einem Privatweg – es war eigentlich weniger ein Weg als eine Reihe von Steinstufen, die auf einer breiten Felsplatte endeten – zu dem Schuppen, in dem Mr. Dorbans starkes Motorboot untergebracht war. Die Natur hatte hier eine ideale Anlegestelle geschaffen, denn das Bootshaus, dessen Dach von zwei Felsen getragen wurde, lag an der innersten Stelle einer kleinen Bucht und wurde bei stürmischer See durch zwei Felsenriffe geschützt, die ziemlich weit vorsprangen und einen natürlichen Hafen bildeten.
»Entzückend, nicht wahr?« fragte Cynthia gleichgültig. Sie schien sich kaum für solche Dinge zu begeistern oder auch nur zu interessieren, sie war vollkommen auf die praktische Seite des Lebens eingestellt. »Es ist ein langer Weg bis zum Dorf, aber wir haben ein Auto, damit wir nicht hinaufklettern müssen. Können sie eigentlich selbst fahren?«
Penelope nickte.
»Schön. Und jetzt sehen Sie sich Ihr Zimmer an.«
Cynthia führte sie eine breite Treppe empor, dann durch einen langen, dunklen Gang, an dessen Ende das Zimmer lag. Es war klein und einfach eingerichtet, aber es hatte zwei Fenster, durch die man auf die smaragdgrüne See und die dunkelroten Klippen blicken konnte.
Penelope atmete tief ein, als sie diese Schönheit sah.
»Gefällt es Ihnen?« fragte Cynthia und beobachtete sie genau.
»Es ist herrlich!«
Mrs. Dorban lachte kurz auf. »Für mich ist es die Hölle«, sagte sie.
Die Tage vergingen erstaunlich schnell. Penelope fand viel mehr Arbeit vor, als sie zuerst erwartet hatte. Ein Zimmer im Erdgeschoß war als Arbeitszimmer eingerichtet, und gewöhnlich ließ man sie dort allein.
Nach dem Frühstück, das sie in dem dunkelgetäfelten Speisezimmer einnahm, ging sie in das Arbeitszimmer und war dann bis zur Mittagszeit dauernd mit Pachtverträgen und anderen Dokumenten beschäftigt, die sich auf Güter in den verschiedenen Teilen des Landes bezogen.
Es waren keine Originale, sondern beglaubigte Abschriften, die offenbar von einem Londoner Rechtsanwalt beschafft worden waren. Penelope war damit betraut worden, den ungefähren Wert der Liegenschaften und Güter festzustellen. Um ihr diese Aufgabe zu erleichtern, standen unzählige Verkaufskataloge, Auktionsberichte und Statistiken über Landverkäufe zu ihrer Verfügung.
»Natürlich kann ich nicht von Ihnen verlangen, daß Sie den genauen Wert jeder Besitzung ausrechnen«, erklärte Mr. Dorban am ersten Morgen, als sie ihre Arbeit begann. »Es ist verteufelt schwer, ihn auch nur annähernd festzustellen. Aber die Preise sind in England ziemlich gleich, und der Wert eines Gutes in Norfolk entspricht ungefähr dem eines andern von derselben Größe.«
Zu ihrer weiteren Unterstützung erhielt sie noch den Anzeigenteil der Times und anderer Zeitungen, wenn da von Landverkäufen die Rede war. Aber die übrigen Seiten der Zeitungen bekam sie während ihres ganzen Aufenthaltes in Stone House nicht zu sehen.
Sie fand es ein wenig schwierig, Cynthias Angabe, daß ihr Mann Forscher sei, mit den Tatsachen in Einklang zu bringen. Im ganzen Haus entdeckte sie keine zwanzig Bücher. Cynthia war zwar bei einer Leihbibliothek abonniert, und stets wurden die neuesten Bücher geschickt. Aber weder Cynthia noch ihr Mann nahmen je Gelegenheit, hineinzuschauen. Schließlich nahm Penelope an, daß man nur ihr damit eine Unterhaltung verschaffen wollte, und mit dieser Vermutung hatte sie auch recht.
Mit den Dienstboten sprach Penelope niemals, denn sie verstand sie nicht. Alle Angestellten, mit Ausnahme des Gärtners, waren Franzosen, und Penelopes Kenntnisse in dieser Sprache waren gering.
Nachmittags und abends hatte sie frei und konnte tun, was sie wollte. Das stimmte allerdings nicht ganz, denn sie durfte niemals allein zum Dorf gehen. Cynthia oder Mr. Dorban begleiteten sie stets dorthin. Manchmal fuhr sie auch in seinem Wagen in der Gegend spazieren, und manchmal machten die drei eine Fahrt mit dem Motorboot, der ›Princess‹. Aber Penelope hatte das unangenehme Gefühl, stets bewacht zu werden, und dagegen lehnte sie sich auf.
Eines Tages trat eine neue, vielleicht unvermeidliche Verwicklung ein.
Cynthia war nach London gefahren, um einige Besorgungen zu machen. Penelope arbeitete in ihrem Raum, als Mr. Dorban hereinkam. Er war wie gewöhnlich tadellos gekleidet.
»Lassen Sie doch diese verrückten Dinge und kommen Sie mit zum Fischfang hinaus«, sagte er.
Penelope zögerte. Seine Haltung ihr gegenüber war stets einwandfrei und korrekt gewesen. Sie suchte sich zu entschuldigen, aber er ließ keinen Grund gelten.
»Unsinn! Die Arbeit kann bis morgen warten. Sie haben zwei Jahre Zeit, diese schrecklichen Papiere in Ordnung zu bringen.«
»Ich habe mich schon oft gewundert, warum Sie das alles nicht selbst machen«, meinte Penelope, als sie die Stufen zur Küste hinunterstiegen. »Die Arbeit ist doch nicht schwer, und Sie verstehen die Sache doch besser als ich.«
Er pfiff leise vor sich hin, wie es seine Gewohnheit war, und schwieg eine Weile. Erst als sie das Bootshaus erreicht hatten, sprach er wieder. »Ich hasse Zahlen und Büroarbeit jeglicher Art. Ich bin mehr für die freie Natur geschaffen, für die See.«
»Ich dachte, Sie könnten das Meer nicht leiden.«
»Ich liebe keine großen Schiffe und vor allem keine langen Reisen«, erwiderte er kurz und sprach dann über etwas anderes.
Das Boot fuhr in das ruhige Wasser der Bucht von Borcombe hinaus. Penelope saß am Steuer; Mr. Dorban, der einen weißen Staubmantel angezogen hatte, bediente den starken Motor.
Als sie drei Meilen von der Küste entfernt waren, stoppte er plötzlich die Maschine und setzte sich.
»Nun, was halten Sie von England?« fragte er.
»Wollen wir jetzt nicht fischen?«
Er schüttelte den Kopf. »Wir haben keine Angelschnüre dabei. Fischen langweilt mich auch. Kommen Sie zu mir.«
Der vordere Teil des Bootes war sehr bequem eingerichtet. Aber sie zögerte. Sie hatte das Gefühl, daß eine unangenehme Situation eintreten könnte, und es tat ihr jetzt leid, daß sie mitgefahren war.
Mr. Dorban hatte sich über den kleinen Tisch geneigt; in der schmalen Hand hielt er Spielkarten, die er mechanisch mischte. Seine melancholischen braunen Augen schauten auf die Küste zurück, und seine Mundwinkel zogen sich nach unten, als ob plötzlich ein großer Schmerz über ihn gekommen wäre. Der Wechsel in seiner Haltung war so auffallend, daß sie ihn verwundert anschaute. Plötzlich wandte er sich nach ihr um. »Was halten Sie eigentlich von Cynthia?« fragte er unerwartet.
»Das ist eine merkwürdige Frage.« Penelope zwang sich zu einem Lächeln.
»Sie ist nicht merkwürdig, sie ist ganz natürlich. Sehen Sie her, ich will Ihnen einen Trick zeigen. Mischen Sie die Karten.«
Er schob ihr das Päckchen hin, und sie nahm es auf. »Mischen Sie doch!« sagte er ungeduldig, und sie gehorchte.
»Cynthia ist eine kaltblütige Natur, das wird Ihnen auch schon aufgefallen sein. Sie hat ihren eigenen Willen, und es ist schwer, mit starrköpfigen Menschen zusammenzuleben.«
»Hier sind die Karten.«
Er nahm sie in seine schlanken Hände. Einen Augenblick blätterte er sie durch, und das Weiß und Gold der Ränder verschwamm undeutlich ineinander. Dann legte er sie mit einer eleganten Bewegung vor sie auf den Tisch: As, König, Dame, Bube, Zehn und so weiter – die ganze Reihe entlang. Farbe für Farbe war geordnet, jede Karte lag nach ihrem Wert an der richtigen Stelle.
Penelope schaute ihn verwirrt an, denn sie hatte die Karten gründlich gemischt, und er legte die Karten so auf, als ob sie sie genau der Reihe nach geordnet hätte.
El Slico! Die Worte des Deckstewards fielen ihr wieder ein.
»Nun?« Er lachte.
»Wie haben sie das gemacht?« fragte sie verwundert. Über ihrem Interesse vergaß sie ihren Argwohn.
»Mischen Sie noch einmal!«
Sie tat es wieder und sortierte die Karten absichtlich so, daß auch nicht zwei von einer Farbe zusammenblieben. Er nahm sie, und gleich darauf legte er sie wieder wohlgeordnet auf.
»Ein so großartiges Kartenkunststück habe ich noch niemals gesehen!« entfuhr es Penelope.
»Macht Ihnen das Spaß?« fragte er gleichgültig und ließ die Karten wieder in seine Tasche gleiten. »Aber Sie haben mir noch gar nicht gesagt, was Sie von Cynthia halten.«
»Diese Frage habe ich, offen gesagt, nicht von Ihnen erwartet. Ich möchte nicht darauf antworten. Sie war sehr freundlich zu mir.«
»Da irren Sie. Cynthia ist niemandem freundlich gesinnt. Manchmal wünschte ich, daß sie tot wäre.« Er sagte das so ruhig, daß sie kaum ihren Ohren trauen wollte.
»Aber Mr. Dorban«, rief sie entsetzt.
Er mußte lachen.
»Sie denken, daß ich ein brutaler Mensch sei – aber das stimmt nicht. Ich weiß nur keinen anderen Weg, Cynthia loszuwerden ... Sie schauen mich ja so entgeistert an, als ob Sie glauben, ich wolle sie ermorden. Das ist durchaus nicht der Fall. Ich konstatiere nur eine unangenehme Tatsache. Es gibt für mich keine andere Möglichkeit, mich von ihr zu trennen. Ich habe die Sache mit ihr besprochen. Es wird Sie interessieren, das zu erfahren. Sie weiß ganz genau, daß ich sie nicht entfernen kann. Ich kann mich nicht von ihr scheiden lassen, und sie läßt sich auch nicht von mir scheiden. Ich kann nicht von ihr fortgehen aus Gründen, über die ich jetzt nicht sprechen möchte. Ich kann sie nicht schlecht behandeln, weil es nicht in meinem Charakter liegt, Damen irgendwie zu beleidigen. Das widerstrebt meiner Natur. Nicht einmal für unheilbar geisteskrank kann ich sie erklären lassen, denn sie ist die vernünftigste Person, die ich kenne. Und doch sehne ich mich nach dem Verständnis und der Liebe, die ich bei Cynthia niemals gefunden habe. Wir sind nämlich nur im Sinne des Gesetzes miteinander verheiratet. Was Liebe und Zuneigung bedeutet, weiß Cynthia überhaupt nicht.«
Penelope hatte bestürzt zugehört.
»Natürlich weiß Cynthia das alles, und ich glaube, sie hat Sie nur deswegen engagiert, damit Sie mich trösten.«
»Wissen Sie auch, was Sie da sagen?« fragte Penelope streng.
»Ich weiß genau, was ich sage« entgegnete Mr. Dorban und zündete sich eine Zigarette an. »Ich habe Sie um Ihre Liebe gebeten.«
Penelope erhob sich und ging wieder nach hinten. Er folgte ihr.
»Wir wollen wieder nach Hause fahren. Da Sie nicht auf meine Bitte eingegangen sind, wollen wir auch nicht mehr darüber sprechen. Vergessen Sie, daß ich jemals davon gesprochen habe. Wenn Sie mir nicht mehr vertrauen und nach Kanada zurückkehren möchten, werde ich dafür sorgen, daß Sie morgen abfahren können, selbst wenn Cynthia nicht damit einverstanden sein sollte. Wenn Sie sich aber auf der anderen Seite auf mein Wort verlassen wollen, auf das Wort El Slicos –«
»El Slico!«
Er lachte leise vor sich hin.
»Natürlich wußten Sie, daß ich El Slico bin. Ich sah, wie Sie neben dem alten Beddle standen. Er kennt mich sehr gut und hat Ihnen sicher gesagt, wer ich bin. Ja, ich bin El Slico. Aber erwähnen Sie Cynthia gegenüber nicht, daß Sie das wissen. Sie würde tausend Ängste ausstehen, wenn sie erführe, daß ich erkannt worden bin.«
»Aber Mr. Dorban«, sagte das junge Mädchen entsetzt. »Sie können doch nicht erwarten, daß ich bei Ihnen bleibe!«
»Sie können bleiben oder gehen, wie Sie wünschen«, erwiderte Arthur Dorban und warf den Motor an. »Ich selbst kann Ihnen nur den guten Rat geben, zu bleiben. Sie werden zugeben, daß ich offen war und mir Ihnen gegenüber nichts zuschulden kommen ließ. Ich würde an Ihrer Stelle nicht nach Kanada zurückgehen. Sie können ruhig auch Cynthia alles erzählen – sie wird die Sache wahrscheinlich schon vermutet haben. Ich glaube allerdings nicht, daß sie Sie wegen Ihrer Zurückhaltung besonders achten wird oder daß sie eine besondere Tugend darin sieht, daß Sie mich abschlägig beschieden haben.«
Penelope antwortete nicht und blieb den ganzen Nachmittag in ihrem Zimmer. Sie war in einer merkwürdigen Lage. Wenn das in Kanada vorgefallen wäre, hätte sie gewußt, was zu tun war. Aber unter diesen Umständen, in einem fremden Lande, ohne Freunde, ganz allein, fiel es ihr sehr schwer, einen Ausweg zu finden.
Die Aufrichtigkeit dieses Mannes hatte natürlich einen gewissen Eindruck auf sie gemacht. Sie wußte ja noch nicht, daß El Slicos größte Stärke in seiner einnehmenden Offenherzigkeit lag. Sollte sie sein Angebot annehmen und abfahren, oder sollte sie noch einige Zeit auf ihrem Posten bleiben, bis sie das nötige Geld zusammengespart hatte, um sich eine Stelle in London suchen zu können? Ob es nun richtig oder falsch war, Penelope entschied sich dafür, zu bleiben.
Als sie schon am Einschlafen war, erinnerte sie sich plötzlich daran, daß irgendwo in London ein gewisser Mr. James X. Orford wohnte, an den sie sich ja wenden konnte, wenn sie in Gefahr kam.