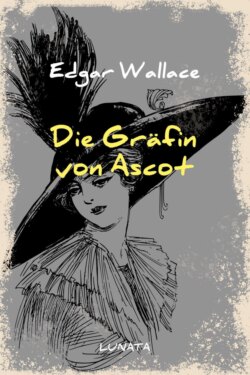Читать книгу Die Gräfin von Ascot - Edgar Wallace, Edgar Wallace - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеMrs. Carawood wurde Tag und Nacht von dem Gedanken gequält, daß Mr. John Morlay ein Privatdetektiv war. In ihrem kleinen Büro in der Penton Street dachte sie dauernd darüber nach. Diese Entdeckung hatte sie in panischen Schrecken gestürzt, und sie hatte sich von ihrem Entsetzen noch nicht wieder erholen können. Aber sie war jetzt wenigstens fähig, klar und vernünftig zu überlegen. Einen Entschluss hatte sie gefaßt: Sie mußte alles daransetzen, diesen jungen Mann auf ihre Seite zu ziehen. Er mußte ihr Freund werden, er durfte nicht eine unheimliche Drohung für sie bleiben. Aber wie sollte sie dieses Ziel erreichen?
Er mochte Marie gern. Einen kurzen Augenblick hatte sie gesehen, wie er das junge Mädchen voll aufrichtiger Bewunderung und Verehrung anschaute. Gefühlsmäßig wußte sie, daß er nur nach Cheltenham gekommen war, um Marie zu sehen. Wer hatte ihm den Auftrag dazu gegeben? Die Familie Fioli war nahezu ausgestorben; es gab keine Mitglieder des alten Adelsgeschlechts, die sich für das Mädchen interessieren konnten. Manchmal war dieser schreckliche Gedanke allerdings schon in ihr aufgetaucht.
Aber wenn andere Leute Privatdetektive bezahlen konnten, um die Geheimnisse um Marie zu lüften, konnte sie denn nicht auch derartige Leute engagieren, um sie zu hüten? Am Montag ging sie zu ihrem Rechtsanwalt und fragte ihn nach der Firma Morlay aus. Sie erfuhr, daß John bei seinen Geschäftsfreunden den besten Ruf genoß, und hielt es nun für ausgeschlossen, daß er eine Gefahr für sie bedeutete. Rasch entschied sie sich dafür, geradewegs in die Höhle des Löwen zu gehen.
John Morlay war aufs höchste erstaunt, als sie ihm gemeldet wurde. Er schob seine Arbeit zur Seite und erhob sich.
»Das ist aber ein unerwartetes Vergnügen, Mrs. Carawood«, begrüßte er sie freundlich.
Ihre Lippen und ihr Gaumen waren trocken, und es dauerte ein paar Sekunden, bis sie sprechen konnte.
»Ich komme in einer geschäftlichen Angelegenheit, Mr. Morlay«, erwiderte sie nervös.
»Es tut mir leid, das zu hören«, entgegnete er lächelnd, während er ihr einen Stuhl hinschob. »Alle Leute, die herkommen, haben ihre Sorgen, und sie kommen erst dann zu mir, wenn sie von anderen Leuten rücksichtslos beschwindelt worden sind.«
Sie schüttelte den Kopf.
»Ich bin nicht beschwindelt worden – und ich glaube auch nicht, daß mich so leicht jemand betrügen kann.«
Aus dieser Bemerkung schloß er, daß sie mit ihren geschäftlichen Erfolgen und ihrer Tüchtigkeit zufrieden sein konnte.
»Nein, ich wollte Sie wegen einer anderen Sache fragen –«
Sie machte eine Pause, und er sah sie erwartungsvoll an.
»Es handelt sich um Mylady.«
»Ach, Sie meinen die Gräfin Fioli?«
Sein Interesse stieg aufs höchste, als sie nickte.
»Sie ist doch nicht in irgendwelche Schwierigkeiten geraten?«
»Nein. Mylady versteht nichts von Geschäften. Es ist – es ist etwas anderes.« Nach einer kleinen Pause fuhr sie fort: »Wie Sie sicher wissen, bin ich die Sachverwalterin für Mylady und kümmere mich auch um ihr Wohl und ihre Erziehung. Als ihre Mutter starb, war Mylady nur ein paar Wochen alt. Die Gräfin übergab mir das Kind, und ich habe ihr versprochen, alles zu tun, was in meinen Kräften steht. Und seit dieser Zeit habe ich für Mylady gesorgt.«
»Sie sind wohl Witwe?«
»Ja, ich stehe allein; ich habe keinen Menschen, auf den ich mich verlassen kann. Nicht einmal meinem eigenen Rechtsanwalt kann ich sagen, was ich Ihnen mitteilen möchte, Mr. Morlay, und gerade in diesem Augenblick fühle ich so sehr, daß ich die Hilfe eines Mannes brauche.«
Sie machte wieder eine Pause. Als sie von zu Hause fortging, war ihr der Plan so überzeugend erschienen, aber nun fiel es ihr schwer, davon zu sprechen.
»Ich brauche jemanden, der die Interessen der jungen Gräfin wahrnimmt«, sagte sie schnell, »jemanden, an den ich mich wenden kann, wenn es Schwierigkeiten und Sorgen geben sollte. Und ich dachte, Sie könnten mir vielleicht helfen.«
Er war erstaunt über ihren Vorschlag, denn ein solches Angebot hatte er am letzten erwartet. Und er wollte auch nicht Beschützer und Schutzengel der Gräfin Fioli spielen.
»Ich weiß nicht recht, wie Sie das meinen, Mrs. Carawood.«
»Ach, Sie verstehen mich doch ganz gut«, sagte sie hartnäckig. »Wenn andere Leute Sie engagieren können, um Nachforschungen über die Gräfin anzustellen –«
»Es hat mich niemand zu diesem Zweck engagiert«, unterbrach er sie. »Ich war nur neugierig, weil ich soviel von ihr gehört hatte.«
Sie wußte instinktiv, daß das nur zu einem Teil wahr sein konnte, und vermutete, daß ihm tatsächlich ein Angebot gemacht worden war, das er aber abgelehnt hatte.
»Ich habe mich wahrscheinlich nicht gut ausgedrückt, ich habe nicht die Bildung wie Sie«, erwiderte sie ein wenig hilflos. »Aber es ist doch schließlich nichts Besonderes, um was ich Sie bitte. Jeder Gentleman könnte das doch tun. Vielleicht handle ich nicht richtig, aber ich brauche einen Beschützer für das Mädchen. Mr. Morlay, ich kann Sie dafür bezahlen, ich bin nicht arm.«
John lehnte sich in seinem Sessel zurück und beobachtete sie.
»Ich glaube, ich verstehe Sie jetzt. Es ist Ihr Wunsch, daß ich in gewisser Weise auf die junge Gräfin aufpasse. Es ist nicht ungewöhnlich, daß reiche Leute Privatdetektive für solche Zwecke anstellen. Aber leider ist das nicht mein Fach.«
Er sah die Enttäuschung in ihrem Gesicht.
»Es wird mir aber ein Vergnügen sein, wenn ich eine derartige Tätigkeit ehrenhalber übernehmen darf«, fuhr er fort. »Das heißt, wenn Sie es gestatten und wenn es der jungen Dame selbst nicht unangenehm ist.«
»Sie wollen mir also helfen, aber keine Bezahlung dafür annehmen?« fragte sie eifrig.
»Sie haben mich vollkommen richtig verstanden.«
Er lächelte sie an, aber sie schüttelte den Kopf.
»Die Sache soll rein geschäftlich zwischen uns geregelt werden. Ich möchte nicht, daß Sie es umsonst tun, sonst würde ich das unangenehme Gefühl nicht los, daß –«
Sie zögerte und suchte nach den rechten Worten.
»Daß Sie mir verpflichtet sind?« ergänzte er nach einer kurzen Pause. »Aber was würde denn die Gräfin Fioli dazu sagen, wenn sie einen bezahlten Freund hätte?«
Der Gedanke war ihr noch nicht gekommen, und sie überlegte.
»Marie würde nichts dagegen haben«, erwiderte sie schließlich, »wenn ich es gern sehe. Wollen Sie es für mich tun?«
Es war eigentlich ein ziemlich phantastischer Plan. Bei ruhigem Nachdenken hätte er ihn wohl doch noch abgelehnt. Aber Mrs. Carawood bat so dringend und sah ihn so flehentlich an, daß er nicht ruhig nachdenken konnte.
»Ich will alles tun, was in meinen Kräften steht«, entgegnete er kurz. »Nun sagen Sie mir aber auch genau, welche Pflichten ich habe.« Das hatte sie sich vorher schon überlegt.
»Sie wird ein paar Monate in Ascot wohnen – ich habe dort ein Haus für sie gekauft. Selbstverständlich sollen Sie nicht dauernd in Ascot sein, und auch sie bleibt nicht für immer dort. Wenn sie aber in London ist, möchte ich Sie bitten, sie zu begleiten. Ich weiß nicht, was alles passieren wird, aber ich fühle« – sie drückte die Hand aufs Herz –, »daß Marie Schweres bevorsteht. Und ich möchte jemanden haben, auf den ich mich verlassen kann, der mir hilft, wenn Schwierigkeiten entstehen.«
Ein merkwürdiger Vorschlag. Er sollte ein junges Mädchen ausführen und ihren Beschützer spielen. Und dabei kannte er Marie Fioli doch nur ganz oberflächlich. John war über sich selbst erstaunt, daß er auf diesen sonderbaren Plan einging. Im Grund seines Herzens fand er sogar großen Gefallen an diesen Aussichten für die Zukunft.
Auf dem Rückweg wiederholte sich Mrs. Carawood noch einmal jedes Wort ihrer Unterhaltung mit Morlay. Es kamen ihr zwar leise Zweifel, aber im Augenblick war sie beruhigt, daß sie die Gefahr sofort erkannt und beseitigt hatte. Nun besaß sie einen Verbündeten statt eines Gegners, der ihr sehr gefährlich hätte werden können.
Als sie ihren Laden in der Penton Street erreichte, fand sie dort wie gewöhnlich Mr. Fenner vor, der in ein eifriges Gespräch mit Herman verwickelt war.
Mr. Fenner war ein Schreinermeister mit merkwürdigen, anarchistischen Anwandlungen, im übrigen aber ein kluger, tüchtiger Mann. Er sprach wie jemand, der gewohnt ist, als öffentlicher Redner aufzutreten. Meistens war sein Gesicht düster; er haßte den Adel und setzte sich für die Arbeiterklasse ein. Aber Mrs. Carawood nahm ihn in der Beziehung nicht ganz ernst. Jeden Abend, wenn er mit der Arbeit fertig war und zufällig nicht auf einer Versammlung sprach, machte er einen Besuch in der Penton Street. Um eine Entschuldigung für seine Anwesenheit war er nie verlegen. Er hatte den Parkettboden gelegt und die Wände mit Paneel verkleidet, und er war so zuvorkommend, daß er eine Bezahlung für seine Arbeit ablehnte. Aber in diesem Punkt blieb Mrs. Carawood fest; sie ließ sich nichts schenken. Im Lauf der Auseinandersetzung kam es sogar so weit, daß sie ihn aufforderte, den Laden zu verlassen. Dann einigten sie sich aber doch.
»Guten Abend, Mrs. Carawood«, sagte Fenner. »Es ist schade, daß Sie nicht schon vorher hier waren, ich habe Herman gerade wieder einmal ein klares Bild der reichen Leute gezeichnet.«
»Es wäre besser, wenn Sie ihn in Ruhe ließen. Und machen Sie den Mund nicht so weit auf! Sie haben mir doch erst vorige Woche erzählt, daß Sie selbst sechshundert Pfund auf der Bank haben.«
»Das ist eine vollkommen irrige Auffassung, das ist kein Kapital, das sind Ersparnisse!« entgegnete Fenner ruhig.
Herman lachte laut auf.
Mr. Fenner sah den jungen Mann mitleidig an, sagte aber nichts.