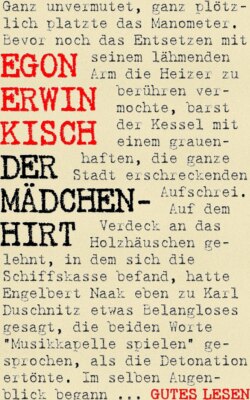Читать книгу Der Mädchenhirt – Ein Milieuroman - Egon Erwin Kisch - Страница 6
4
ОглавлениеKarl Duschnitz hatte nichts mehr zu fürchten gehofft. Das war während seiner Zeit am Meere in all seiner Unruhe die einzige Ruhe gewesen: daß ihm nach jener vielfachen Katastrophe nichts mehr genommen werden, nichts mehr widerfahren könne. Der ihm damals bevorstehende Weg zu dem Flößer war ihm wohl als etwas unendlich Peinliches erschienen, aber schließlich war immerhin in dem äußerlichen Umstand, daß dieser Mann von dem Vertrauensbruch in seiner Stube niemals etwas erfahren könne und ahnungslos die Belohnung als Dank für eine Lebensrettung glücklich entgegennehmen werde, eine Möglichkeit zu diesem Wege gewesen. Doch für Karl Duschnitz war noch Furchtbareres gekommen: die Mitteilungen der Flößersfrau, daß ihr Mann alles wisse und daß sie ein Kind bekommen werde. Ein Kind. Sein Kind. Die schauerlichste Stunde seines Lebens, seine einzige und seine schuftigste Tat, wollte in einem Menschen fortleben, in seinem Kind.
Daß der Flößer Chrapot so glatt abgefunden war, kam für Karls Gemütszustand natürlich gar nicht in Betracht. Duschnitz fürchtete das Kind, und im wollüstigen Eifer des Sich-selbst-Zerwühlens legte er sich dar, daß es nur die tausend Gulden waren, deren Empfang dem Flößer die Besinnung geraubt hatte; und nun werde ihm das Kind die Besinnung wiederbringen. Das Kind werde den Flößer immer und immer wieder zur zähneknirschenden Erkenntnis zurückrufen, daß er ein Narr gewesen sei, irgendeinen Ertrinkenden mit Mühe vom Tode zu retten und nach Hause zu tragen, damit ihm der gleich bequem sein Weib nehmen, sein einziges Glück vernichten, sein Heim schänden und dann gemächlich fortgehen könne. Duschnitz haßte und fürchtete das Kind.
Er rechnete die Wochen und Tage aus, dachte an Totgeburten und träumte von toten Kindern. Bis einmal der Flößer Chrapot zu ihm kam, ihm zu sagen, daß das Kind ein Knabe sei. Chrapot brummte noch etwas von »Taufe« und »morgen« und »Ehre sein«, aber Karl Duschnitz stierte ihn nur an, und um seine Augen tanzten Fötusse, zu frohem, ewigem Leben erwacht, und zeigten mit den Armen auf ihn. Es dauerte, bis er sich ermannte und dem Flößer Geld gab.
Von diesem Tage an war Duschnitz völlig zum Einsiedler und Sonderling geworden. Er verließ seine Wohnung in der Rittergasse nicht mehr, kleidete sich gar nicht an, sondern saß im Schlafrock jahrein, jahraus, Tag und Nacht am Fenster und sprach mit sich selbst. Manchmal kamen Verwandte oder alte Freunde der Duschnitzschen Familie und versuchten ihm diese Lebensweise auszureden. Aber er erwiderte nur kurz, daß er so zufrieden sei. Man mußte ihn kopfschüttelnd seinem Schicksal überlassen.
Hie und da kam der Flößer Chrapot, von seiner Frau geschickt, unter irgendeinem Vorwand, mit irgendeiner Anfrage, wie es Herrn Duschnitz gehe, irgendeinem Bericht, daß der Junge unwohl sei oder dergleichen. Duschnitz nahm das schon als etwas Selbstverständliches hin und gab dem Flößer immer ein Geldgeschenk.
Und einmal kam die Chrapotin selbst. Ihr Gast von damals war ihr selbst in den sechs Jahren, da sie ihn nicht gesehen hatte, in der Erinnerung sozusagen verklärt worden, sie hatte ein Sehnsuchtsgefühl nach dem feinen Herrn, der ihr das Glück ins Haus gebracht hatte, den Jungen, den Reichtum und den Neid der Nachbarn. Sie wollte ihn wieder einmal sehen und auch den Jaroslav dort einführen, damit er statt ihres Mannes, der oft auf der Floßfahrt war und immer kränker wurde, die Gänge zu Duschnitz machen könne.
Jaroslav hatte gerade ein Zeugnis nach Hause gebracht. Es war nicht schlecht, weil der Lehrer manche Fehler und manche Faulheit des Jungen seiner Unkenntnis der deutschen Unterrichtssprache zugeschrieben hatte. Frau Chrapot zog nun dem Jungen seinen neuen Anzug an, kämmte und wusch ihn eifrig, putzte sich selbst möglichst heraus und ging zu Duschnitz, um ihm den Jungen zu zeigen, daß der Junge in die deutsche Schule gehe und gute Fortschritte mache. »Wir gehen jetzt zu einem sehr noblen Bekannten, sei recht artig dort«, schärfte sie dem Kleinen ein.
So empfing Duschnitz den Besuch der zwei Menschen, die er haßte und fürchtete. Es war die Furcht, die ihm Fragen nach dem Familienleben der Chrapots diktierte, es war die Hoffnung, zu erfahren, daß sein Besuch nicht jenen Zerfall des häuslichen Glückes hervorgerufen hatte, wie er ihn sich ununterbrochen ausmalte. Aber die Chrapot war viel zu schlau, um ihm die Wahrheit zu sagen: »Na, das können Sie sich denken, daß er mir das jede Weile vorwirft.«
Duschnitz überlief ein klammernder Schauer: »Und wie ist er zu dem Jungen?«
»Er kann ihn nicht leiden«, log die Chrapot.
»Weil er ihn an das Vorgefallene erinnert?«
»Ja, ja.«
Meidend suchte der gebückte Kopf Duschnitz’ die Augen seines Sohns, suchte in ihnen die Spuren seiner Leiden, suchte in ihnen die Leichen seiner Freunde, eine umklammerte Schiffsplanke, einen glücklichen Flößer und einen geilen Frauenblick und ein zerfleischtes Familienglück und einen zerstörten Glauben an das Wunder.
Der kleine Jarda schaute geblendet und verblüfft herum, durch die offene Türe in das Nebenzimmer, auf den Plafond, von dem in hundert Kristallen gläserne Blumen baumelten, auf die Wand, an der schwarze große Herren und Frauen in alten Bildern hingen und ein mächtiger Spiegel mit geblümtem Glas als Rahmen, in die Ecke, in der ein bauchiger Glaskasten mit unverständlichen Schnitzereien, Figürchen, Männlein, Porzellankatzen, Häuschen und Gruppen stand.
»Sehr ähnlich ist Ihnen der Junge«, sagte die Chrapot, »sehr. Die Augen, die Nase.«
Karl Duschnitz fiel ein, daß er dem Jungen etwas schenken müsse, daß das der Zweck des Besuches sei. Schwerfällig erhob er sich von dem braunen Lederstuhl und ging zum Nachttisch an seinem Bett, entnahm dem Schubfach einen Schlüsselbund und schritt zur eisernen Kasse, die neben der Türe stand. Wie eingehängt sind in ihn die gierigen Blicke von Mutter und Kind. Im oberen Fach der Kasse steht ein Schmuckkästchen, das Duschnitz zum Fenster trägt. Gold klingt darin und rasselt. Er sucht eine Uhr heraus und dann eine Kette mit blauen Perlen. Die befestigt er an der Uhr und reicht sie dem Kleinen, ohne ihn anzusehen.
»Da hast du.«
Mit gehöhlter Hand packt Jarda zitternd das Geschenk. Eine goldene Uhr, rückwärts auf dem Mantel mit einem weißen Bild auf kobaltblauem Email, ein Hirsch und zwei Hunde und ein Jäger mit einer großen, gewundenen Trompete und noch ein Jäger mit erhobenem Gewehr. Eine wirkliche Uhr, nicht ein so schundiges Spielzeug wie jene, die er sich am Nikolomarkt um zehn Kreuzer gekauft und protzig mit der Kette zum Spiel getragen hat. Jarda legt sie ans Ohr.
»Die muß ich erst aufziehen, gib her«, sagt die Mutter.
Widerstrebend trennt er sich von dem Kleinod.
»Die kriegst du aber noch nicht«, sagt die Mutter laut, damit Duschnitz höre, sein Geschenk werde in Ehren gehalten, »erst bis du größer bist. Jetzt würdest du sie nur verderben.« Tsrr, tsrr, tsrr macht das Uhrwerk, da es Frau Chrapot aufzieht.
Jarda schaut wieder in dem herrlichen Reich umher, das so etwas ganz anderes ist als das Zimmer zu Hause und die Wohnungen der Kampa-Leute, in denen er war. Er hatte gar nicht gedacht, daß es so etwas Prächtiges geben könne. Und dort, auf dem Schreibtisch, ah, das ist etwas Wunderbares. Ein kleiner Handschar ist es, der als Papiermesser dient. Die Augen des Jungen bohren sich in den graugelben Hornschalen des Messergriffs und in dem Glanz der vernickelten Klinge fest. Wenn ihm der Herr lieber dieses Messer schenken möchte statt der Uhr! Da würden die Kampa-Jungen Respekt haben und Furcht, wenn er es so aus der Tasche ziehen würde. Ob er darum bitten könnte? Das geht wohl nicht, da würde die Mutter gewiß schimpfen.
Wenn er es wenigstens anrühren könnte! Langsam, wie absichtslos, rückt er dem Schreibtisch näher. Und plötzlich packt er den Messergriff in die Faust und streckt ihn in knappem Bogen so hoch über sich, wie sein Arm reicht.
»Schau her, wie das schön ist, Mutter«, jauchzt er.
Karl Duschnitz springt von seinem Stuhl auf, nichts mehr von der ächzenden Anstrengung ist zu sehen, mit der er sich früher aufgerichtet hat. Sein flackernder Blick ist jetzt festgehalten in einem Entsetzensstrahl, der nach dem messerschwingenden Jungen geht. Es ist, als ob er sich, blaß, dem kleinen Jungen entgegenstürzen wollte, aber er bleibt an dem Stuhl stehen, er sagt nur kurzatmig: »Leg – leg das hin.«
Ängstlich gibt Jarda das Messer wieder an seinen Platz. Er versteht nicht, wie sich der fremde Herr so aufregen könne. Auch Frau Chrapot ist ganz verblüfft, aber sie weiß doch Worte zu finden.
»Du Lausbub, kannst du nicht einmal in fremder Wohnung artig sein? Na warte, zu Hause wirst du schon deinen Teil kriegen!« Zu Duschnitz: »Sie müssen entschuldigen, gnädiger Herr. Wenn so ein Junge ein Spielzeug sieht, ist er wie verrückt.«
Duschnitz ist mit lautem Atmen wieder sitzend gebeugt. Er sammelt sich krampfhaft zu einer Antwort: »Ach, es war ja nichts. Ich bin nur so schrecklich nervös.«
Jarda muß dem Herrn noch einen schönen Dank sagen und ihm die Hand küssen, dann gehen Frau Chrapot und Jaroslav.