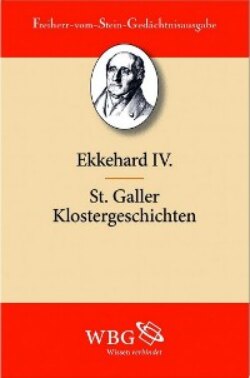Читать книгу St.Galler Klostergeschichten - Ekkehard IV. - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Ekkehards Leben und Werk
ОглавлениеÜber die Person Ekkehards IV. liegen uns nur spärliche und undeutliche Nachrichten vor. Schon sein Geburtsjahr läßt sich höchstens annähernd bestimmen. Daß es noch vor das Jahr 1000 fallen muß, geht aus Kap. 21 der ›Casus‹ hervor, wo der Tod des Welfen Heinrich mit einer persönlichen Erinnerung des Chronisten verknüpft erscheint. Rechnet man danach weiter zurück, wird man auf ein Datum etwa aus den frühen achtziger Jahren des zehnten Jahrhunderts geführt. Ekkehard war also rund eine Generation jünger als Notker der Deutsche, der nachmals sein Lehrer wurde und dessen er selber stets mit Verehrung gedenkt (z.B. Casus, Kap. 80). Nach Notkers Tod (im Pestjahr 1022) finden wir Ekkehard ziemlich unvermittelt in Mainz, in der Umgebung von Erzbischof Aribo. Die Chronologie dieses Aufenthaltes ist durchaus unsicher; einen festeren Anhaltspunkt bietet lediglich die bekannte Ingelheimer Szene von Ostern 1030, dargestellt in Kap. 66 der ›Casus‹ und mit deutlich autobiographischen Reflexen erfüllt. Ekkehards Rückkehr nach St. Gallen, woer wieder wie zuvor als Magister wirkte, dürfte ein oder zwei Jahre später, jedenfalls nach Aribos Tod (1031) erfolgt sein. Zu seinem ferneren Leben besitzen wir außer der Angabe seines Sterbetages (21. Oktober7) keine direkten Daten mehr. Doch läßt sich einem Hinweis auf Wiboradas Kanonisation (1047) in den ›Casus‹ und einer Anspielung auf den Tod Papst Victors II. (1057) in einer seiner Orosius-Glossen entnehmen8, daß Ekkehard noch nach der Jahrhundertmitte mit Schreiben befaßt war und allem Anschein nach ein beträchtliches Alter erreichte.
Sucht man diesen biographischen Abriß mit einem Werkkatalog zu ergänzen, so sind auch hier genauere chronologische Angaben nicht möglich. Immerhin lassen sich drei verschiedene Schaffensperioden einigermaßen klar voneinander abgrenzen. Zu Ekkehards ersten, noch vor 1025 zu datierenden Versuchen zählen, neben einer Reihe von Schulübungen und Gelegenheitsgedichten, vor allem die Tituli zum Gallus-Bilderzyklus9 sowie die Umsetzung von Ratperts deutschem Galluslied ins Lateinische10. Bereits den Mainzer Jahren gehören seine bedeutendsten Versdichtungen an, nämlich die Tituli zu Gemälden der Mainzer Domkirche11, die poetischen Tischsegnungen12 und die Verssegen zu den Lesungen während des Kirchenjahres13. Einem dritten und letzten Abschnitt endlich entstammen die ›Casus sancti Galli‹. Das Werk – Alterswerk wie es scheint – entstand im Anschluß an Ratpert und sollte dessen Chronik bis in die Zeiten Norperts (1034–1072) heraufführen. Aber so weit ist die Fortsetzung Ekkehards nicht mehr gediehen. Mitten im Bericht über das Regiment Abt Notkers (971–975) bricht sie ab – warum, ist nicht überliefert14; doch wird man am ehesten an Krankheit und Tod denken müssen, die dem Autor die Feder aus der Hand genommen.
Über seine schriftstellerischen Absichten hat sich Ekkehard in einer Vorrede etwas näher ausgelassen. Wobei er nun freilich mit einer beiläufigen Bemerkung über Abt Norpert sich dem Mißverständnis aussetzte, als habe er seine Klostergeschichten mehr nur zum Protest wider die Reformideen seiner Zeit geschrieben. Indessen, weit entfernt von Tadel und Vorwurf, will jene Zwischenbemerkung, die formal an ein Wort des Terenz erinnert, nicht anders denn als Devise mönchischer Selbstbescheidung genommen werden15. Das Praeloquium der ›Casus‹ skizziert kein polemisches, wohl aber ein literarisches Programm. Wie er dort deutlich zu verstehen gibt16, suchte Ekkehard seinen Stoff – über das Schema reiner Annalistik hinaus – nach einem besonderen erzählerischen Prinzip zu gestalten. Er wollte die Geschichte des Klosters unter dem Aspekt der fortunia et infortunia aufrollen und darstellen. Glück und Unglück sollten die beiden bestimmenden Pole sein, um die sich die casus varii historischen Geschehens und Geschicks in mehr oder weniger scharfer Kontrastierung gruppieren ließen. Dieser sein Leitgedanke stempelt Ekkehard geradezu zu einem Kronzeugen für die von Pickering so angelegentlich vertretene These, daß alle Geschichtsschreibung des Mittelalters, wofern sie nicht der heilsgeschichtlichen Konzeption Augustins anhange, der Fortuna-Ideologie des Boethius verpflichtet sei17 – und tatsächlich gehörte, wie wir wissen, die ›Consolatio philosophiae‹ zu der in St. Gallen gepflegten Schullektüre18.
Auf alle Fälle aber hat Ekkehard IV. seine Aufgabe anders verstanden und anders angepackt als sein Vorgänger Ratpert, auch wenn er selber vielleicht wähnen mochte, durchaus im gleichen Sinn und im gleichen Stil weiterzufahren. Allein, die Unterschiede sind spürbar groß. Bei Ratpert steht die juristisch-politische Entwicklung des Monasteriums entschieden im Vordergrund, wobei er als tüchtiger Chronist, der er ist, sich von Mal zu Mal die Mühe macht, seine Darstellung dokumentarisch zu untermauern. Gewiß, auch Ekkehard läßt zum Beispiel verfassungsgeschichtliche Momente nicht gänzlich außer acht: wo es, wie in der Auseinandersetzung mit den Ottonen (Kap. 128ff.), um Rechte und Freiheiten des Klosters ging, war er schließlich gezwungen, darauf einzugehen. Doch tut er dies nie mit fachmännischer Einläßlichkeit. Er berührt die betreffenden Punkte und berührt sie summarisch genug, aber entsprechende Akten und Urkunden heranzuziehen, fällt ihm kaum jemals ein. Die Perspektive des Archivars sagt ihm nichts; wie fremd sie ihm ist, zeigt er unverstellt und in schönster Treuherzigkeit in Kap. 25, wo er auf die Aufzählung bestimmter Güter und Orte nur deshalb verzichtete, weil er ihre Namen hätte in den Papieren des Archivs suchen müssen. Auch sonst ist Ekkehard mit Ausflüchten rasch bei der Hand, wenn es sich darum handelt, schriftliche Quellen um der Bequemlichkeit willen zu übergehen und auszuklammern (z.B. Kap. 109). Für ihn gründet Geschichte zuvorderst in der mündlichen Überlieferung. Worauf er sich am liebsten und bedenkenlos stützt, das sind die Aussagen der Väter und Lehrer, die Mitteilungen der im Kloster alt gewordenen Insassen, über deren Gedächtnis und Erinnerung sich zweifellos weit zurück in die Vergangenheit greifen ließ – ob freilich mit hinreichender Zuverlässigkeit, scheint Ekkehard nicht sehr gekümmert zu haben. Wie es ihm denn überhaupt nicht liegt, sein Material lange zu prüfen, sorgsam zu sichten und gründlich zu ordnen. Systematik ist nicht sein Fach. Geschichte lebt für ihn im Einzelzug, im Anekdotischen, und darum auch ist sein Interesse viel weniger sach- als personenbezogen. Damit wieder hängt zusammen, daß ganze Kapitelfolgen der ›Casus‹ sich wie Romanpartien lesen, indem der Zuschnitt auf das Biographische immer wieder eindeutig dominiert. Kein Wunder, daß Josef Victor von Scheffel daraus so leicht seinen eigenen ›Ekkehard‹ (1854) destillieren konnte.
Anders auch als Ratpert, der sich auf die Figuren allein der Äbte konzentrierte, ging Ekkehard darauf aus, die Geschichte aller irgend bedeutenderen Brüder miteinzubauen19, womit er seine Chronik von vorneherein auf eine viel breitere Grundlage stellte. In der Tat ist die Spannweite der Darstellung überraschend groß. Ekkehards Blick umfaßt vieles, und vieles zugleich. Dieser Blick geht auch mühelos über den engeren lokalen Bereich hinaus. Ekkehard bleibt nicht wie Ratpert starr an St. Gallen gebunden. Er vermag Blickpunkt und Blickwinkel ohne weiteres zu wechseln und läßt so eine gewisse Weitläufigkeit erkennen, wie man sie bei einem einfachen Mönch aus der Provinz nicht eben vermuten würde. Aber hier kamen ihm die in Mainz und am Rhein verbrachten Jahre offensichtlich zugute. Ohne sie hätte er die Szenen am Königshof und in den rheinischen Bischofsstädten, hätte er Tuotilos auswärtige Fahrten und Abenteuer wahrscheinlich nicht derart überzeugend kolorieren können. Aus manchem Detail spricht eigenes Erleben, und mit einer Gestalt wie Ekkehard dem Höfling, welcher zugleich in zwei Welten heimisch war, mochte der vierte Ekkehard am Ende, wer weiß, sich selber identifizieren.
Zu dem reichen und bewegten Inhalt des Werkes gesellt sich eine überaus lebendige Erzählform. So sorglos und unkritisch Ekkehard den Stoff gesammelt hat, so bewußt arrangiert er ihn und so überlegt bringt er ihn zu künstlerischer Wirkung. Natürlich darf man diese Kunst nicht an modernen Stilidealen messen. Was uns heute vielleicht ein Mangel, eine Schwäche dünkt, konnte damals durchaus als Vorzug, ja als besondere Finesse empfunden werden. Ein klarer, geradliniger Aufbau war so wenig gefordert wie eine exakte zeitliche Abfolge. Im Gegenteil fanden das Uneinheitliche und das Sprunghafte mehr Anklang, und eine Schilderung, die sich nicht in Exkursen und Digressionen erging, vermochte höheren Ansprüchen ohnehin nicht Genüge zu tun. Es ist daher ganz unbegründet, von Nachlässigkeit zu reden20, wenn Ekkehard beispielsweise die Beschreibung der Ungarnnot (Kap. 51–56 sowie 62–65) mit einer Serie von Ulrich-Geschichten unterbricht: hierin liegt vielmehr bewußte literarische Absicht, indem so, dem Grundprinzip der fortunia et infortunia gemäß, auch die dunkelste Zeit St. Gallens ihr tröstliches Licht erhält21.
Ekkehards Gestaltungskunst wird allgemein und mit Recht gerühmt. Sie ist vielseitig, wandlungsfähig, nuancenreich. Am meisten besticht sie mit ihren Dialogen, deren ausgefeilte Technik nicht minder fasziniert als die psychologisierende Funktion, die ihnen eignet und eignen soll. Nach Gregor von Tours ist Ekkehard von St. Gallen wohl der erste Geschichtsschreiber, der wieder so intensiv Gebrauch macht von diesem Mittel, Menschen und Taten in unmittelbarer Dramatik vorzuführen. Woher er es bezogen haben könnte, ob aus christlichem, ob aus römischem Stilerbe, ist nicht auszumachen. In seinem Werk treffen und vereinen sich ja beide Traditionen22. Was die klassischen Muster betrifft, so spielen sie wohl eine größere Rolle, als man bisher vermutete. Zitate aus antiken Autoren, namentlich aus Vergil und Terenz, finden sich gar nicht so selten eingestreut, wenngleich sie meist mehr wie unverbindlich rhetorische Zugaben wirken. Bei aller gelehrsamen Freude, die Ekkehard an ihnen bezeigt, wiegen sie letztlich doch leichter als die Parabeln, die aus dem christlichen Schrifttum geschöpft sind. Nicht umsonst kehrt Ekkehard neben dem Erzähler und neben dem Dichter so oft den Theologen hervor. Wirklich ist seine theologische Bildung fundiert und umfassend: umfassender vermutlich als seine (im übrigen nicht geringe) klassische Bildung. Persönlich jedenfalls hat er sie höhergestellt und stets auch nachdrücklicher ausgespielt23. Dieses Verhältnis möchte für Ekkehards Einstellung kennzeichnend sein. Es ist genau das Verhältnis, das die Bildungssphäre seines Klosters bestimmt. Es verkörpert sich darin der traditionelle Geist der St. Galler Schule, in der die alten heidnischen Autoren zwar nicht geächtet, aber eben doch nur mit Vorsicht empfohlen und nur mit Vorsicht studiert worden sind24.
Als Teilstück einer spezifischen Hauschronik haben Ekkehards Klostergeschichten verständlicherweise kein weittragendes Echo ausgelöst. So beschränkt sich ihr Nachleben auf die anonyme (früher einem fünften Ekkehard zugeschriebene) ›Vita Notkeri Balbuli‹, die ihren Grundstoff weitgehend und streckenweise sogar wörtlich bestimmten ›Casus‹-Partien (bes. der Kap. 33ff.) entnommen hat.